Zum Tode des großen Liberalen Gerhart Baum. Erinnerungen an unseren Freund des Liberalen Zentrums Kölns
Von Roland Kaufhold
Gerhart Baum war mir und uns – Peter Finkelgruen und den Mitstreitern des Liberalen Zentrum Kölns – immer präsent: Als selbstloser Freund und Unterstützer. Als mahnende linksliberale Stimme für Liberalität, gegen den Überwachungsstaat und für Menschenrechte, weltweit. In den letzten Jahren wurden seine Warnungen vor der Gefahr, die die rassistische und rechtsradikale AfD für die Grundlagen unserer Demokratie darstellt, immer nachdrücklicher.
Noch vor vier Wochen, im Januar, hatte er in einem Interview von einer schweren Krankheit berichtet, die er doch noch überlebt habe. Aber dann lenkte der unermüdliche, sein Leben lang für die Werte der Demokratie kämpferische Baum von seiner Krankheit ab und sprach eindrücklich von der größten Gefahr, der wir heute wehrhaft begegnen müssen: Dem Rechtsradikalismus, der antidemokratischen Grundstimmung. Die AfD sei heute die größte Gefahr für Europa und Deutschland. Erstmals seit 1945 sei die Demokratie durch die flächendecken Wahlerfolge der AfD ernsthaft bedroht. Er habe noch nie seit 1945 einen derart bedrohlichen Rechtsradikalismus erlebt. Auch mit 92 Jahren, trotz seiner schweren Krankheit, müsse er und müssten wir Demokraten dagegen aufstehen. „Aber man muss etwas tun, solange es geht“, betonte der 92-Jährige. Und nun, am 15. Februar, hat ihn der Tod doch nachts ereilt.
Dresden
Als Sohn eines Rechtsanwaltes und einer aus Russland gebürtigen und von dort geflohenen Mutter wuchs der am 28.10.1932 in Dresden Geborene in der Nazizeit auf. Diese prägte ihn: Der Kampf gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit, für die Opfer des Nationalsozialismus, gegen den Antisemitismus blieb seine lebenslange Mission. Sie führte ihn Mitte der 1950er Jahre schon als Student in die Politik, in die FDP. Diese wurde in den 1950er Jahren, insbesondere in NRW, zum Teil noch durch „ehemalige“ hochrangige Nationalsozialisten geprägt, die sich innerhalb der FDP im „Naumann Kreis“ organisierten.
Der junge liberale Demokrat Gerhart Baum wusste, in welche Partei er eintrat. Die Entscheidung wurde von ihm bewusst gewählt, mangels parteipolitischer Alternativen. Gerhart Baum versuchte, zuerst an der Universität, dann bei den Jungdemokraten und dann sehr rasch direkt bei der Kölner und der NRW-FDP ab Mitte der 1950er Jahre für die junge Demokratie zu kämpfen.
Mit zehn Jahren musste Gerhart Baum zum „Jungvolk“, mit zwölf Jahren erlebte er am 13./14.2.1945 die Bombardierung Dresdens. Innerlich blieb er mit dieser furchtbaren Erfahrung verbunden. Die Bilder der Toten, die Geräusche der Bomben ließen ihn nicht mehr los. Jahrzehnte später, als profilierter linksliberaler Politiker und ehemaliger Innenminister, fuhr er immer wieder nach Dresden, und auf Kundgebungen gegen Neonazis in Dresden zu sprechen. Der Kampf für die Werte der Demokratie blieb für ihn eine lebenslange Verpflichtung.
Köln
1950 zogen die Baums nach Köln. Dort besuchte der 18-jährige Gerhart das Köln-Nippeser Leonardo-da-Vinci Gymnasium, wo er sein Abitur ablegte. Als eben dort, in Nippes, vor wenigen Jahren eine Initiative zur Würdigung der Nippeser Edelweißpiraten entstand beteiligte sich Gerhart Baum zusammen mit seinem engen Freund Peter Finkelgruen 70 Jahre später, am 9.5.2023, an einer Podiumsdiskussion über den unangepassten jugendlichen Widerstand in seinem ehemaligen Gymnasium. „Ich möchte auf jeden Fall versuchen, noch einmal in meine damalige Aula zu gelangen“, erzählte er uns.
Gerhart Baum, der sich zeitlebens und in seinen letzten Lebensjahrzehnten noch intensiver und solidarisch als langjähriger Leiter der NRW-Kulturrates für Kultur und Kulturpolitik interessierte und engagierte – bereits Baums Onkel Günther Baum (1906-1983) war ein Gesangspädagoge und Opernsänger – zögerte wohl anfangs bei seiner Studienwahl. Seine Mutter empfahl ihm ein Medizinstudium. Gerhart Baum entschied sich dann 1954 doch für das Jurastudium an der Kölner Universität, welches er 1957 abschloss.
Jura erschien dem entschiedenen Rechtsstaatsverteidiger und Menschenrechtler als die aussichtsreichste Möglichkeit, am Aufbau der jungen, gefährdeten Demokratie nach den Jahren des Unrechts und des Faschismus mitzuwirken. Das Studium selbst empfand der kulturell stark Interessierten als eher langweilig, anregungsarm. Es erfüllte ihn innerlich nicht wirklich. Die konkrete juristische Arbeit, die juristische Verteidigung von Menschen- und Grundrechten hingegen interessierte ihn stärker. 1961 schloss Gerhart Baum sein 2. juristisches Staatsexamen ab. Es folgte von 1962 bis 1972 eine Tätigkeit als Mitglied in der Geschäftsführung der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitsgeber – und parallel hierzu engagierte er sich linksliberal und in radikaldemokratischen Kontexten.
Ab 1954 Jungdemokraten und FDP: „Ich war ein ausgewiesener Linksliberaler!“
1954 trat er 22-jährig den Jungdemokraten, dem liberalen Studentenbund (LSV) wie auch, wohl etwas später, der FDP bei. Die Deutschen Jungdemokraten (DJD) waren seinerzeit und in den wilderen Jahren nach 1968 die progressivste Jugendorganisation, der auch der Autor dieser Zeilen wenige Jahre angehört hat. Von 1966 – 1968 war Baum Bundesvorsitzender der Jungdemokraten. In den Zeiten der „Apo“ steuerte er einen sehr eigenständigen linksliberalen und radikaldemokratischen Kurs: Zwar solidarisch als FDP-Parteimitglied aber geprägt von einer Entschlossenheit, die verkrusteten, noch stark vom nationalsozialistischen Erbe geprägte gesellschaftliche Mentalität – dem er in der FDP (Naumann-Kreis, E. Achenbach, E. Mende, W. Best und S. Zoglmann) über Jahrzehnte sehr konkret begegnete – im Dialog aufzubrechen. Insbesondere seine NRW-FDP hatten Anfang der 1950er Jahre „bewährte Nazis zur Unterwanderung der Partei“ eingeladen, schrieb die Zeit (23.12.2013). Bei einer Tagung zu 100 Jahre Jungdemokraten Der liberale Rechtsstaat ist nicht verhandelbar – Demokratischer Salon meinte Baum mit böser Ironie, es sei seinerzeit nahezu unmöglich gewesen, einem FDP-Vorstand anzugehören, dem keine SS-Mitglieder angehört hätten.
Gerhart Baum wusste schon in jungen Jahren, wie streitbare Demokratie geht, wie er in dieser Interviewpassage über seine politischen Anfänger erinnert: „Ich war ein ausgewiesener Linksliberaler!“. Auf der Jungdemokraten-Tagung anlässlich des 100.ten Geburtstages der Jungdemokraten, auf der das Jungdemokraten-Buch von Appel & Kleff (2019) vorgestellt wurde, hielt Gerhart Baum eine flammende Rede über die Kraft und historische Bedeutung der Linksliberalen.
Auf diesem Kongress (2019) hielt Baum auch eine weitere Grundsatzrede zu „Grundrechte im Digitalen Zeitalter“. Innerlich blieb Baum auch nach der „Wende“ 1982 und der Abkehr des größten Teils seiner ehemaligen Mitstreiter aus dem linksliberalen Spektrum von der FDP seinen inneren Werten treu. Den Kontakt zu seinen um 1982 aus der FDP ausgetretenen zahlreichen linksliberalen und radikaldemokratischen Freunden ließ er nie abbrechen, wie auch seine Teilnahme an dieser Jubiläums-Tagung zeigt.
Baum widerstand als Jungdemokraten-Vorsitzender in Köln sowie danach als Bundesvorsitzender der Jungdemokraten (1968-1968) der Versuchung einer aktivistisch-linksradikalen Tendenz, wie sie sich wenige Jahre später in brutal-selbstanmaßend-zerstörerischer Weise insbesondere in der RAF zeigte. Und Gerhart Baum wollte, zusammen mit der jüngeren Generation, die sich ab Mitte der 1960er Jahre der relativ kleinen, noch veränderbaren FDP in linksliberaler bzw. radikaldemokratischer Grundhaltung anschlossen – Ingrid Matthäus-Maier, Helga Schuchardt, Prof. Ulrich Klug (vgl. Kaufhold 2020, Kaufhold 2022) und Andreas von Schoeler seien als „prominente“ damalige FDP-Abgeordnete genannt – , die FDP zu einer wirklich liberalen, in seinem Sinne: linksliberalen Kraft umzuformen. Die von Gerhart Baum wenige Jahre später – 1971 – maßgeblich formulierten und von der FDP offiziell verabschiedeten Freiburger Thesen (Oktober 1971) waren der beeindruckendste programmatische Entwurf einer politischen Partei Anfang der 1970er Jahre. Deren theoretische Strahlkraft, einschließlich des Beschlusses, den Umweltschutz als zentrale handlungsleitende Kategorie in das Grundgesetz aufzunehmen – zentraler Vordenker war hierbei der Liberale Peter Menke-Glückert (1929-2016), unterstützt und gefördert durch Gerhart Baum, hält bis heute an. Die gesamte FDP einschließlich ihrer Spitze rang 1971 mit den Freiburger Thesen um einen politischen, einen „Dritten Weg“ zwischen Kapitalismus und Marxismus.
Früher Kampf für die Rehabilitation der Kölner Edelweißpiraten
Auch noch Jahrzehnte später zog Gerhart Baum aus diesem frühen Engagement, das in seinen verstörenden Kindheitserfahrungen während der Nazizeit verwurzelt war, politische und humanitäre Kraft: Er setzte sich, gemeinsam mit Prof. Ulrich Klug und seinem Freund Peter Finkelgruen bereits ab Mitte der 1970er Jahre für die Kölner Edelweißpiraten ein, die Unangepasstheit mit politischem Widerstand verbanden (Finkelgruen 2020, 2022): Zuerst recherchierend und dann politisch fordernd. Es war ein Jahrzehnte andauernder politischer Kampf, wie er sich bei der Vorstellung unseres Edelweißpiratenbuches (Finkelgruen 2020) erinnerte.
Immer wieder, wenn Gerhart Baum zusammen mit Peter Finkelgruen für unser 1981 von Finkelgruen abgeschlossenes – aber erst 2020 veröffentlichtes – Edelweißpiratenbuch „Soweit er Jude war…“ (Finkelgruen 2020, Kaufhold 2020) auftrat, was ihm eine Herzensangelegenheit war und wofür er sich noch 90-jährig mit Leidenschaft engagierte, erinnerte er in seinen Ansprachen und Erinnerungsreden den mehrere Jahrzehnte langen Kampf um die Rehabilitation der Kölner Edelweißpiraten. Diese mutigen Kölner waren gewissermaßen seine Jugend-Freunde im Geiste. Gerhart Baum suchte auch den Kontakt zu Jean Jülich und dessen Kindern. Jean Jülich und später dessen Tochter Conny betrieben einen bekannten Veranstaltungsraum in der Kölner Severinstorburg, nur wenige 100 Meter von Baums späterer Wohnung und Kanzlei entfernt.
1950er und 60er Jahre: Gerhart Baum gegen die Schlussstrichforderungen, gegen das Vergessen
Baum erwähnte bei seiner besagten Edelweißpiraten-Rede den heftigen politischen und gesellschaftlichen Widerstand, den er Ende der 1950er Jahre als Vorsitzender der Kölner Jungdemokraten erlebte, als er sich bereits seinerzeit, vor 70 Jahren, gegen die Schlussstrich-Forderungen stemmt: „Sie können sich gar nicht vorstellen, gegen was für Kräfte wir damals kämpfen mussten“, hob der knapp 90-Jährige in seiner Buchvorstellung von Finkelgruens Edelweißpiratenbuch im Sommer 2020 hervor. Zu diesem hatte Gerhart Baum gleich zwei Vorworte beigesteuert.
„Ich erinnere mich noch sehr genau, wie wir, wir Jungdemokraten und weitere Kölner Jugendorganisationen, seinerzeit in Köln ein Kino gemietet hatten, um den Film „Nacht und Nebel“ (1956) von Alain Resnais und Anatole Dauman zu zeigen. Dieser war einer der ersten Filmdokumente überhaupt, die uns erstmals die ganzen Verbrechen in den Konzentrationslagern vor Augen gebracht hatten. Das stieß auf allgemeines Missfallen. Darüber redet man doch nicht Das muss doch mal zu Ende sein“, war bereits knapp 70 Jahren der Verleugnungs-Wunsch der Mehrheitsgesellschaft. „Nein!“, rief Gerhart Baum im Sommer 2020 im Kölner Friedens-Park bei seiner Buchvorstellung dem überwiegend Jahrzehnte jüngeren Publikum zu, „das ist nicht zuende mit unserer deutschen Erinnerungskultur!“ Peter Finkelgruen habe mit seinen Recherche und seiner Erinnerung an die Edelweißpiraten, mit seinem einsamen, unbeirrbaren, entschlossenen Kampf für deren Anerkennung für deren Rehabilitation gesorgt. Finkelgruen und Ulrich Klug hätten schon ab Mitte der 1970er Jahre Pionierarbeit für die deutsche Erinnerungskultur geleistet.
Als Yad Vashem dann 1984 in einer berührenden Zeremonie, repräsentativ für drei Opfergruppen des Naziregimes, drei Edelweißpiraten bzw. jugendliche Widerständler als Gerechte unter den Völkern ehrte – Jean Jülich, Bartholomäus Schink und den Widerständler und späteren deutschen Botschafter Michael Jovy (vgl. Kaufhold 2020) – nahm auch Gerhart Baum an dieser Zeremonie in Jerusalem teil. In Köln hingegen galten die jugendlichen Kölner Unangepassten und Widerständler 1984 und noch 21 weitere furchtbare Jahre als „Kriminelle“, als Ausgestoßene. Sie, die beim Nazitum, im Gegensatz zu der Majorität der Kölner, nicht mitgemacht hatten (vgl. Kaufhold 2020). Ulrich Klug (Kaufhold 2023), Gerhart Baum und Peter Finkelgruen, seinerzeit alle in der Kölner FDP aktiv, engagierten sich bereits ab Mitte der 1970er Jahre auch im Namen der Kölner FDP für die Rehabilitation der Edelweißpiraten. Alle anderen Kölner Parteien hingegen vertraten seinerzeit noch entschieden das geschichtsrevisionistische Märchen von der „Kriminalität“ der Edelweißpiraten (vgl. Kaufhold 2020).
Gerhart Baums Karriere als prominenteste Kölner Stimme der Linksliberalen in der FDP – auch nach 1982
Ab Mitte der 1970er Jahren waren es vor allem Persönlichkeiten aus dem linkliberalen Milieu, die sich in der Kölner FDP zusammen gefunden hatten und für die Rehabilitation der unangepassten und widerständigen Kölner Edelweißpiraten kämpften: Prof. Ulrich Klug, Gerhart Baum und Peter Finkelgruen. Es war die Kölner FDP alleine, die dies im Kölner Stadtrat politisch durchzusetzen versuchte. Die Spitzenvertreter der Kölner SPD, Antwerpes und Burger, waren in den 1970er bis 1990er Jahren die entschiedensten Gegner der Edelweißpiraten, wie es Peter Finkelgruen und Gerhart Baum 2020 eindrücklich erinnert und beschrieben haben (vgl. Finkelgruen 2020, Kaufhold 2020).
Gerade in Köln fand Gerhart Baum in den Jahren ab etwa 1968 Hunderte von MitstreiterInnen, die sich dem starken linksliberalen Flügel innerhalb der Kölner FDP anschlossen. Als wortgewaltiger, sehr streitfähiger und den Dialog mit dem politischen Gegnern doch nie abbrechen lassender überzeugter Demokrat wurde Gerhart Baum sehr rasch die wichtigste, bundesweit wahrgenommene Stimme der Linksliberalen in Köln.
Gerhart Baums politische Karriere war beeindruckend: Von 1969 – 1973 war er Mitglied und FDP-Fraktionsvorsitzender im Kölner Stadtrat. Die Karriere des gradlinigen und redegewandten Linksliberalen nahm weiter Tour auf: 1972 wurde er Kölner FDP-Bundestagsabgeordneter und zugleich Parlamentarischer Staatssekretär bei den damaligen Bundesinnenministern H.-D. Genscher und Werner Maihofer (bis 1978). Von Juni 1978 – September 1982, bis zur „Wende“, war Baum Bundesinnenminister unter Helmut Schmidt. Und auch noch danach, bis 1991, gehörte er dem Präsidium der FDP an.
1994, zwölf Jahre nach der „Wende“ der FDP zur CDU Kohls und deren vorsätzlichem Koalitionsbruch, hatte der rechte Flügel der FDP endgültig genug vom profilierten Menschenrechtler und radikalen Demokraten Gerhart Baum: Sie wählte ihn nicht mehr zu ihrem Kölner Bundestagskandidaten. Der politische Linksliberalismus hatte in der Kölner FDP nun auch ganz offiziell ausgedient. Selbst ihren in der FDP verbliebenen Parteifreund Gerhart Baum, der mehr politische und menschliche Kompetenz in sich vereinigte als sie alle zusammen, verstießen sie nun.
In den zwölf zurückliegenden Jahren hatte Baum als nahezu einziger in der FDP verbliebener profilierter Linksliberaler – neben eigenständigen Stimmen wie die unvergessene Hildegard Hamm-Brücher, Burkhard Hirsch und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – seine liberalen Positionen weiter im Bundestag vertreten.
1982/83 war fast der gesamte linksliberale Flügel der Kölner FDP, aus dem Baum stammte und der seine Karriere nachdrücklich unterstützt hatte, aus der FDP ausgetreten. Auch die Jungdemokraten waren geschlossen aus der FDP ausgetreten. Bei der legendären Bundestagssitzung, auf der Schmidt abgewählt wurde, sowie auf dem vorhergehenden FDP-Bundesparteitag sprachen Gerhart Baum und die großartige Dame des Liberalismus und 1982 Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Hildegard Hamm-Brücher, für den linksliberalen Flügel in der FDP. Sie gaben denen die Stimme, die nicht bereit waren, die insbesondere von Lambsdorff systematisch voran getriebene Wende mitzumachen.
In dem Fernsehfilm „Der Kanzlersturz – Die Wende von 1982“ ist diese Weg hin zur „Wende“ minutiös nacherzählt worden. Während Baum und Hamm-Brücher in der FDP blieben traten zahlreiche prominente Linksliberale aus der FDP aus. In dem Film „Der Kanzlersturz“ werden mehrere der aus der FDP ausgetretenen Linksliberalen portraitiert, darunter Helga Schuchardt und Ingrid Matthäus-Maier. Ein eindrückliches Zeitdokument.
Ab 1994: Der Menschenrechtsanwalt
Gerhart Baums Karriere nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag im Jahr 1994 sei nur noch knapp skizziert – sie dürfte noch im öffentlichen Bewusstsein verankert sein und wurde ich zahlreichen Nachrufen nachgezeichnet: Von 1992 bis 1998 war Gerhart Baum Leiter der deutschen Delegation bei der UN-Menschenrechtskommission. Er war in verantwortlicher Position bei der UN-Weltkonferenz über Menschenrechte und als UNO-Beauftragter für den Sudan (2001-2003) tätig. In seiner Kindheitsstadt Dresden war er Mitorganisator des Dresden-Preises für internationalen Frieden.
Vor dem Bundesverfassungsgericht setzte er ab 2004, gemeinsam mit seinen politikerfahrenen sozialliberalen FreundInnen und Wegbegleitern Burkhard Hirsch (1930 – 2020) und Sabine Leutheusser-Schnarrenberger – diese hielt am 25.2. in Köln auch die Trauerrede auf Gerhart Baum – , mehrere Verfassungsbeschwerden gegen Bundestagsgesetze durch, weil diese in eklatanter Weise gegen die Menschenwürde und gegen individuelle Freiheitsrechte verstießen (gegen das „Luftsicherheitsgesetz“, das im Fall einer Flugzeugentführung durch Terroristen den militärischen Abschuss erlaubt und damit die Tötung Unschuldiger in Kauf genommen hätte; gegen Teile des sog. „Großen Lauschangriffs“ und den „Staatstrojaner“ sowie gegen eine uneingeschränkte Vorratsdatenspeicherung). Der Staat dürfe nicht alles wissen, das war die Grundhaltung dieser drei Ur-Liberalen.
Außerhalb des Bundestages erreichte Baum mit seinen beiden liberalen Mitstreitern z.T. mehr, als während seiner Tätigkeit als Abgeordneter. Baum wurde in diesen Jahren zu einer der profiliertesten Stimmen für Menschen- und Bürgerrechte. Er intensivierte sein Engagement für die Kulturpolitik und saß in verantwortlicher Position in zahlreichen Kulturinitiativen insbesondere in Köln und NRW.
Der unermüdliche Publizist
„Ganz nebenbei“ war Gerhart Baum ein überaus produktiver Publizist, der zahllose Bücher schrieb: Der Minister und der Terrorist. Gespräche zwischen Gerhart Baum und Horst Mahler (1980), Arche Noah (2000), Unsere Umwelt braucht unsere Hilfe (1982), Deutsche Innenpolitik (1980), Menschenrechtsschutz in der Praxis der Vereinten Nationen (1998), Die Grundrechte im Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit (2009), Rettet die Grundrechte! Bürgerfreiheit contra Sicherheitswahn – Eine Streitschrift (2009), Meine Wut ist jung: Bilanz eines politischen Lebens (2012), Der Baum und der Hirsch. Deutschland von seiner liberalen Seite (2016), Freiheit. Ein Appell (2021); und als letztes Buch, das Werk erschien zu seinem 90.ten: Menschenrechte. Ein Appell (2022).
Von herausragender, überdauernder Bedeutung war die von ihm und seiner Frau Renate 1916 gegründete Gerhart und Renate Baum-Stiftung, die mehrere internationale Menschenrechtspersönlichkeiten auszeichnete: 2016 Women in Exile (eine Initiative geflüchteter Frauen), 2019 Ahmad Mansour, 2021 die belarussische Bürgerrechtlerin Maryja Kalesnikawa, 2022 die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin und Journalistin Katja Petrowskaja und 2024 die Frauenrechtsorganisation Hami Women Empowerment Organisation. Er suchte auch den Austausch und die Unterstützung der russischen Literaturwissenschaftlerin Irina Sherbakowa sowie deren russischer Menschenrechtsgruppe Memorial. „Putin darf nicht siegen!“, rief er dem Publikum mahnend zu. Putins Angriffskrieg sei die schärfste Zäsur im Kampf um eine Werteordnung seit 1945.
Er unterstützte nachdrücklich die Ukraine und Belarus und warnte immer wieder öffentlich vor Putins ungehemmter Aggression gegen die osteuropäischen Unabhängigkeitsbewegungen. Mit seiner Kanzlei sammelte er Beweise und Dokumente, die Putins fortdauernden Kriegsverbrechen belegen und später einmal zu einer strafrechtlichen Verurteilung Putins beitragen sollen. Der Schutz der Ukraine war Gerhart Baums besonderes Anliegen.
Seine Kanzlei erstellte in den letzten Jahren umfangreiche Strafanzeigen gegen die russische Regierung und die militärische Kommandoebene von Putins Russland und warnte nachdrücklich vor dem von Putin ausgehenden Expansionsdrang und seiner Gefährdung des internationalen Friedens: „Es riecht nach Krieg!“ rief er immer wieder in Talkshows.
Die Anzahl seiner Auszeichnungen ist imposant. In seiner Heimatstadt Köln wurde er 2023, gemeinsam mit Melissa Linda Rennings, zum Alternativen Kölner Ehrenbürger ausgezeichnet. Es stellt sich die Frage, warum dies nicht schon viele Jahre früher stattgefunden hat.
2022: Doch noch eine gemeinsame Erinnerung an das mörderische PLO-Attentat in München
Gerhart Baum war ein enger Freund Israels. Eine seiner größten Erfolge erreichte Baum im September 2022, mit knapp 90 Jahren:
Am 5.9.1972 hatten Terroristen der PLO und des „Schwarzen September“ bei den Olympischen Spielen in München in einem mörderische Attentat elf israelische Olympiateilnehmer vor der gesamten Weltgemeinschaft ermordet. Die deutsche Regierung und die deutschen Sicherheitsdienste waren vollständig daran gescheitert, Israelis auf deutschem Boden zu schützen.
50 Jahre später war den Entschädigungsforderungen der israelischen Opferfamilien immer noch nicht entsprochen worden.
Die Verantwortlichen in Deutschland hatten sich über viele Monate als unfähig erwiesen, das Leid der israelischen Opferfamilien anzuerkennen und eine einvernehmliche Vereinbarung für Entschädigungszahlungen und Schuldanerkenntnisse – die ja letztlich nur einen symbolischen Wert haben – zu erreichen. Die israelischen Familien und der israelische Präsident Izchak Herzog hatten daraufhin mitgeteilt, dass sie die deutsche Erinnerungsveranstaltung anlässlich des 50ten Jahrestages der Ermordung der israelischen Spitzensportler durch palästinensische Terroristen boykottieren würden.
Gerhart Baum und seine Kanzlei wurde erst wenige Wochen vor dem 50. Jahrestag beauftragt, die legitimen Interessen der Familien der israelischen Opfer mit seiner Kölner Anwaltskanzler zu vertreten. In letzter Minute erklärte sich die Bundesrepublik nun doch bereit, etwa 28 Millionen Euro „Anerkennungsleistungen“ an die Familien der israelischen Opfer zu zahlen. Weiterhin wurde eine historische Aufarbeitung des deutschen Versagens 1972 durch eine israelisch-deutsche Historikerkommission vereinbart. Und die Bundesrepublik bekannte sich – mit 50-jähriger Verspätung! – zu ihrer Mitverantwortung für ihre damaligen „Versäumnisse und Pannen der überforderten, unvorbereiteten deutschen Sicherheitsorgane“, wie die SZ 2022 schrieb.
Am Ende dieser Verhandlungen sei es „nicht mehr um juristische Fragen“ gegangen, es müsse „eine politische Entscheidung getroffen werden“, forderte Gerhart Baum. Die Bildungsstätte Anne Frank hat das damalige deutsche Versagen nachgezeichnet. Nach der von Baum in letzter Minute erreichten Vereinbarung, die den Forderungen der israelischen Opferfamilien weitgehend entsprach, erklärte Gerhart Baum, dass sich die Präsidenten Izchak Herzog und Steinmeier nun doch in Anwesenheit der Hinterbliebenen der israelischen Opfer zu einer Erinnerungsveranstaltung treffen würden. Die israelischen Familien hätten sich „unter den neuen Umständen“ nun doch „bereit erklärt, an der Feier teilzunehmen.“
In einer von Gerhart Baum ermöglichten gemeinsamen Erklärung von Steinmeier und Herzog erklärten diese: „Mit dieser Einigung bekennt der deutsche Staat seine Verantwortung und erkennt das furchtbare Leid der Ermordeten und ihrer Angehörigen an, dessen wir kommende Woche gedenken wollen.“
23.5.2024: 75 Jahre Grundgesetz: „Wir müssen es verteidigen, wir alle!“
Bundesweit wahrgenommen – und man ahnte, dass dies Gerhart Baums letzte große Rede als Zeitzeuge war – war seine Rede vor dem Deutschen Bundestag am 10.9.2024 zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Dieses war am 23.5.1949 verkündet worden. Gerhart Baum war damals, vier Jahre nach Kriegsende, 16 Jahre alt.
Der 91-Jährige sprach so vital wie immer auch wenn er beim Weg zu der Rednertribüne einen Stock verwendete. Erneut warnte der Urliberale vor der Gefährdung des Grundgesetzes durch ihre Feinde – auch im Bundestag – und er appellierte leidenschaftlich dafür, das Grundgesetz zu verteidigen. Und er äußerte seine Genugtuung darüber, diesen runden Geburtstag als Zeitzeuge und als langjähriger Parlamentarier doch noch erleben zu dürfen. Sein Redetext ist auf der Website des Bundestages veröffentlicht worden.
Der Bundestag sei, ruft der 91-jährige Gerhart Baum seinen ehemaligen KollegInnen zu, „das erste Parlament in der deutschen Geschichte, das sich frei entfalten konnte.“ 75 Jahre Bundestag – so lange etwa habe auch sein eigenes politisches Engagement angedauert: „Ich sehe nun die Bedrohung unserer liberalen Demokratie, ich sehe den Druck autoritärer Kräfte weltweit. Ich habe eine solche Situation (…) noch nicht erlebt.“ Eindeutiger vermag man die Warnung vor der AfD – dass diese gemeint ist weiß jeder im Saal – kaum zu formulieren.
Und er spricht die Debatte um eine eindeutige, auch militärische Unterstützung der Ukraine gegen den Despoten Putin an – ein Land, das die Deutschen gut 80 Jahre zuvor brutal überfallen haben: „Einer meiner Großväter wurde in Charkiw geboren. Ich habe erlebt, wie in den ukrainischen Familien um Söhne getrauert wurde, die für die Befreiung unseres Landes von Hitler ihr Leben geopfert haben. Das sollten wir bedenken, wenn wir heute vor der Frage stehen, ob wir der Ukraine helfen oder nicht.“
Bereits bei der Verabschiedung des Grundgesetzes habe „eine beeindruckende Debatte über das Thema Verjährung stattgefunden. Wir wollten genau wissen, was geschehen ist und wer Verantwortung trug“ – ein Thema, für welches Gerhart Baum, wie in diesen Erinnerungen dargestellt, immer wieder gestritten hat. Diese Erinnerung sei mittels einer „intensiven Erinnerungskultur“ geschafft worden: „Lassen wir nicht zu, dass sie wieder infrage gestellt wird!“ Baums Appell ist nachdrücklich.
Bereits vor 50, 60 Jahren seien sie begeisterte Europäer gewesen. Das sei ein sehr hohes Gut. Gerade heute treffe er immer wieder auf Menschen, die alle Probleme auf einmal gelöst sehen wollten. „Das geht nicht; das ist alles viel schwieriger. Und das müssen wir erklären. Wir müssen erklären, aber wir müssen auch den Wunsch der Menschen respektieren, mitzuwirken.“ Wir hätten heute das unglaubliche Glück, in einer freien Gesellschaft, in Frieden und Wohlstand zu leben. „Wer kann das auf der Welt?“
Und noch einmal spricht Gerhart Baum, unter Verweis auf seine eigenen Lebenserfahrungen, die unmittelbare Bedrohung der Demokratie an: „Ja, ich bin ein alter Mann, dem mitunter vorgeworfen wird, die Lage zu dramatisieren. Meine Damen und Herren, ich will einfach nur erreichen, dass man die Gefährdungen sieht“ ruft er unter großem Beifall des Parlaments. Man müsse die Gefahren erkennen, um sie bekämpfen zu können. „Ich bin nicht ohne Hoffnung, nicht ohne berechtigte Hoffnung.“
Stéphane Hessel, dessen Familie unter den Nazis „bitter gelitten“ habe, habe am Ende seines Lebens ein Buch mit dem zu Handlungen, zum Kampf auffordernden Titel „Empört Euch!“ veröffentlicht. Ja, dieser Appel sei „heute aktueller als damals noch“, und zwar „nicht als Anklage, sondern als Aufforderung zum Handeln.“
Kurz nach seiner bemerkenswerten Erinnerungsrede wird Baum vom WDR zu seiner Rede interviewt; „Wir haben die beste Verfassung, die die Deutschen je hatten.“ Sie sei konzentriert auf die Menschenwürde, „in unserer Gesellschaft untereinander und in Bezug auf den Staat.“ Ja, diese Verfassung müssten „wir jetzt verteidigen. Sie ist in Gefahr durch Freiheitsfeinde, auch durch die Gleichgültigen, die sie nicht verteidigen.“ Feiern und verteidigen „muss jetzt zusammengehen.“
Auch bei einer letzten großen Rede ist der radikale Liberale Gerhart Baum von einer beeindruckenden Vitalität. Auch hierbei habe ich eine große Nähe zu ihm empfunden. Was für ein toller, leidenschaftlicher Demokrat und Menschenfreund! In jenen Tagen baten ihn jüdische Freunde, denen auch ich empfohlen hatte, Gerhart Baum anzusprechen, um eine konkrete Unterstützung für eine aus dem Libanon stammende Flüchtlingsfamile. Baum lehnte diese Unterstützung erstmals, mit großem Bedauern, ab: Er sei zu alt hierfür, leider.
Die filmische Biografie zu Baums 80.tem: „Wir wollten die Republik verändern“
Zu Gerhart Baums 80.tem Geburtstag wurde der eindrückliche politisch-biografische Dokumentarfilm „Wir wollten die Republik verändern – der Liberale Gerhart Baum“ (2013) abgeschlossen. Er wurde in Baums Heimatstadt Köln mehrfach, zuletzt zu seinem 90.ten Geburtstag, in seiner Anwesenheit gezeigt. Der Beifall fand danach kein Ende mehr.
In diesem bemerkenswerten filmischen Portrait gibt es eine Szene, in der Gerhart Baum als Redner in einem Wagen zu einer Gegenkundgebung gegen die jährlichen, geschichtsrevisionistischen Neonazimärsche Mitte Februar in seiner Kindheitsstadt Dresden gefahren wird: Ja, das sei das Wesen der Demokratie, dass auch deren gefährlichsten Feinde marschieren dürften. Das müssten wir als Demokraten hinnehmen, hob Baum in dieser Szene hervor. Aber wir hätten die Pflicht, dagegen aufzustehen, dagegen zu protestieren. Deshalb reise er nun nach Dresden. Die Bilder der Luftangriffe, der Bombardierungen Dresdens ab August 1944, der bis zu 25.000 Toten, seien in ihm weiterhin höchst präsent, lebendig. Aber diese zahllosen Toten seien die Folge der deutschen Verbrechen gewesen. Die Verantwortung liege bei den Deutschen selbst.
In dem Film erzählt Baum viel über seine ihn prägende Kindheit in Dresden: Seine russischstämmige Mutter – ihr Mann, Gerhart Baums Vater Rudolf, ein Rechtsanwalt, war aus der russischen Kriegsgefangenschaft nicht mehr zurückgekehrt – floh im Februar 1945, als die Alliierten Luftangriffe gegen Dresden ihren Höhepunkt erreichten, mit Gerhart und seinen sechsjährigen Zwillingsgeschwistern zum Tegernsee. Der sieben Jahre ältere Gerhart musste hierdurch früh quasi eine Elternrolle übernehmen. Sie seien mit drei Koffern nach Tegernsee geflohen, hätten gehungert. Er sei mit heißen Ziegelsteinen ins Bett gegangen, einmal seien ihm dennoch seine Fußzehen erfroren.
Er habe früh Verantwortung insbesondere für seine sieben Jahre jüngeren Geschwister übernehmen müssen. Eigenverantwortung sei ein Lebensthema für ihn. Im Film sehen wir Kindheitsbriefe, in denen er über seine schwierige Lebenssituation, seine Sehnsüchte schreibt. Er habe sich als Schüler, unmittelbar nach der Nazizeit, auch gegen Nazilehrer zur Wehr setzen müssen.
Als Baum sich ab Ende der 1950er Jahre in NRW in der FDP engagierte sei dies durchaus problematisch gewesen: Es gab für ihn nur drei Parteien: Die CDU sei sehr katholisch gewesen, die SPD teils noch marxistisch. Für ihn blieb nur die FDP, trotz aller inhaltlichen Differenzen. Sein Parteifreund Günter Verheugen – der nach dem Koalitionsbruch 1982 zur SPD übertrat und dort seine Karriere gradlinig fortsetzte – beschreibt im Film ihre problematische Situation, als überzeugte Linksliberale und Jungdemokraten in eine Partei einzutreten „mit der man in nahezu nichts übereinstimmt.“
Als zentrales politisches Thema beschreibt Baum im Film die Ostpolitik sowie die Debatte über die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie. Der FDP als einziger Oppositionspartei sei es nach 1968 deshalb leichter gefallen, Kontakte zur Apo herzustellen und zu gestalten. „Ihr könnt in den Parteien die Gesellschaft verändern“, war Gerhart Baums Grundüberzeugung, die er in jenen Jahren als Jungdemokrat und als Kölner FDP-Stadtratsmitglied (1969-1973) leidenschaftlich vertrat. Er überzeugte viele Linksliberale, sich der Kölner FDP anzuschließen. Und er arbeitete maßgeblich an den Freiburger Thesen (1971) mit. Das Thema der Verteilungsgerechtigkeit spielte für ihn, der zeitgleich als Jurist für den Arbeitgeberverband arbeitete, eine zentrale Rolle. Ende der 1960er Jahre habe die FDP das Motto „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ vertreten – das sei heute nahezu unvorstellbar, so Baum.
Hans-Dietrich Genscher erkannte das außergewöhnliche Talent des jungen Kölner FDPlers – und holte ihn, zuerst als Staatssekretär und dann als Bundesinnenminister (1978-1982) in die Bundesregierung. Das zentrale Thema jener Jahre war der deutsche Terrorismus. Dieser brachte insbesondere auch für Gerhart Baums Familie und für ihn selbst – Baum schien dies innerlich nicht zu berühren – eine außerordentliche persönliche Gefährdung mit sich. Er, der seinerzeit in Köln-Nippes an der vielbefahrenen Inneren Kanalstrasse wohnte, was in Köln allgemein bekannt war, konnte nur noch mit permanentem Personenschutz auftreten. Seine Tochter Julia Baum erinnert sich im Film an die permanente Bewachung, die sich begleitenden Sicherheitsbeamten: „Das war ja Alltag dass die Sicherheitsleute immer dabei waren.“ Und sie erinnert Baum an die Auseinandersetzung über das von Baum vertretene liberale Sicherheitskonzept, deren Folgewirkungen sie als Schülerin über die Eltern ihrer Mitschüler sowie dann über diese selbst erleben musste: „Ich hab die Schule gewechselt. Das weißt Du“ doch, erinnert sie ihren Vater an die Härten, die sie als Tochter eines prominenten Ministers erleben musste. Im März 1974 überlebte sie gemeinsam mit ihrem Vater nur dank des beherzten Eingreifens Anderer ein furchtbares Hubschrauberunglück.
Gerhart Baum ließ selbst als Bundesinnenminister (1978 – 1982) den Dialog mit dem – potentiell dialogbereiten – RAF-Umfeld nicht abreißen. Für bundesweites Aufsehen sorgte 1980 das vom Liberalen Zentrum Köln – Der linksliberale Kölner LZ-Mitbegründer und zeitweilige Kölner FDP-Vorsitzende Michael Kleff war zugleich Baums persönlicher Referent – veranstaltete Podiumsgespräch mit dem wegen terroristischer Delikte verurteilten ehemaligen RAF-Anwalt Horst Mahler, Gerhart Baum, Prof. Ulrich Klug und dem Journalisten Stefan Aust.
Gerhart Baum wollte hiermit, wie der dem Spiegel (53/1979) schon einige Monate vorher mitteilte, die gesellschaftliche Sprachlosigkeit überwinden und diejenigen erreichen, »die glauben oder geglaubt haben, den Staat mit Gewalt verändern zu können«. Mahler, der Jahrzehnte einer der radikalsten rechtsradikalen und bekennenden Antisemiten werden sollte, wende sich an jene, die »noch zu vermitteln, zu verstehen« suchten. „Wir brauchen mehr Gelassenheit“ forderte Baum inmitten der aufgeheizten Stimmung der damaligen RAF-Jahre.
Die legendäre LZ-Podiumsdiskussion mit dem Bundesinnenminister Baum und Mahler – „Politische Perspektiven – Baum im Gespräch mit Mahler“ fand am 28.8.1980 statt; ich habe noch vereinzelte Erinnerungen an diese Diskussion, an der ich 18-jährig teilnahm.
Acht Jahre später, am 19.11.1987, setzten das Liberale Zentrum und Gerhart Baum diesen Dialogversuch mit der Kölner Podiumsdiskussion „10 Jahre danach – die RAF und ihre Folgen“ mit Baum, Antje Vollmer, Aust sowie dem ehemaligen RAF-ler Klaus Jünschke fort. Das LZ Köln erstellte hierzu eine eigene 36-seitige Broschüre, in der sie die Diskussionsbeiträge verschriftlicht worden sind; diese ist nun wieder auf der von Klaus Trapp und Axel Lange erstellten und gepflegten Seite des Liberalen Zentrums Köln (LZ-Köln) abrufbar. Jünschke hatte zuvor 15 Jahre in Haft gesessen.
Baum wurde zum Hassobjekt großer Teile „der Rechten“, wie im Film in dichter Weise erinnert wird: Wir sehen einen Franz-Josef Strauß, der sich mit hochrotem Kopf über den „Herrn Bundesminister Baum“ empört und diesen als die größte Bedrohung für die Bundesrepublik erlebt: „Hier stehen Welten zwischen uns!“ „Herr Baum“ sei „das Idol der Linken“, schleudert Strauß Bundeskanzler Schmidt entgegen. Schmidt reagiert mit der ihm eigenen Coolnes und lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass er zu dem Linksliberalen Baum als Mitglied seiner Bundesregierung steht.
Dann die filmischen Szenen beim von der FDP-Mehrheit bewusst herbei geführten Koalitionswechsel von Schmidt hin zu Kohl. Die große Dame des Liberalismus, Hildegard Hamm-Brücher sowie Gerhart Baum lehnen den kalkulierten Koalitionsbruch auf dem FDP-Bundesparteitag sowie im Bundestag ab – und doch bleiben beide, im Unterschied zu der ganz großen Mehrheit der Linksliberalen, in der FDP. „Deshalb können wir Sie, Herr Kohl nicht zum Bundeskanzler wählen“ ruft Baum als Sprecher der FDP-Linken. Baum lehnte jedoch in dieser besonders für ihn selbst höchst schwierigen Situation, dies wurde wohl nie öffentlich so richtig bekannt, das taktische Angebot Kohls ab, nun auch in seinem Kabinett Bundesjustizminister zu werden. Es begannen die Jahre einer inneren Einsamkeit, so denke ich, in denen er als nahezu einziger Linksliberaler in der FDP blieb, während nahezu sein gesamtes Kölner und bundesweites linksliberales Umfeld, einschließlich des Großteils des Liberalen Zentrum Kölns, die FDP verließ. „Ich habe mir auch was vorgemacht. Ich habe mir die FDP-Welt schöngeredet“ erinnert er sich im Rückblick in seinem Film. Was damals passiert sei habe „die FDP hässlich gemacht“, so Baum.
Zwölf Jahre später zeigte die FDP ihre besondere Dankbarkeit: 1996 schickte sie ihn, der „dennoch“ als prominenter Linksliberaler in der FDP geblieben war, nicht mehr in den Bundestag. Sie glaubte auf ihn verzichten zu können.
Hildegard Hamm-Brücher und Gerhart Baum
Selbst als sechs Jahre später, im September 2002, die 81-jährige Grand Dame des Liberalismus, Hildegard Hamm-Bücher, aus Empörung über Möllemanns fortgesetzten, kalkulierten antisemitischen Ausfälle gegen den jüdischen Funktionär Michel Friedmann sowie gegen den israelischen Ministerpräsidenten Sharon aus der FDP austrat – später sprach sie von einer „wechselseitigen Entfremdung“ – blieb Gerhart Baum, die treue Seele, in der FDP.
Die 1921 geborene Hildegard Hamm-Brücher hatte erlebt, wie sich ihre jüdische Großmutter, bei der sie mit ihren Geschwistern (ihre Eltern waren bereits 1931 und 1933 verstorben) in Dresden lebte, 1942, unmittelbar vor deren Deportation von Dresden nach Theresienstadt, das Leben nahm. Auch ihr selbst wollte man anfangs aus rassistischen Gründen keine Studienerlaubnis der Chemie geben. 1962 gelang der 41-jährigen Hamm-Brücher der Wiedereinzug in den Bayrischen Landtag, obwohl ihr eigener (wie es in einem Fernsehportrait heißt: „vertrottelter“) FDP-Landesverband dies zu verhindern versuchte, indem er sie nur auf den aussichtslosen 17. Platz ihrer Wahlliste stellte. Es entstand in Bayern spontan ein großes überparteiischen Komitees, das den Wiedereinzug der 41-jährigen großen Liberalen in den bayrischen Landtag mittels einer Besonderheit des bayrischen Wahlsystems (Vergabe seiner Stimme an eine einzelne Kandidatin) doch noch zu erreichen vermochte. Die überparteiische Initiative war erfolgreich: Sie überflügelte bei der Landtagswahl alle FDP-Parteifreund und landete auf Platz eins, wie es in diesem Fernsehportrait nacherzählt wird.
Hildegard Hamm-Brücher, so sei nachgetragen, gehörte sechs Jahre dem Stadtrat von München, 22 Jahre dem bayrischen Landtag und 14 Jahre lang – bis 1990 – dem Deutschen Bundestag an. 1994 war sie auf Vorschlag der FDP Kandidatin für das Amt des Bundespräsidenten. Bei der Wahl erhielt sie zweimal deutlich mehr Stimmen als die FDP hatte. 2010, acht Jahre nach ihrem Austritt aus der FDP wegen Möllemanns antisemitischen Agierens (der wenig später in seinem Fallschirmsprung ein Ende fand), wurde sie von den hessischen Grünen als Wahlfrau für die 14. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten gewählt. In einem taz-Interview des Jahres 1994 stellte sie auch dar, warum sie 1982, wie Gerhart Baum, der Versuchung zum Austritt aus der FDP widerstanden hatte: „Ein Eklat, ein Austritt aus der Partei, hätte gar nichts gebracht. Jemand, der austritt, ist eben weg vom Fenster. Und ich habe durchhalten wollen, ich habe auch 1982 vielen Leuten den Gefallen nicht tun wollen, auszutreten … Das hat auch mit meiner emotionalen Bindung an die Liberalen zu tun, mit Theodor Heuss als dem großen politischen Vorbild meiner ersten „Entpuppungsphase“ im doppelten Sinne: die junge Frau als Puppe und der Schmetterling, der aus der Puppe heraus muß. In eine andere Partei wollte ich nicht …“
Und sie formulierte – als FDP-Mitglied – ihre Bewunderung für den frischen Wind, den der erstmalige Einzug der Grünen und insbesondere der Grünen Frauen in den Bundestag im Jahr 1983 in ihr hervor rief: „Ich habe die Grünen von Anfang an als eine Wohltat empfunden: daß diese starre parlamentarische Ordnung einmal durcheinandergebracht wurde! 1969 oder 70 hat der parlamentarische Präsident noch eine Kollegin aus dem Parlament geschickt, weil sie einen Hosenanzug trug, übrigens mit einer Jacke bis übers Knie … da waren die Grünen mit ihrer Mischung aus Provokation und Unbefangenheit wichtig und gut. Und die Frauen waren klasse: Waltraud Schoppe, die gleich erst mal alle aus dem Nähkästchen geschmissen hat mit ihrer legendären Rede, Antje Vollmer, Christa Nickels … Rainer Barzel, der damalige Bundespräsident, hat zum Ärger seiner Partei das außerdem sehr tolerant und souverän gehandhabt.“
Sehr besorgt zeigte sie sich auch in diesem Interview über die Gefahr des Rechtsradikalismus und des Antisemitismus: „Was mich besorgt – und zwar nicht bis zur Alarmstufe 1, aber doch kurz davor –, ist die Infektionsgefahr ins konservative Lager hinein. Alle Vorformen des Rechtsradikalismus – diese übertrieben nationalistischen Töne, die Überheblichkeit unserer „Vormachtstellung“, die Distanz zu anderen Rassen und die oft mangelnde Sensibilität – sind wirklich besorgniserregend.“
Ich bin mir sehr sicher, dass Gerhart Baum alle Äußerungen dieser großen liberalen Frau mit äußerster Zustimmung verfolgt hat – auch nach Hamm-Brüchers Austritt aus der FDP. Gerhart Baum, der Treue, der seit einigen Jahren kein offizielles Parteiamt innerhalb der FDP mehr inne hatte, blieb in „seiner“ FDP: Es brauche eine liberale Kraft in der Demokratie, betonte er immer wieder. „Ich habe Bereiche des Lebens vernachlässigt“ sagt Baum im Rückblick im Film. Seine politische Karriere sowie die Bedrohung durch den deutschen Terrorismus habe sein Familienleben und seine Freundschaften stark beeinträchtigt. Dennoch sei es „die Sache wert“ gewesen.
Eine neue Edelweißpiraten-Initiative dankt Gerhart Baum (2025)
Es gab zwei Kölner Nachrufe auf Gerhart Baum, die ich vorstellen möchte: Die neuere Initiative Nippeser Edelweißpiraten, bei der Baum und Finkelgruen noch im Mai 2023 zu einer Diskussionsveranstaltungen an „seinem“ Leonardo-da-Vinci-Gymnasium, auftraten, um die Einweihung eines Nippeser Edelweißpiratendenkmals am unmittelbar davor gelegenen örtlichen Leipziger Platz zu unterstützen, schreibt in einem Nachruf: Der Kölner Gerhart Baum sei „einer der letzten großen Liberalen, die sich konsequent für Demokratie, Menschenrechte und soziale Grundrechte einsetzten.“ Sein Erleben der Nazizeit habe ihn vermutlich auch dazu führte, „dass er sich später für die Jugendlichen einsetzte, die sich in der Nazizeit widersetzt hatten und dafür lange als Kriminelle angesehen wurden.“
Gemeinsam mit Peter Finkelgruen habe „er sich für die Edelweißpiraten und ihre Anerkennung als widerständige Menschen eingesetzt.“ Sie heben besonders seinen Einsatz als Rechtsanwalt für die sowjetischen Zwangsarbeiter der NS-Zeit hervor, mit der sich der unermüdliche Menschenrechtsaktivist Baum „gegen die damals ablehnende Haltung der Bundesregierung“ eingesetzt habe. Baums Appell, sich gegen die „Vernichtung demokratischer Strukturen in der Welt“ einzusetzen sowie für „Menschenrechte, Frieden und Freiheit zu kämpfen“ sei insbesondere nach der wenige Tage alten Rede des US-Vizepräsidenten auf der Münchener Sicherheitskonferenz „aktueller denn je“, so Heinrich Bleicher für den Vorstand der Initiative.
Das Liberale Zentrum Kölns
Das 1978 mit maßgeblicher Unterstützung Gerhart Baums sowie Ulrich Klugs gegründete Liberale Zentrum Köln versichert in einem Brief an Baums Ehefrau Liesmann-Baum ihr ihre gemeinsame Trauer und ihre Dankbarkeit für Baums treue Unterstützung als ein „Liberaler mit Weitsicht, Mut und Integrität.“ Seine „Stimme für die Freiheit und eine demokratische Gesellschaft“ habe Gerhart Baum „bis zum Schluss in die politische und kulturellen Diskussion“ eingebracht.
Bereits bei der Programmgestaltung des Liberalen Zentrum Kölns im Jahr 1978 habe Baum „stets seine politische und kulturelle Überzeugung und auch sein Amt“ mit eingebracht. Sein „aktives Mitwirken bei vielen Veranstaltungen“ habe „das Bild des LZ mitgeprägt.“ Ebenfalls blieben „die vielen informellen Begegnungen in unseren Köpfen und Herzen erhalten.“ Die vielfältigen, auf der LZ-Website festgehaltenen politischen und kulturellen Aussagen des Liberalen Zentrums seien – wie ich als junger Besucher des LZ bis heute gut erinnere – immer auch mit einem „Lebensgefühl“ einhergegangen, „das die damaligen Mitglieder und der heutige Freundeskreis mit Gerhart Baum verbunden hat. Für das LZ-Köln ist und bleibt Gerhart Baum unvergessen.“
„Unvergesslich“ sei die Veranstaltung „Der Minister und der Terrorist“ im Jahr 1980 mit Baum als Bundesinnenminister, Rudolf Augstein, Prof. Dr. Ulrich Klug (Strafrechtler, Justizsenator a.D.) und Horst Mahler (Anwalt, Ex-Terrorist): „Sie ging durch die ganze Bundesrepublik, wurde Thema in Radio, Fernsehen, den Zeitungen und selbst im Bundestag. Es gehörte damals sehr viel politischer Mut dazu, die Sprachlosigkeit zwischen der Terrorszene und der Gesellschaft zu durchbrechen, insbesondere für ihn als amtierender Bundesminister des Inneren!“
Es gelte auch heute, „die vielfach zu beobachtende Sprachlosigkeit in der Gesellschaft zu überwinden, für Freiheit und eine demokratischen Gesellschaft durch einen offenen Diskurs einzutreten. Dieses Anliegen verband Gerhart Baum eng mit dem Liberalen Zentrum Köln.
Wir trauern mit Ihnen und werden Gerhart Baum nicht vergessen. Sein Wirken wird uns Vorbild bleiben. In enger Verbundenheit
Axel Lange für der Freundeskreis des Liberalen Zentrums Köln“.
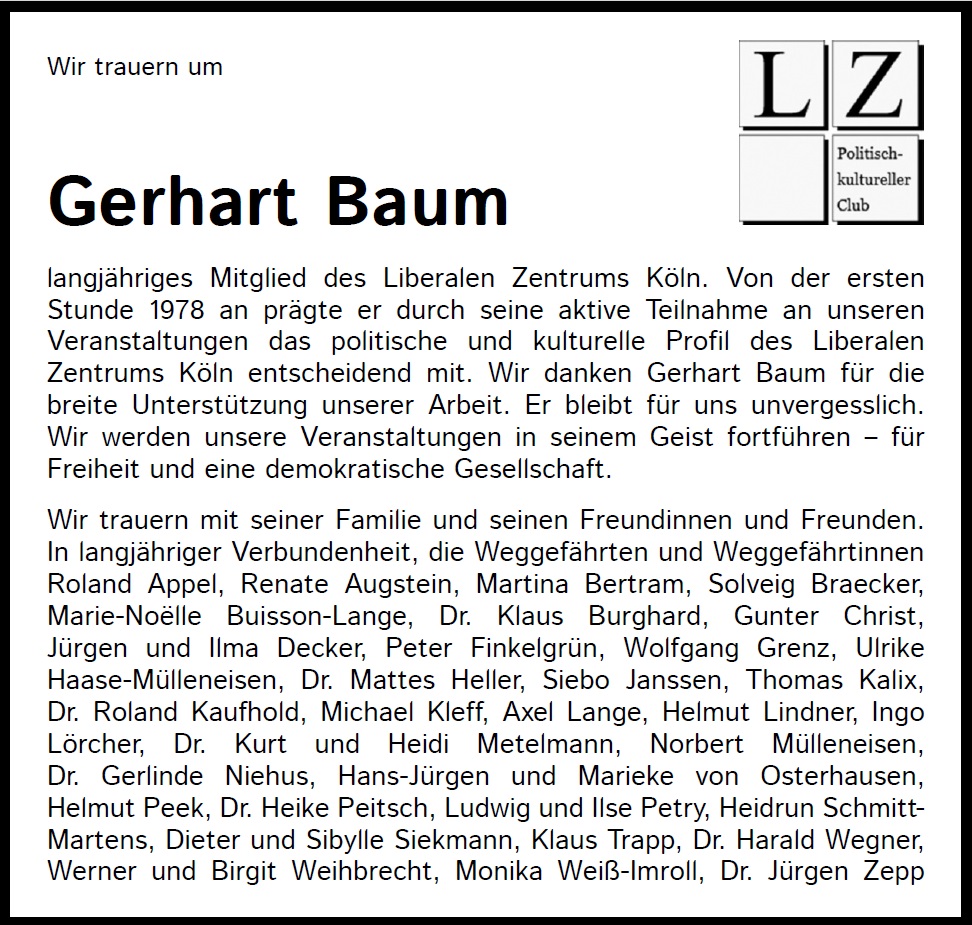
Gerhart Baum, der persönlich und familiär über Jahrzehnte und sehr konkret durch die RAF und deren Umfeld bedroht war, kannte diese linksradikale Szene sehr genau, wie auch diese Interviewpassage veranschaulicht. Es war mir eine Freude und Ehre, diesen Nachruf des Liberalen Zentrums Köln an unseren Freund, selbstlosen treuen Unterstützer und Wegbegleiter mit unterzeichnen zu dürfen.
Ein Epilog
Am Sonntag nach dem Tod unseres Freundes Gerhart Baum war ich bei dem sonntäglichen Kölner „run“ für die sofortige Freilassung der israelischen Geiseln. Zwischen 25 und 60 Kölner treffen sich zu diesem international organisierten Lauf. Ich bin mir sehr sicher, dass dieser „run“ für die israelischen Geiseln ganz im Sinne Gerhart Baums ist:
Über Jahrzehnte, schon als Bundesinnenminister und als regelmäßiger Besucher der von 1982 – 1988 von seinem Freund Peter Finkelgruen in Jerusalem geleiteten Friedrich Naumann Stiftung nahm er am Schicksal Israels intensiv teil. Als Peters Frau Gertrud im März 2021 verstarb waren wir gemeinsam auf der Trauerfeier. Zwischendurch kamen wir kurz auf die damalige sehr angespannte Situation in Israel zu sprechen. Baum erinnerte jedes historische Detail der frühen Überlebenskriege Israels.
Der Run versammelte sich diesmal am Rheinufer der Kölner Innenstadt. Der Kölner jüdische Karnevalsverein Kippa Köpp feierte ihr Karnevalsfest. Auch mehrere Teilnehmer des Marsches um die Veranstaltungsleiterin Miriam waren dort, um in der Pause den 18-minütigen Run durchzuführen.
Auch die Kölner Stadträtin Stefanie Ruffen war dabei. Sie stand als Kölnerin Gerhart Baum immer sehr nahe. Immer wieder habe er sie davon überzeugt, bei allen Rückschlägen, dass wir eine liberale Partei bräuchten. Gemeinsam spürten wir den Verlust, den der Tod dieses letzten großen Linksliberalen und überzeugten Verteidiger der Demokratie und der Menschenrechte für uns alle darstellt.
Gerhart Baum fehlt – auch mir – sehr. Gerhart Baum war im persönlichen Kontakt aufmerksam, sehr liebenswürdig, unterstützend, nachfragend.
Es bleibt als großer Trost die innere Zufriedenheit darüber, mit einem solchen engagierten Demokraten und Streiter für Vielfalt und Toleranz verbunden gewesen zu sein. Diese Verbundenheit und Dankbarkeit bleibt.
Literatur zum Thema:
Roland Appel & Michael Kleff (Hrsg.): Grundrechte verwirklichen – Freiheit erkämpfen. 100 Jahre Jungdemokrat*innen: ein Lesebuch über linksliberale und radikaldemokratische Politik von Weimar bis ins 21. Jahrhundert 1919-2019. Academia Verlag, Baden-Baden.
Peter Finkelgruen (2020): „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944. Herausgegeben von Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Engelhart, BoD 2020, S. 209-2016, https://www.bod.de/buchshop/soweit-er-jude-war-peter-finkelgruen-9783751907415; Roland Kaufhold (2020): Die „Kölner Kontroverse“? Bücher über die Edelweißpiraten. Eine Chronologie. In Finkelgruen (2020), S. 217-342.
Roland Kaufhold (2022): „Mich erfüllte ein Gefühl von Stolz. Ich hatte es geschafft.“ Peter Finkelgruen: Ein halbes Jahrhundert Leben als Jude in Deutschland. Mit einem Vorwort von Peter Finkelgruen, BoD 2022, 244 S., ISBN 3756819205.
Vorwort von Gerhart Baum (2019) sowie Vorwort von Gerhart Baum (1981). In: Peter Finkelgruen (2020): „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln 1944, Hrsg. v. Roland Kaufhold, Andrea Livnat und Nadine Englhart, BoD, ISBN-13: 9783752812367
Roland Kaufhold (2020): Die „Kölner Kontroverse“? Bücher über die Edelweißpiraten. Eine Chronologie. In: Finkelgruen (2020), S. 217-342. (BoD. ISBN-13: 9783751907415).




