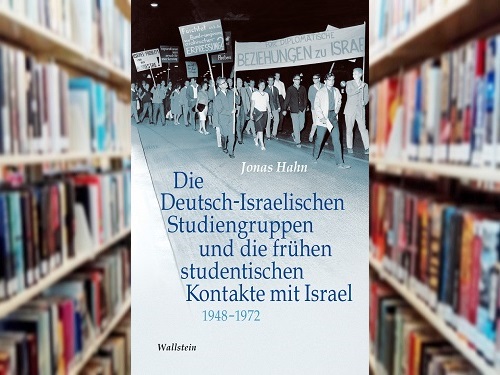Eine Studie über die Deutsch-Israelischen Studiengruppen und die frühen studentischen Kontakte mit Israel 1948-1972
Von Roland Kaufhold
Im August 1956 reiste Eva Beling, eine junge deutsche Studentin, nach Israel. Sie wollte sich zur Fortführung ihres Studiums an der Hebräischen Universität Jerusalem immatrikulieren. Das erregte in Israel großes Aufsehen, existierten doch, elf Jahre nach Ende der Nazizeit, keinerlei Beziehung zwischen Israel und dem Land der Mörder. Sogar die israelische Tageszeitung Ma´ariv berichtete seinerzeit, dass „eine deutsche Studentin für das nächste Studienjahr an der Hebräischen Universität Jerusalem angenommen worden sei.“ (S. 56) Immerhin, so wurde hinzugefügt, stamme die deutsche Studentin aus einer antifaschistischen Familie. Ihr Vater, ein Lehrer, sei „1933 von den Nationalsozialisten wegen seiner Ansichten aus dem Unterricht entfernt worden“ und habe auf Bitten der jüdischen Gemeinde eine jüdische Berufsschule geleitet. (ebd.)
Bereits zwei Jahre zuvor war die junge Frau gemeinsam mit ihrer Schwester per Anhalter mehrere Wochen lang durch Israel gereist, worüber gleichfalls mehrere israelische Tageszeitungen berichteten. Vor allem wollten die deutschen Frauen etwas über das Leben im Kibbuz erfahren.
Von solchen seltenen Begegnungen zwischen deutschen Studenten und Israelis in den 1950er und Anfang der 1960er Jahre gibt es in dem von Jonas Hahn verfassten Band über Die Deutsch-Israelischen Studiengruppen und die frühen studentischen Kontakte mit Israel 1948-1972 zahlreiche Beispiele. Betreut wurde das Dissertationsprojekt Hahns durch Michael Brenner. Hahn arbeitet als Referent für Jugendaustausch bei ConAct.
Die Gründung Deutsch-Israelischer Studiengruppen
Der Autor hat eine außergewöhnlich gründliche, solide recherchierte, detailreiche Studie über ein Thema vorgelegt, über das nur wenig bekannt ist. Hahn rekonstruiert auf Grundlage sorgfältiger Archivstudien die wenigen, „zaghaften“ persönlichen Kontakte, die es nach der Shoah zwischen Deutschen und Israelis gab. Bis zur offiziellen Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Israel im Jahr 1965 erregten solche Kontakte nahezu durchgehend Aufsehen, vor allem in Israel, und sie riefen häufig auch große Wut hervor, insbesondere bei eher „rechten“ Gruppierungen in Israel wie der oppositionellen Cherut Partei (vgl. Boord 2001). Erinnert sei daran, dass seinerzeit in israelischen Reisepässen stand, dieser Pass sei für „alle Länder der Welt gültig außer Deutschland“. Mit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen im Jahr 1965 verstetigten sich die Kontakte und gelegentlichen Besuche von Deutschen in Israel. Die Deutsch-Israelischen Studiengruppen verloren hierdurch schrittweise ihr Alleinstellungsmerkmal und auch ihre Funktion, so dass sie sich wenige Jahre später auflösten. Auch dieser Auflösungsprozess wird von Hahn im Detail nachgezeichnet.
In seiner wissenschaftlich angelegten Studie schreibt Hahn über israelische Studenten in der frühen Bundesrepublik (so über Jochanan Bloch); über die Suezkrise und die Proteste arabischer Studierender in Deutschland gegen Kontakte mit Israel – auch diese Propaganda der Ausgrenzung des demokratischen Israel durch arabische Aktivisten gab es bereits vor 70 Jahren. Er zeichnet detailreich die Gründung mehrerer Deutsch-Israelischer Studiengruppen an westdeutschen Universitäten nach und beleuchtet die divergierenden Motive der deutschen Protagonisten. Manche hatten theologische Interessen. Viele von ihnen verstanden sich eher als „links“ und verbanden ihr Interesse an Israel mit einem Engagement für eine „Aufarbeitung“ der tabuisierten deutschen Verbrechen. Viele interessierten sich auch für die Kibbuzerziehung und reisten nach Israel, um teils mehrere Monate dort zu arbeiten (S. 160-172). Durch diesen Prozess steigerte sich auch die Bereitschaft einiger linker Kibbuzim, sich für junge, nach 1945 geborene Deutsche zu öffnen. Einige der Kibbuzim waren durch deutsch sprechende jüdische Überlebende aufgebaut worden, die teils viele Familienangehörigen in der Shoah „verloren“ hatten.
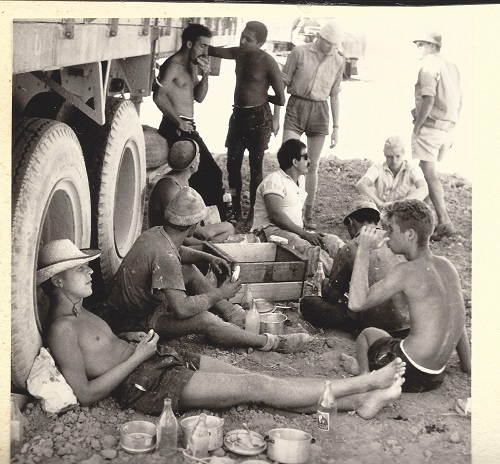
Es folgen im Buch zahlreiche Detailstudien, etwa über „die Schmierwelle 1959/60 und die Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus“, über den Politisierungsprozess beim SDS (wozu es ausreichend Literatur gibt)[i]; Portraits zweier von den Studiengruppen herausgegebener Zeitschriften und Portraits mehrerer Protagonisten dieser Studentengruppen (Heinz Wewer, Reinhard Strecker und Ansgar Skriver. Weiterhin von Wolfgang Koppel und Gerhard Schoenberner, die keine Mitglieder der Studiengruppen waren). Weiter analysiert Hahn mehrere NS-Prozesse der 1950er und 1960er Jahre – „Worauf warten wir?“ – ; sowie Ausführungen über die ersten Forderungen nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Israel.
Immer wieder geht es im Buch, so im Unterkapitel „Vom Philosemitismus und der Kritik daran“ (S. 100-111), um die Debatten, Diskurse und Interpretationen um den Philosemitismus und um dessen Kehrseite, den Antisemitismus. Der Antisemitismus wurde nach der Nazizeit scheinbar oder vorgeblich „geächtet“. Zumindest unterlag er einem Tabu, lebte aber selbstverständlich unterschwellig und subtil weiter – bis heute. Heute dürfte er, spätestens seit dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 (vgl. Oz-Salzberger (2024) sowie Kaufhold (2024b); Illouz 2025 sowie Kaufhold 2025b) eine noch stärkere und unverschleierte Intensität haben als vor 50 Jahren.
Auch in der Studiengruppe wurde dies früh diskutiert. Der Theologe Helmut Gollwitzer (1908 – 1993) machte im Mai 1958, anlässlich des 10. Geburtstages des Staates Israel, in einer Festrede deutlich, dass es für an Israel Interessierte keineswegs darum gehen könne und solle, „an die Stelle des blinden Antisemitismus einen ebenso blinden Philosemitismus zu setzen“ (S. 105) Das Bewusstsein für die eigentlich offenkundige Problematik eines ostentativen Philosemitismus war also durchaus früh vorhanden – zumindest in kleinen, an Israel interessierten Kreisen. Der Philosemitismus, der vorgeblich eine Solidarität mit Israel darstellt bzw. behauptet und dem wir heute wohl in noch massiverer Form als früher begegnen, ist mehr Elend, Geschichtsleugnung und häufig sehrmehr rechte Ideologie als es uns lieb und akzeptabel sein sollte. Ihn politisch und psychologisch zu verstehen erscheint mir als eine notwendige Herausforderung, um uns und Israel vor falschen, vorgeblichen deutschen „Freunden“ zu bewahren. Der Publizist Michael Wuliger (2020) hat diese berechtigte Skepsis gegenüber dem Philosemitismus in einem seiner satirischen Essays entfaltet. Oliver Vrankovic, der seit 20 Jahren in Israel lebt und mit Shoahüberlebenden arbeitet, hat dies in seinen zahlreichen Vorträgen (Vrankovic 2023) eindrücklich dargestellt.
Viel Neues enthält das Buchkapitel über die „Nationalunion Israelischer Studenten und die Kontakte mit deutschen Studierendenverbände“ (219-228).
Der Abschluss des anregungsreichen Buches handelt von der Debatte über eine „kritische Solidarität“ mit Israel nach dem Sechstagekrieg (s.u.) sowie über die „Dialog-Gruppen in Tel Aviv und Jerusalem 1967-1972“: Insbesondere Israelis, die gegen massive innere Widerstände „dennoch“ in Deutschland studierten, wie der erwähnte, im Buch ausführlicher portraitierte Jochanan Bloch, waren enttäuscht über den ab 1967 im SDS massiv aufbrechenden „Antizionismus“, der dieser bereits früh als Antisemitismus wahrnahm. Mehrfach wurde Bloch bereits 1969 an der Tübinger Universität mit der „geballten antisemitischen Stimmung“ (S. 274) in Teilen der linken Studenten konfrontiert und bei eigenen Vorträgen von linken Aktivisten massiv gestört und unterbrochen. Frustriert und desillusioniert verließ Bloch daraufhin mit seinen wenigen Freunden der Tübinger Studiengruppe den Vortragssaal.
Beziehungen nach Köln: Die Israel-Mission
Mehrfach Bezug genommen wird in dem Buch auf den früheren israelischen Diplomaten Yohanan Meroz (1920 –2006) (vgl. Kaufhold 2023). Meroz, 1920 in Berlin als Hans Renatus Marcuse geboren, war 1933 mit seiner Mutter nach Palästina emigriert. Als früher Befürworter der Aufnahme von diplomatischen Beziehungen zu Deutschland arbeitete er von 1959 – 1963 als stellvertretender Leiter der Israel-Mission in Köln.
Diese war 1953 gegründet worden, um, möglichst im „Geheimen“ wirkend, ganz niederschwellige Kontakte, vor allem ökonomische Kontakte, zwischen Israel und Deutschland abzuwickeln. Die Israel-Mission hatte in Köln nacheinander an mehreren Orten ihre Geschäftsräume, vor allem an der Ehrenfelder Subbelrather Str. 15 (vgl. Meroz 1986, Kaufhold 2023). Heute existiert das Gebäude nicht mehr.
Glückliche Umstände ermöglichten es, dass auf dem Gelände des ehemaligen Kölner Israelitischen Asyls ab 1997 das heutige Wohlfahrtszentrum der Jüdischen Gemeinde Kölns entstehen konnte. Im Oktober 2013 wurde auf dem Gelände des Wohlfahrtszentrums ein Gedenkschild der Israel-Mission enthüllt (vgl. Kaufhold 2023; in diesem haGalil-Beitrag findet sich auf ein Foto des Gedenkschildes).
Von 1974 – 1981, dies sei nachgetragen, arbeitete Meroz als israelischer Botschafter in Bonn. Hieraus erwuchs auch sein Werk In schwieriger Mission (1986), auf welches Hahn in seiner Studie eingeht (S. 93). Es wird auch der Beitrag des 1903 unter dem Namen Fritz Tauber geborenen Juristen Moshe Tavor beschrieben, der in Israel als Journalist und Parlamentskorrespondent arbeitete und ab 1957 als Leiter der Informationsabteilung der Kölner Israel-Mission arbeitete. Auch der deutschsprachig aufgewachsene Tavor interessierte sich für diese studentische Vereinigung und förderte diese auch in Köln.
Günter Grass als „Freund Israels“
In dem Buch finden sich interessante Darstellungen über Günter Grass und dessen frühes, vorgebliche wohlwollendes Engagements für Israel.
Der frühere SS-Mann Günter Grass kehrte bekanntlich im Alter mit seinem „antizionistischen“ deutschen Furor, „mit letzter Tinte“ zu seiner Jugend zurück. 2012 beschuldigte er nicht den aggressiven, nach der Atombombe strebenden Iran, sondern Israel als „eine Atommacht, die den Weltfrieden gefährdet“ (Ari Shavit, Haaretz, 12.04.12; sowie „Günter Grass mochte keine roten Rosen“, haGalil).
In den Jahren 1960 und 1967 hingegen hatte Grass scheinbar noch eine Nähe zu geschichtsaufarbeitenden Engagements gesucht. So trat Grass 1960 als Kurator einer u.a. von der Berliner Deutsch-Israelischen Studentengruppe organisierten Ausstellung auf, die das juristische Verjährungsbemühen von schwersten NS-Verbrechen auch mittels ihrer Ausstellung zu durchkreuzen versuchte. Auch Helmut Gollwitzer – an dessen Engagement im Kontext der Deutsch-Israelischen Studiengruppen im Buch mehrfach erinnert wird – , sowie Weischedel, Flechtheim und Heinz Galinski gehörten diesem Ausstellungskuratorium an. Die innergesellschaftlichen Widerstände gegen die Ausstellung werden im Buch beleuchtet: Deren Ausstellung in den Räumen der Berliner Universität wurde untersagt. Der Berliner Kunsthändler Rudolf Springer stellte daraufhin seine Galerieräume für die Ausstellung zur Verfügung. Innerhalb von zwei Wochen kamen zwischen 5.000 und 8.000 Besucher.
Im März 1967 besuchte Grass – der seine SS-Mitgliedschaft da noch gut verborgen hatte – im Rahmen einer offiziellen israelischen Einladung Israel zu einer „literarischen Vorlesungsreise“ (S. 262). Der Blechtrommler Grass war offenkundig angetan von seinem Besuch in Israel. Wenige Monate später unterstützte er auch eine „Resolution für das tödlich bedrohte Israel“ (ebd.) und sprach mehrfach auf universitären Kundgebungen für Israel. Im Buch findet sich ein Foto seiner Rede auf einer Protestkundgebung des Bonner ASTA für Israel im Juni 1967 (S. 265). In dem hebräischsprachigen Magazin Du-Siach (Dialog; Auflage 5000), an dessen Herausgabe der Theologiestudent Ulrich Kusche maßgeblich beteiligt war, wurde 1967 eine Rede von Grass unter dem Titel „LeMa´an Tvuna Politit“ (Für politische Vernunft) abgedruckt. Auch Kusches frühes Engagement für einen Brückenschlag nach Israel wird von Hahn aufgearbeitet.
Hierzu ein Nachtrag: Als Grass 2012 nach seinen törichten Ausfällen gegen Israel ein offizielles Einreiseverbot nach Israel erhielt, veröffentlichte die israelische Tageszeitung Maariv einen Archiv-Beitrag des Schriftstellers Nathan Altermann zu Grass Besuch in Israel im März 1967. Grass habe seinerzeit in Israel „großes Interesse und Wertschätzung für seine Person geweckt“, so Alterman.
Vier Jahre später, 1971, kam es zu Grass´ zweitem – und letztem – literarischen Israel-Besuch. Bei einer Lesung, so wird berichtet, wurde er durch „nationalistische“ Israelis mit Tomaten beworfen. Das, so ist zu vermuten, war dem früheren SS-Mann Grass seelisch zu viel. Dass man ihn in Israel, dem Land der Shoahopfer, nicht durchgehend mit Blumen, sondern gar mit Tomaten empfing, das empörte ihn offenkundig zutiefst. Grass, daran kann kein Zweifel bestehen, war zuvörderst das Opfer einer böswilligen jüdischen Rachsucht. Seitdem setzte dieser Deutsche keinen Fuß mehr auf israelischen, auf jüdischen Boden. Stattdessen absentierte Grass mit „letzter Tinte“ bemerkenswerte weltpolitische „Einordnungen“ und seelisch-kulturelle Selbstexplorationen über das Fortwirken des Nationalsozialismus über 60 Jahre nach der Shoah (vgl. Kaufhold 2025a).
Eike Geisel als radikal linker „Kritiker“ Israels
In Hahns Studie findet sich eine weitere Person, die bereits in den 1960er Jahren mit dem Thema verbunden war: Der linke Publizist Eike Geisel (1945-1997). Dieser gilt, neben seinem Freund Wolfgang Pohrt, als der wohl wichtigste Protagonist der „Antideutschen“ – was immer man dazu fantasieren oder denken mag (vgl. Kaufhold 2022b). Eike Geisels Analysen und wortgewaltigen Polemiken über die „Wiedergutwerdung der Deutschen“ (Geisel 2015) bleiben aktuell und lesenswert, auch drei Jahrzehnte nach seinem frühen Tod.
Hahn zeichnet eine Debatte innerhalb der Deutsch-Israelischen Studiengruppen im Jahr 1967 nach: Ab dem Herbst 1967 brach innerhalb der letztlich winzigen „Israel-Szene“ Deutschlands eine Kontroverse über eine „kritische Solidarität“ gegenüber Israel aus – dass man sich also trotz einer grundsätzliche „Solidarität mit Israel“ auch kritisch zu innerisraelischen Entwicklungen positionieren dürfe und solle.[ii]
Wortführer innerhalb der Berliner Gruppe war ein sehr links stehender Student der Soziologie und Judaistik: Ein gewisser Eike Geisel (vgl. Bittermann 2015, Geisel 2025; vgl. Kaufhold 2022a, b, 2024a). Der 1945 Geborene sollte sich Jahrzehnte später gemeinsam mit seinem Freund Wolfgang Pohrt als den wohl scharfsinnigsten und wortgewaltigsten Kritiker gegenüber dem Antisemitismus der Neuen Linken positionieren.
Geisel hatte Anfang der 1960er Jahre einen Freiwilligendienst in einem Kinderheim bei Haifa geleistet und war 1967 der Berliner Gruppe der Deutsch-Israelischen Studiengruppen beigetreten. Im Dezember 1967 trat er auch erstmals bundesweit mit einem Vortrag über die Situation im Nahen Osten auf, in dem er den israelisch-arabischen Konflikt vor allem als Ergebnis einer gesellschaftsökonomischen Auseinandersetzung interpretierte (S. 282). Der bekannte Shoahüberlebende Arno Lustiger, der im Mai 1967 an der Entstehung der Frankfurter Studiengruppe aktiv beteiligt und affektiv sehr stark mit Israel, dem demokratischen Staat der Shoahopfer, identifiziert war, reagierte auf den mit dem linken SDS sympathisierenden Geisel in sehr heftiger Weise: Er forderte eine Streichung der Unterstützergelder für die Berliner Gruppe. Jegliche Form von „Israelkritik“ war mit ihm grundsätzlich nicht zu machen.
Der interne Konflikt verschärfte sich in den kommenden Jahren massiv. Eike Geisel wird in Hahns Studie als ein anzunehmender Verfasser und Verteiler von Flugblättern zum Thema verstanden, „der sich während dieser Zeit mehrmals durch die unabgestimmte Verbreitung provokativer Flugblätter im Namen der Studiengruppe hervortat“, so Hahn (S. 284). Eike Geisels Flugblätter wurden als „diffamierende Polemik gegen Israel“ wahrgenommen (ebd.).
Der Konflikt spiegelte sich auch in der internen Debatte über das von ihnen herausgegebene Magazin Diskussion wider. Der bereits erwähnte Heinz Wewer war der Motor dieses studentischen Magazins. Er verbündete sich hierbei mit dem israelischen Historiker und Politiker Simha Flapan (1911-1987), welcher in Tel Aviv zur linkszionistischen Mapam gehörte. Heute wird Flapan, der auch Herausgeber der Monatszeitschrift New Outlook sowie Verfasser des Buches Die Geburt Israels: Mythos und Wirklichkeit (1987) war, den Neuen Historikern Israels zugeordnet. Eike Geisel, der seit Sommer 1969 gleichfalls der Redaktion des Magazins angehörte, hingegen suchte Kontakte zu Mosché Machover, einem der Gründer der kleinen, linksradikalen, antizionistischen Gruppe Matzpen (vgl. Fiedler 2017). Diese winzige radikal-antizionistische israelische Gruppe mit nur wenigen Dutzend Mitgliedern erregte in Israel wie auch in deutschen jüdischen Gruppen seinerzeit massive Ängste, war weitgehend ein Phantasma, auch bei dem israelischen Botschafter Meroz ( vgl. Kaufhold 2023). Matzpen wurde projektiv eine außergewöhnliche gesellschaftliche Größe und Macht zugeschrieben. Auch deshalb sei an dieser Stelle vertiefend auf sie eingegangen.
Einer der bekanntesten Vertreter von Matzpen war der 1949 geborene Michael Warschawski, der langjährige Leiter des Alternativen Informationszentrums in Tel Aviv; dessen Schriften sind z.T. auch auf deutsch publiziert worden (vgl. Kaufhold 2008). Warschawski ist mit der bekannten, sehr linken israelischen Menschenrechtsanwältin Lea Tsemel verheiratet.
Gerade einige in der Apo-Zeit „aufbegehrende“ linke studentische Juden aus Frankfurt interessierten sich seinerzeit sehr für Matzpen; ausdrücklich genannt sei der Psychoanalytiker Sammy Speier in seiner eher kurzen „linken Phase“ (vgl. Kaufhold 2012). Matzpen war 1962 von vier ehemaligen KP-Mitgliedern als eine Abspaltung von der kommunistischen Partei Israels gegründet worden. Sie forderten eine Kritik am Zionismus im Sinne eines radikalen Antizionismus und eine unbedingte Solidarität mit dem palästinensischen „Befreiungskampf“.
Die Mitglieder von Matzpen gaben von Anfang an eine eigene Zeitschrift (Matzpen: dt. „Der Kompass“) heraus; diese soll zeitweise eine Auflage von 2000 gehabt haben. Hierzulande bekannt ist das Matzpen-Mitglied Khalil Toama (1944-2024). Nach einem Gefängnisaufenthalt Toamas im Jahr 1968 – dieser war seinerzeit Vorsitzender der palästinensischen Studenten an der Hebräischen Universität in Jerusalem – ging Toama nach seiner Freilassung in die Bundesrepublik. Dort las er erstmals von der Shoah und beschäftigte sich wohl intensiver mit dem Thema. Später beteiligte Toama sich an Dialogen zwischen Israelis und Palästinensern. Zeitweise soll er in den nach-68er Jahren in einer WG zusammen mit Daniel Cohn-Bendit gewohnt haben. An den erwähnten Protesten am 6.6.1969 an der Frankfurter Universität gegen den Besuch des israelischen Botschafters Ben-Natan soll er maßgeblich beteiligt gewesen sein (vgl. auch Kaufhold 2024c).
Um den Bogen hin zu dem späteren „Antideutschen“ Eike Geisel (Kaufhold 2022b) zu schlagen: Im Rahmen seiner Forschungen zur Shoah sowie zur jüdischen Geschichte lernte Eike Geisel 1978 die aus Bosnien und Jugoslawien stammende israelische Shoahüberlebende Hanna Lévy-Hass kennen. Die 1919 in Bosnien Geborene hatte schon wenige Jahre nach ihrer Einwanderung nach Israel, Ende 1948, ein Zeitzeugen-Tagebuch über ihren Überlebenskampf im Konzentrationslager Bergen-Belsen verfasst (Kaufhold 2024a). Dieses Werk war zwar 1963 auf Hebräisch (nach dessen Veröffentlichung brachen in ihr erneut ihre Traumatisierungen aus) und 1972 in Italien erschienen, blieb jedoch weitestgehend ohne Rezeption. Hanna Lévy-Hass wie auch ihr Ehemann gehörte anfangs der Kommunistischen Partei Israels an, von der sie sich später, nach Enttäuschungen über die Nichtanerkennung Israels durch einen Teil ihrer arabischen GenossInnen, abwandte.
Eike Geisel, der sich für solche linkspolitischen jüdischen Biografien brennend interessierte, lernte sie 1978 in Israel leben und war bald seelisch eng mit Hanna verbunden. Obwohl sie nach ihren Enttäuschungen innerlich nichts mehr mit ihrem Shoah-Tagebuch zu tun haben wollte, überredete Eike Geisel sie zu der Erlaubnis, dieses selbst zu übersetzen und auch auf deutsch zu publizieren. Ihr Tagebuch erschien dann 1979 auf deutsch – also zehn Jahre nach den beschriebenen Kontroversen zwischen Geisel und Wewer. Geisel trat auch als Herausgeber ihres Buches in Erscheinung. Nach dem Tode von Eike Geisel im Jahr 1997 sowie von Hanna Lévy-Hass im Jahr 2001 gab ihre Tochter Amira Hass, die sich als sehr kritische Journalistin von Haaretz einen Ruf in Israel erworben hat (und auf die sich antizionistische Kreisen außerhalb Israels legitimierend gerne beziehen), 2009 das Shoah-Tagebuch ihrer Mutter in einer erweiterten Version in einer Neuauflage auf deutsch heraus (vgl. Kaufhold 2024a, Lévy-Hass 2009).
So haben auch diese über ein Jahrhundert zurückliegenden, von Hahn minutiös nacherzählten Kontroverse und Jahrzehnte später spannende politisch-biografische Fortentwicklungen nach sich gezogen.
Max Horkheimer: Früher Brückenschlag nach Israel
Spannend zu lesen ist das Engagement des jüdischen Remigranten Max Horkheimer (1895- 1973) für einen Brückenschlag nach Israel. 1930 hatte Horkheimer eine Professur für Sozialphilosophie inne, gründete das Institut für Sozialforschung und musste 1933 als Jude in die USA fliehen. 1949 gehörte er zu den wenigen jüdischen Emigranten, die nach Frankfurt zurück kehrten. Gemeinsam mit Adorno baute er als jüdischer Philosoph und Soziologe an der Frankfurter Universität das Institut für Sozialforschung wieder auf.
Hahn beschreibt Initiativen an mehreren Universitätsstädten im Jahr 1952, durch die Geld für Israel gesammelt und die seinerzeitige Solidaritäts-Aktion „Friede mit Israel“ initiiert wurde. Vor dem Hintergrund sich anbahnender Verhandlungen zu Entschädigungszahlungen an Shoahüberlebende zwischen Israel und Deutschland hatte das Frankfurter Studierendenparlament 1952 eine „Erklärung zur Haltung gegenüber den Juden“ verabschiedet, in der auch eine zügige strafrechtliche Verfolgung von deutschen NS-Tätern gefordert wurde. Dafür wurden entsprechende Gesetze zur strafrechtlichen Verfolgung gefordert. Horkheimer hatte der Abstimmung persönlich beigewohnt und sprach dem Studentenparlament am Tag danach seine „Dankbarkeit für einen Vorgang, dem ich wahrhaft objektive Tragweite zuschreibe“ (S. 37) aus. Gleich darauf informierte Horkheimer auch seinen Kollegen von der Hebräischen Universität Jerusalem, Rektor Moshe Schwabe, über den Beschluss und formulierte vorsichtig seinen Wunsch nach „Möglichkeiten eines akademischen Brückenschlags zwischen Frankfurt und Jerusalem“ (ebd.). Die außergewöhnlichen, naheliegenden Schwierigkeiten eines solchen vorsichtigen akademischen Austausches zwischen Israel und Deutschland in den 1950er Jahren durchziehen die Studie. Die Deutsch-Israelischen Studiengruppen waren ein Versuch eines solchen Brückenschlages.
In seinem Brief an seinen israelischen Kollegen vom 10.1.1952 schrieb Horkheimer: „In den großen Fragen, die gegenwärtig zwischen Deutschland und Israel behandelt werden, vermögen deutsche Studenten nicht viel mehr als ihre Stimme zu erheben. Daß sie das tun und weiter tun werden, dürfen Sie mir glauben. (…) Bedürfen die Studenten Ihrer Hochschule etwa bestimmter Bücher, die in Deutschland sich finden? Gibt es sonstige Lehrmittel, die Ihnen fehlen und hier vorhanden sind?“ (S. 37)
Horkheimers Korrespondenz und der Beschluss des Frankfurter Studentenparlaments riefen vergleichbare weitere Beschlüsse etwa an der Universität Heidelberg hervor. Bald entstanden an beiden Universitäten auch Deutsch-Israelische Studiengruppen.
Der einführend erwähnte Studienaufenthalt Eva Belings in Israel war von Horkheimer nachdrücklich unterstützt worden. Seit 1952 besuchte sie Horkheimers Seminare und wurde hierbei zu einer seiner Lieblingsstudentinnen. Horkheimer wandte sich deshalb 1956 an seinen israelischen Kollegen Shmuel Eisenstadt mit der Bitte, die junge Deutsche bei ihren Forschungen in Jerusalem zu unterstützen – und sie auch vor möglichen Beleidigungen zu schützen. Anschließend verfasste Beling eine Promotion über die Integration der deutschen Jüdinnen und Juden in die israelische Gesellschaft, die sie 1965 bei Horkheimer abschloss: „Sie wissen, daß ich Ihre Arbeit und alles, was Sie tun mit den herzlichsten Wünschen begleite“, schrieb Horkheimer ihr im Juli 1957 (S. 61).
Die Mitte der 1950er Jahre entstandenen Deutsch-Israelischen Studiengruppen, so Hahns Resümee, seien heute „ein fester und gelebter Teil der Beziehungen beider Länder.“ (S. 314) Sie hätten das Verdienst eines frühen Wegbereiters.
Jonas Hahn: Die Deutsch-Israelischen Studiengruppen und die frühen studentischen Kontakte mit Israel 1948-1972. Göttingen: Wallstein Verlag 2025, 352 S., 38 Euro, Bestellen?
Literatur
Boord, O. (2001): Reparationszahlungen – „Wiedergutmachung“ – Die Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen. In: Kaufhold, R & T. Lieberz-Groß (Hg. 2001): Deutsch-israelische Begegnungen, psychosozial Nr. 83, Heft 1/2001, S. 55-66; s. haGalil 2010: https://www.hagalil.com/2010/07/gew-editorial/
Fiedler, L. (2016): Matzpen. Eine andere israelische Geschichte (= Schriften des Simon-Dubnow-Instituts. Nr. 25). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Geisel, E. (2015): „Die Wiedergutwerdung der Deutschen“. Essays und Polemiken. Berlin: Edition Tiamat.
Hass, A. (2010): Diary of Bergen Belsen: https://www.youtube.com/watch?v=cXfC0KE2JZE
Illouz, E. (2025): Der 8. Oktober, Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.
Kaufhold, R. (2012): Der Psychoanalytiker Sammy Speier (2.5.1944 – 19.6.2003): Ein Leben mit dem Verlust. Oder: „Kehrt erst einmal vor der eigenen Tür!“ “. In: Kaufhold, R. & B. Nitzschke (Hg., 2012): Jüdische Identitäten nach dem Holocaust in Deutschland. Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung H. 1/2012, S. 96-112. Neu veröffentlicht auf haGalil, 1.5.2015: https://www.hagalil.com/2016/05/sammy-speier/
Kaufhold, R. (2022a): „Ich schäme mich schrecklich, alles das zu erleben“. Das Bergen-Belsen Tagebuch von Hanna Lévy-Hass: https://www.hagalil.com/2022/08/hanna-levy-hass/
Kaufhold, R. (2022b): Der rastlose Unruhestifter, haGalil, 1.7.2022: https://www.hagalil.com/2022/07/pohrt-2/
Kaufhold, R. (2023): In schwieriger Mission. Als Botschafter in Bonn, Rezension von: Y. Meroz (1986): haGalil, 1.1.2023: https://www.hagalil.com/2023/01/in-schwieriger-mission-als-botschafter-in-bonn/
Kaufhold, R. (2024a): „Wir sind nicht tot, aber wir sind Tote“. Hanna Lévy-Hass – Widerständlerin und Chronistin von Bergen-Belsen, haGalil, 18.3.2024: https://www.hagalil.com/2024/03/levy-hass/
Kaufhold, R. (2024b): Kampf für die Idee des Zionismus. Eine bemerkenswerte Streitschrift von Fania Oz-Salzberger zum 7. Oktober, haGalil, 22.10.2024: https://www.hagalil.com/2024/10/fania-oz-salzberger/
Kaufhold, R. (2024c): Kein Israelhass und Antisemitismus an der Universität Köln. Protest von CityOfHope Cologne zum Schutz des israelischen Botschafters Ron Prosor an der Uni Köln, haGalil, 14.1.2024: https://www.hagalil.com/2024/01/koeln-prosor/
Kaufhold, R. (2025a): Katharina Blum lebt! – Das Erbe einer Erzählung. Cordula Echterhoffs kongeniale filmische Erinnerung an Heinrich Bölls „Katharina Blum“, haGalil, 25.2.2025 https://www.hagalil.com/2025/02/katharina-blum/
Kaufhold, R. (2025b): Antizionismus als tugendhafte Ideologie. Die linke israelische Soziologin Eva Illouz über den „8. Oktober“, haGalil, 30.9.2025: https://www.hagalil.com/2025/09/eva-illouz/
Lévy-Hass, H. (2009): Tagebuch aus Bergen Belsen 1944-1945. Mit einer Einleitung und einem Nachwort von Amira Hass. Herausgegeben von Amira Hass. Berlin: Beck Verlag.
Meroz, Y. (1986): In schwieriger Mission. Als Botschafter in Bonn: Ullstein-Verlag.
Oz-Salzberger, F. (2024): Deutschland und Israel nach dem 7. Oktober. Frankfurt/M.: Suhrkamp Verlag.
Speier, S. (1997): Manifestationen der totgeschwiegenen Vergangenheit 1933 – 1945 im heutigen Alltagsbewusstsein: Die BRD – ein politisch-menschlicher Krisenherd?! Kehrt vor der eigenen Tür! In: Juelich, D. (Hg.) (1997): Geschichte als Trauma. Für Hans Keilson. Gießen: Psychosozial Verlag.
Vrankovic, O. (2023): Israelische Realitäten und Israelsolidarität, haGalil, 24.11.2023: https://www.hagalil.com/2023/11/israelische-realitaeten-und-israelsolidaritaet/
Wuliger, Mi. (2020): Koscher durch die Krise. Wuligers Wochen. Ausgewählte Kolumnen aus der „Jüdischen Allgemeinen“. Hentrich & Hentrich, (s. die Rezension von Kaufhold: https://www.hagalil.com/2020/09/wuliger/)
[i] Kraushaar, W. (2013): „Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?“, Reinbek 2013.; vgl. (2012), Speier (1997).
[ii] Wenige Jahre später, 1977, führten die gleichen Diskurse und internen Kämpfe auch bei der 1966 gegründeten Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) zur Abspaltung einer kleinen, „israelkritischen“ Gruppe, die sich Deutsch-Israelischer Arbeitskreis für Frieden im Nahen Osten (diAk) nannte (also den Namen „Israel“ bewusst unerwähnt ließ) und viele Jahre lang eine zumindest randständige politische Bedeutung hatte. Heute ist diese Gruppierung faktisch bedeutungslos. Besagter U. Kusche hat hierzu einen persönlich getönten Rückblick verfasst: https://ulrichkusche.net/fuenfzig-jahre-deutsch-israelische-beziehungen/