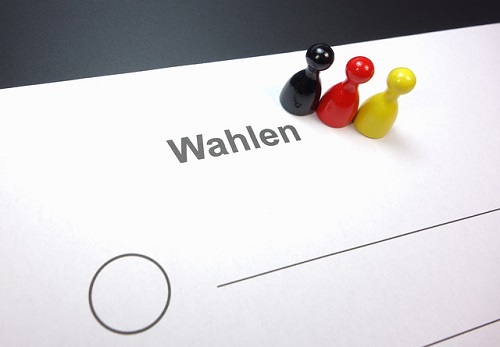Am Sonntag wird in Deutschland ein neuer Bundestag gewählt. Grund genug zu schauen, welche Positionen die einzelnen Parteien zu Themen einnehmen, die Jüdinnen und Juden betreffen oder für die jüdische Gemeinschaft von Relevanz sind.
Von Ralf Balke
Erst einmal eine kleine Überraschung. Nicht das Thema Migration ist für die Entscheidung der Wählerinnen und Wähler, wem sie am 23. Februar ihre Stimme geben, am wichtigsten. Laut ZDF Politbarometer steht für 45 Prozent von ihnen der Themenkomplex Frieden/Sicherheit an erster Stelle, dicht gefolgt von Wirtschaft und sozialer Gerechtigkeit. Flüchtlinge/Asyl rangieren mit 26 Prozent erst auf Platz Vier, danach kommen Klimaschutz und Rente/Alterssicherung. Das dürfte sich weitestgehend mit den Kriterien von deutschen Jüdinnen und Juden decken, die mitentscheidend sind für ihre Wahlentscheidung – aber nicht ganz. Denn die überwiegende Mehrheit der jüdischen Gemeinschaft hat einen postsowjetischen Hintergrund, weshalb sie die russische Invasion in der Ukraine mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgen. Ebenso den Konflikt zwischen Israel, den Palästinensern und dem Iran – schließlich haben viele von ihnen Verwandtschaft im jüdischen Staat.
Weil überdurchschnittlich viele aus der jüdischen Gemeinschaft von Altersarmut betroffen sind, da ihre Erwerbsbiografien aus sowjetischer Zeit größtenteils nicht anerkannt werden, dürfte das Thema Rente/Alterssicherung bei Jüdinnen und Juden wohl ebenfalls einen höheren Stellenwert besitzen. Und selbstverständlich gibt es eine Diskrepanz zur nichtjüdischen Mehrheitsbevölkerung bei einem ganz anderen Thema, und das ist der Kampf gegen den wachsenden Antisemitismus, egal ob klassisch-rechtsextrem, migrantischen Ursprungs oder von links beziehungsweise aus der Mitte der Gesellschaft. Dieser spielt für die allermeisten nichtjüdischen Deutschen – wenn überhaupt – eine eher untergeordnete Rolle, was sich dann ebenfalls im Wahlkampf widerspiegelt. Allenfalls wird vor dem Rechtsextremismus gewarnt, aber die ganz realen Gefahren für Jüdinnen und Juden dabei weitestgehend ausgeblendet.
Blickt man auf die politische Programmatik und die Aussagen einzelner Politiker, so fallen zwei Parteien auf, die aus jüdischer Sicht quasi unwählbar sind, und zwar die AfD sowie das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). „Diese beiden Parteien verschleiern ihre Absichten kaum noch“, brachte es dieser Tage Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, in einem Schreiben an die 103 im Zentralrat organisierten jüdischen Gemeinden auf den Punkt. „In der AfD und im BSW finden Antisemiten aus dem rechtsextremen Bereich und radikale Israel- und Ukrainefeinde aus dem linken Spektrum ein Zuhause. Dabei verwehren sie sich gleichzeitig dem demokratischen Diskurs und arbeiten mit populistischen Methoden. Sie spielen mit den Ängsten und Sorgen der Menschen und bieten vermeintlich einfache Lösungen auf komplexe Sachverhalte an. Wirkliche Lösungen sind es jedoch nicht.“
Die AfD stilisiert sich nach den Worten ihrer Co-Vorsitzenden Alice Weidel zwar gerne als „die einzige Beschützerin des jüdischen Volkes hier in Deutschland“. Ein Blick auf ihre reale Politik widerspricht dieser Behauptung auf allen Ebenen. So stellte die AfD im Februar 2023 einen Antrag zum Schächtungsverbot, angeblich um den „Tierschutz zu stärken“. Dieser Move, Minderheiten das Leben schwer zu machen, indem man unter fadenscheinigen Begründungen Praktiken verbietet, die zu den Fundamenten ihrer Religion gehören, ist ein alter Trick. Bereits die Nationalsozialisten bemühten den Tierschutz, um koscheres Schlachten als eine der ersten gesetzlichen Maßnahmen ihrer antisemitischen Politik zu kaschieren. Die AfD will vor allem muslimisches Leben verunmöglichen, wenn es dabei Jüdinnen und Juden trifft, ist es ihr ziemlich egal, weil diese Gruppe demografisch aus ihrer Perspektive kaum ins Gewicht fällt.
Schaut man auf das Wahlprogramm, so fällt auf, dass aus der von AfD beschworenen „jüdisch-christlichen“ Kultur plötzlich die „christlich-abendländische“ wurde. Viel bezeichnender aber ist ihre Aussage zum Umgang mit der deutschen Vergangenheit: „Die offizielle Erinnerungskultur darf sich nicht nur auf die Tiefpunkte unserer Geschichte konzentrieren, sie muss auch die Höhepunkte im Blick haben.“ Kurzum, man will ein erinnerungspolitischen Rollback. Ebenso in der Präventionsarbeit gegen den Rechtsextremismus, weil dieser schlichtweg für sie nicht existent ist. Auch zu den Feinden Israels kennt die AfD wenig Distanz. Immer wieder sind Vertreter der Partei nach Damaskus oder Teheran gereist. „Syrien: AfD-Politiker verbrüdern sich mit Großmufti Hassun“, titelte der „Spiegel“ exemplarisch im März 2018. Wenn es um Israel geht, sollte man schauen, was das Führungspersonal zu sagen hat: Waffenlieferungen an Israel seien nichts anderes als „Öl ins Feuer“ zu gießen, so AFD-Chef Tino Chrupalla im November im Bundestag. Und die Nähe der AfD zu Moskau ist bekannt. Außenpolitisch positioniert man sich als Friedenspartei, die alle Sanktionen gegen Russland abschaffen und letztendlich die Ukraine preisgeben will.
Darin deckt sich die AfD mit dem BSW. „Wagenknecht und Weigel bewirtschaften die Angst, die Putin ausübt“, so das Urteil des Osteuropahistorikers Karl Schlögel. Unter dem Deckmantel, eine „Friedenspartei“ zu sein, äußert sich das BSW explizit zum Thema Israel, spricht von einem „rücksichtslosen Rache- und Vernichtungsfeldzug der Regierung Netanjahu gegen Frauen und Kinder“. Im Westjordanland, Libanon und Gazastreifen verübe Israel „Kriegsverbrechen“, weshalb sich das BSW auch gegen jede Form von Waffenlieferungen an Israel ausspricht. Mit Michael Lüders hat die Partei zudem einen Spitzenkandidaten aufgestellt, der für seine Aversion gegen Israel, westliche Werte und seine Nähe zum Regime in Teheran bekannt ist. Sucht man im Programm nach Äußerungen zum Thema jüdisches Leben in Deutschland, dann findet sich nichts – sehr wohl aber deutliche Kritik an der im November vom Bundestag verabschiedeten Antisemitismusresolution, die dem BSW überhaupt nicht gefällt.
Welche Sprengkraft das Thema Antisemitismus enthält, davon kann die Partei „Die Linke“ ein Lied singen. Manche prominente Politiker, allen voran Berlins ehemaliger Senator für Kultur Klaus Lederer, traten im Oktober 2024 aus der Partei aus, weil sich „Die Linke“ ihrer Meinung nicht deutlich genug gegen Judenhass positioniert und nach dem 7. Oktober zweifelhafte bis hin zu antisemitische Meinungen toleriert habe. Entsprechend ist der Antisemitismus von links oder aus migrantischen Milieus für „Die Linke“ quasi inexistent. Zwar spricht man sich gegen jede Form des Judenhasses aus, der Antisemitismus selbst aber erscheint neben dem Antiziganismus, antimuslimischen Rassismus und so weiter als eine etwas beliebige Kategorie. Außerdem ist man gegen Waffenlieferungen an Israel, weil die „Die Linke“ generell gegen Rüstungsexporte eingestellt ist. Aber dafür setzt man sich für die Anerkennung von Yom Kippur als gesetzlichen Feiertag ein.
Bei der SPD dagegen nennt man im Programm explizit die Förderung des jüdischen Lebens als relevantes Ziel, belässt es aber bei allgemeinen Formulierungen, sodass man nichts Konkretes erfährt, was genau die SPD gegen Antisemitismus unternehmen würde. Außerdem gibt es ein Glaubwürdigkeitsproblem: Die Bundestagsvizepräsidentin und SPD-Politikerin Aydan Özoguz hatte unter anderem auf der Plattform X einen Beitrag der radikal-antizionistischen „Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost“ geteilt, dass ein Flammeninferno zeigt mit dem Satz „This is Zionism“. Konsequenzen folgten nicht. Immerhin spricht sich die SPD explizit für eine Bekämpfung des Islamismus aus. Das Verbot – unter anderem des radikalen Vereins Samidoun – verschiedener Gruppen, die der Hamas oder Hisbollah nahestehen durch Innenministerin Nancy Faeser traf bei der jüdischen Gemeinschaft auf Zustimmung. Was das Thema Israel angeht, hält man bei den Sozialdemokraten weiterhin an der Zweistaatenlösung fest. Und neuerdings wird der Iran als Urheber der Konflikte in der Region deutlicher benannt.
Die Wahrnehmung der Grünen dagegen ist sehr ambivalent. Das Programm enthält Äußerungen zum Antisemitismus, denn man in all seinen Formen bekämpfen möchte, auch wenn nicht klar formuliert wurde, wie das geschehen soll. Positiv werden die Bekenntnisse von Robert Habeck zum Staat Israel gesehen sowie die Benennung der Hamas als Verantwortlichen für das, was am 7. Oktober 2023 geschehen ist. Nur finden sich diese nicht in der Programmatik wieder. Negativ dagegen wirken die Skandale rund um die documenta fifteen nach, die auf das Konto von grünen Kulturstaatsministerin Claudia Roth gehen, die zu keinen Konsequenzen führten, sowie die Annalena Baerbocks Einladungen von erklärten Feinden Israels zu einem Abendessen im Auswärtigen Amt.
Die FDP dagegen erklärt in ihrem Programm, dass die Sicherheit Israels und des jüdischen Lebens für die Liberalen von zentraler Bedeutung seien. Was die Waffenlieferungen an Israel betrifft, fordert die FDP sogar, dass man den jüdischen Staat wie einen NATO-Partner behandeln solle. Zudem wünscht man sich, dass alle Schülerinnen und Schüler NS-Gedenkstätten und Synagogen besuchen sollen, und zwar als eine Art Pflichtprogramm, das für alle gilt. Nur was den Umgang mit der AfD angeht, haben die Liberalen ein Glaubwürdigkeitsproblem: So stimmten sie mit der AfD für den Entschließungsantrag von Friedrich Merz vor wenigen Wochen, ihr Landespolitiker Thomas Kemmerich ließ sich in Thüringen 2020 mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen. Und mit Wolfgang Kubicki hat man weiterhin einen Politiker in seinen Reihen, der Jürgen Möllemanns engster Vertrauter in der Partei war und der Sanktionen gegen Russland immer kritisch gegenüber stand.
Ähnlich ist die CDU aufgestellt. Was ihre Programmatik angeht, so fordert die Union mehr Schüleraustausche mit Israel sowie verpflichtende Besuche von Jugendlichen in NS-Gedenkstätten. Anders als alle anderen Parteien will man zudem die Förderungen im Kunst- und Kulturbereich von einer Bejahung des Existenzrechts Israels und der Absage an Antisemitismus und Antizionismus abhängig machen. Auch bei Fragen der Einbürgerung sollen ähnliche Kriterien zur Geltung kommen. Zudem nennt die CDU explizit den Islamismus als Gefahr und will härter gegen Terrorunterstützer vorgehen. Über das wie, also die Umsetzung der Forderung in konkrete Gesetze, erfährt man dagegen wenig. Außerdem hat die CDU ein Glaubwürdigkeitsproblem, wenn es um die Abgrenzung zur AfD geht. Das zeigte der von ihrem Spitzenkandidaten Friedrich Merz initiierte Entschließungsantrag zum Thema Migration, bei dem er sich die Mehrheit dazu von der AfD holte. Auch rumort es in den Landesverbänden der CDU in Ostdeutschland, dort würde man mancherorten zu gerne mit der AfD koalieren, weshalb die viel beschworene Brandmauer gegen Rechts in Gefahr gebracht wurde.