1989 – 2002: Der Prozess gegen den NS-Täter Anton Malloth – der Mörder Martin Finkelgruens
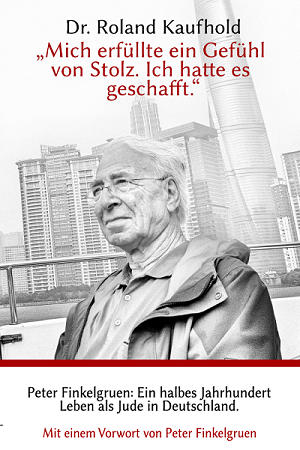 Die Beiträge sind auch als Buchveröffentlichung erhältlich.
Die Beiträge sind auch als Buchveröffentlichung erhältlich.
Roland Kaufhold: „Mich erfüllte ein Gefühl von Stolz. Ich hatte es geschafft.“ Peter Finkelgruen: Ein halbes Jahrhundert Leben als Jude in Deutschland, BoD 2022, 244 S., Euro 12,99, Bestellen?
Von Roland Kaufhold
„Dies ist die Geschichte eines ungesühnten Mordes. Ist ein perfekter Mord einer, der begangen und nicht entdeckt wird? Oder ist der perfekte Mord jener, der auf offener Bühne vor den Augen aller begangen wird? Ich stieß auf einen Mord und auf einen Mörder. Ich wechselte vom Chronisten zum Detektiv. Zum Schnüffler. Es war unmöglich, der Lebensgeschichte der Eltern nachzugehen, ohne diesen Mord zu schildern und die Tatsache, daß er zu den Akten gelegt worden war, obwohl Mord und Mörder bekannt sind.“
Finkelgruens Einleitung zu seinem Familienroman Haus Deutschland (Finkelgruen 1992, S. 9).
Vorgeschichte
Anton Malloth hat Peter Finkelgruens Leben auf sehr tragische Weise wohl am stärksten geprägt, beeinträchtigt. Großen Wert hat Finkelgruen hierauf gewiss nicht gelegt: Es kam etwas Morbides, Brutales, Destruktives in sein Leben, dessen Existenz er akzeptieren musste. Malloth war der Mörder seines Großvaters Martin. Malloth hat Finkelgruens Großvater Martin Finkelgruen[1] am 10.12.1942 – neun Monate nach Peter Finkelgruens Geburt in Shanghai -in der Kleinen Festung Theresienstadt totgetreten. Und Malloth war an zahlreichen weiteren Morden beteiligt. Wer eine Kurzversion des Schreckens lesen möchte: Jürgen Winkel (2001), Schröm & Röpke (2002) und Finkelgruen (2002) haben dies in der Endphase des Malloth-Prozesses dokumentiert.
Der „schöne Toni“, wie Malloth bereits in den 1940er Jahren in Theresienstadt genannt wurde, war wegen seiner Gewalttätigkeiten einer der gefürchtetsten Aufseher in Theresienstadt. Als Finkelgruen begann, sich die Akten über dieses Grauen zu besorgen, war er lange nicht mehr arbeitsfähig. Er war derart erschüttert, dass es ihn innerlich zerriss. Mehr als zerriss. Je mehr er sich in die Gerichtsakten einlas – in seinem „Vorlass“[2] füllen sie etwa 20 Aktenordner – , desto stärker wurde er von der Erinnerung an das willkürliche Morden vieler Deutscher überschwemmt. Dem seit Jahren in der betuchten Pullacher Seniorenresidenz lebenden betagte Mörder vermochte Finkelgruen seit dem Sommer 1988 – seit seiner eigenen Rückkehr aus Israel nach Köln – nicht mehr auszuweichen.
An Bord der Paloma war Finkelgruen im Sommer 1988 von Haifa nach Piräus gefahren. In Haifa kauft er sich rasch eine deutschsprachige Tageszeitung, vor seiner Weiterreise nach Deutschland. Seit einigen Tagen hat der Journalist nichts mehr über die Weltereignisse erfahren. Dann stößt er auf Seite Fünf auf eine scheinbar belanglose Kurzmeldung: „Der 1948 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth ist von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden.“ Weiter wird vermeldet, dass die Staatsanwaltschaft in Dortmund „kein Interesse an der Auslieferung des KZ-Wächters gehabt habe, da kein dringender Tatverdacht gegeben sei.“ (Finkelgruen 1992, S. 11, Kursivsetzung im Original). Anfangs dachte er noch, dass es „ganz einfach sein“ würde, „dieser Geschichte nachzugehen. (…) Ich ahnte nicht, wie sehr ich mich täuschte.“ (ebd., S. 12)
In den Monaten und Jahren danach stand Finkelgruen am Abgrund, immer wieder und wieder. Aber der in großer Isolation und Armut in Shanghai Aufgewachsene beschloss, zu kämpfen. Er kämpfte auch für seinen willkürlich totgetretenen Großvater Martin.
In der direkten Auseinandersetzung mit diesem ungesühnten Mord verbrachte Finkelgruen dreizehn Jahre. Zwei Bücher, mehrere Buchbeiträge Finkelgruens, zwei Filme und ein Theaterstück (Joshua Sobol) entstanden aus seinen unermüdlichen, ihn traumatisierenden Bemühungen, den Mörder durch deutsche Gerichte verurteilen zu lassen. Drei konkrete Angebote, den Mörder auf privater Ebene zur Verantwortung zu ziehen – Malloth also vergleichbar wie den SS-Obersturmbannführer Eichmann in Argentinien im Mai 1960 in Argentinien entführen zu lassen; oder wie die – gescheiterte – Entführung Kurt Lischkas am 22.3.1971 in Köln durch Beate Klarsfeld (vgl. Kaufhold 2013d, 2013e) – lehnte er ab. Er vertraute auf die deutsche Justiz, den demokratischen Rechtsstaat – und wurde mehrfach bitter enttäuscht. Bei der Aufarbeitung dieses für Finkelgruen traumatisierenden Themenkomplexes in dieser Studie ist es mir Finkelgruens Entscheidung zeitweise als fragwürdig erschienen.
Mangelnde „Aufarbeitung“ der NS-Justiz: Wissenschaftliche und journalistische Belege
Neben Finkelgruens Werken haben mehrere Fernsehsendungen und eine Vielzahl von Zeitungs- und Buchbeiträgen den „Fall Malloth“ thematisiert. Schröm & Röpke (2002) haben die Justizgeschichte Malloth in ihrem Buch über NS-Täter gleichfalls umfänglich rekonstruiert. Selten in der an Skandalen nicht armen Geschichte der bundesrepublikanischen NS-Aufarbeitung – die Geschichte der DDR und ihrer „Aufarbeitung“ der nationalsozialistischen Verbrechen sowie deren personellen Kontinuität nach 1945 wäre ein eigenes Thema, das jedoch in keinster Weise zu vorteilhafteren Ergebnissen kommt (vgl. Meenzen 2010; Wagner 2017; Heitzer, Jander, Kahane & Poutrus 2018) – schien das Bemühen von Teilen der NRW-Justiz so eindeutig, den Verantwortlichen zu schützen. Die überlebenden Opfer, die Rückkehrer und deren Nachkommen wurden hierdurch noch zusätzlich traumatisiert. Die Verfolgten, die Ermordeten wurden endgültig aus dem kollektiven Gedächtnis ausgestoßen. Eine kleine geschichtspolitische „Polemik“ sei gestattet: Dies korrespondierte mit dem geschichtsverleugnenden Erbe von Walser, Grass, Höcke und Augstein…
Neue Forschungen untermauern den in dieser Studie nachgezeichneten Befund: So kommt der ehemalige Richter Karl-Heinz Keldungs (vgl. Keldungs 2019) im historischen Rückblick zu einem niederschmetternden Urteil. Gegenüber der WELT (6.1.2020) wirft er vielen damaligen Richtern vor, „sie hätten sich nicht ausreichend mit den Straftaten der Aufseher auseinandergesetzt“ – die Urteile seien zu milde gewesen:
„Natürlich hat es viele Nazis unter den Nachkriegsrichtern gegeben. Aber das war nicht der einzige Grund. Es hatte auch mit der Stimmung in der Bundesrepublik zu tun. Die Nachkriegszeit war gekennzeichnet von einem lähmenden Geist. Viele Menschen wollten die Gräueltaten der Nazis nicht an sich heranlassen. Sie sahen immer noch die positiven Momente des NS-Staates. Von dieser Haltung waren auch die Richter nicht frei. Es gibt Verfahren, wie etwa das gegen sechs Angeklagte des Vernichtungslagers Sobibor am Landgericht Hamburg, bei denen alle wegen Putativnotstands freigesprochen wurden.“
Peter Finkelgruen ist geradezu euphorisch, als er mir vor sechs Jahren eine Vielzahl von Aktenordnern zum „Fall Malloth“ übergibt, mit einer unüberschaubaren Sammlung von Gerichtsakten, Briefkorrespondenzen und Zeitungsbeiträgen: „Hier hast Du alles!“ Der Gerichtsprozess hatte sich 13 Jahre lang hingezogen. Immer wieder versuchten Richter, insbesondere der Dortmunder Oberstaatsanwalt, die Akten zu schließen. Hiergegen wehrte sich Finkelgruen über ein Jahrzehnt lang. Er vermochte mit dem offenkundigen, schreienden Unrecht nicht zu leben.
Anton Malloth erfuhr, wie nachfolgend rekonstruiert wird, über mehrere Jahrzehnte hinweg massiven Schutz. Erst als er ein Greis war wurde er verurteilt (Übelhack 2001) – ausgerechnet durch die bayrische CSU-Justiz, nicht durch die sozialdemokratisch geprägte NRW-Justiz.
Die Lektüre dieser institutionalisierten Einfühlungsverweigerung, dieses Schutzes der Täter durch die Mehrheitsgesellschaft sowie großen Teilen der Justiz, ist am Beispiel mehrerer großer NS-Prozessen dokumentiert worden. Der 1942 geborene Journalist Ernst Klee (2013) hat seine viele Jahrzehnte überdauernden Forschungen über die NS-Zeit in dem monumentalen Werk „Täter, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon“ zusammen geführt. Klee schickt seinem Werk die Mahnung voraus: „Wer Auschwitz zu beschreiben versucht, bewegt sich an der Grenze der Belastbarkeit. Nur: Was wir kaum ertragen, beschreiben zu müssen, mussten Menschen am eigenen Leib erfahren. Was besonders bedrückt: Viele gingen zugrunde, ohne je gelebt zu haben. Kaum einer, der überlebte, erfuhr annähernd ein gutes Leben als Ausgleich seiner Leiden.“
Dieser Berg von Materialien, dieser 13 Jahre andauernde, scheinbar ausweglose juristische Kampf Finkelgruens gegen eine NRW-Justiz muss bei der Lektüre als verstörend erscheinen. Seine Auseinandersetzung hiermit hat auch Finkelgruens Gesundheit nicht gut getan. Für mich sind es Dokument eines Fortwirkens der Barbarei auch 50 Jahre nach Ende der Shoah (vgl. auch Kaufhold/Hristeva 2022).
Zu vergleichbaren Erkenntnissen wie Klee kommt auch der Journalist Hellmut Vensky in seinem ZEIT-Beitrag (8.2.2009) über den NS-Verbrecher Josef Mengele. Überschrieben ist dieser mit „Der lange Schutz für die Nazi-Täter“.
Nachfolgend stelle ich die Vorgeschichte des NS-Täters Malloth, dessen über ein halbes Jahrhundert überspannende Fluchtgeschichte sowie den von Finkelgruen in die Wege gebrachten Justizprozess gegen Malloth in zeitlich chronologischer Reihenfolge vor. Finkelgruens eigene Geschichte, seine Involvierung in diesen Gerichtsprozess, schimmert hierbei immer wieder durch, methodischer Ansatz ist jedoch die distanzierte Rekonstruktion der Chronologie dieses NS-Prozesses.
Vorgeschichte: Der NS-Täter Anton Malloth. Ein staatsanwaltschaftliches Protokoll (22.8.1988)
Der am 13.2.1912 in Innsbruck geborene Anton Malloth wuchs in der in Südtirol gelegenen Kleinstadt Meran auf. Meran hat heute knapp 40.000 Einwohner. Malloths Pflegeeltern betrieben ein Gasthaus.
Finkelgruen hat versucht, gegen sein inneres Unbehagen, Malloths Kindheit nachzuzeichnen. Einige Selbstaussagen Malloths entnahm er den Gerichtsakten. Über Malloths Kindheit schreibt er: „Seinen Vater kannte er nicht. Seine Mutter sah er wohl nur gelegentlich. Die Zieheltern ließen ihn Kind sein. Zu hungern brauchte er nie. Wenn er Fieber hatte, pflegten sie ihn. Mit ihren Töchtern durfte er spielen. Vermutlich hätten sie gern einen eigenen Sohn gehabt und haben ihn sozusagen als Ersatz in Pflege genommen.“ (Finkelgruen 1992, S. 38)[3]
Nach der Schule, die für ihn 14-jährig nach der achten Klasse endete, machte Malloth eine Ausbildung zum Fleischhauer, mit 17 Jahren trat er eine Stelle als Geselle bei einem Fleischhauer in Meran an. Dort blieb er jedoch nur ein Jahr. Danach wechselte er für ein Jahr als Geselle zu einem anderen Metzger – bis er sich für 1 ½ Jahre die italienische Uniform anzog. Eine Tochter seiner Zieheltern betrieb im benachbarten Obermais einen kleinen Lebensmittelladen, dort arbeitete Malloth zur Aushilfe. Es folgten, in Fortsetzung der von Fragmentierungen geprägten Biografie des späteren NS-Täters, vier Jahre als „Barmixer in einer Wein- und Getränkehandlung“; diese Angaben findet Finkelgruen in einem vom Dortmunder Oberstaatsanwalt Schacht sehr kurz gehaltenem „Vernehmungsprotokoll“. Psychologisch gesehen machte Malloth den Gesamteindruck eines biografisch Entwurzelten, eines von unbewussten Motiven Getriebenen. Malloth begann wohl auch bereits in dieser Lebensphase, sich regelmäßig mit Alkohol zu betäuben.
Danach wurde Anton Malloth Obergefreiter. Er war nun 27 Jahre alt.
Malloth war also – dieser Aspekt spielt für den weiteren Verlauf dieser Geschichte eine große Rolle – von seinen Papieren her Italiener, optierte im Herbst 1939, nach dem „Anschluss“ Österreichs, jedoch für Deutschland. Hiermit konnte er zugleich den Wehrdienst in Österreich umgehen. Am 12.2.1940 erhielt er vom Landeshauptmann von Tirol die Einbürgerungsurkunde (Schröm & Röpke 2002, S. 25). 1942 heiratete Malloth, bald darauf bekam er ein Kind. Die Existenz eines weiteren Kindes, mit einer anderen Frau, verheimlichte er hingegen. Bekannt wurde dies später, weil er die Unterstützergelder für sein Kind nicht zu zahlen bereit war.
Im Juni 1940 trat Malloth eine Stelle als Aufseher im Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt an. Dort blieb er knapp fünf Jahre, bis zur Befreiung von Theresienstadt im Mai 1945. „Mein Entschluss“ – sollte Malloth sich ein halbes Jahrhundert später in der „Anhörung“ des Dortmunder Oberstaatsanwaltes Klaus Schacht am 22./23.8.1988 erinnern – in der Grenzpolizei und dann in Theresienstadt als SS-Mann zu wirken, „hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte…“. Auch nicht, „weil ich mich für Hitlers Politik besonders interessiert hätte; ich kannte ihn kaum.“ Er fügt hinzu: „Mein Entschluß, mich zur Grenzpolizei zu melden, hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte. Mein Jugendtraum war es eigentlich immer gewesen, Kriminalist zu werden. (Finkelgruen 1992, S. 54)
Am 21.2.1940 erhielt Malloth in Innsbruck vom Tiroler Landeshauptmann eine Einbürgerungsurkunde für das Deutsche Reich. Malloth wurde zum Schutzpolizisten ausgebildet. Im Juni 1940 wurde er in dem von Heinrich Jöckel kommandierten Gestapo-Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt Aufseher. In einer dienstlichen Beurteilung wurde festgestellt, dass ihn seine „Leistung, Führung und charakterliche Veranlagung“ als für den Kolonialdienst geeignet erscheinen lasse. Dort, in der Festung Theresienstadt, blieb Anton Malloth fünf Jahre, bis zur Befreiung durch die Rote Armee am 8.4.1945. Da hatte Malloth den Rang eines Oberscharführers erreicht. Mit ihm dienten in Theresienstadt etwa 60 SS-Leute und 20 Kapos. Von den insgesamt 140.000 Menschen, die das Ghetto durchlaufen hatten, lebten bei Kriegsende nur noch 16.832 (Schröm & Röpke 2002, S. 24).
Der Leiter der Gedenkstädte Theresienstadt, Vaclav Novak, beschrieb den SS-Mann Malloth in der tschechoslowakischen Zeitung Rude Pravo so: „Trotz seines Spitznamens, „der schöne Toni“ war Malloth ein böser und grausamer Mensch mit einem Hang zum Alkoholismus. Wenn er getrunken hatte, war er besonders brutal zu den Häftlingen. Gern und freiwillig meldete er sich zu Hinrichtungskommandos.“ (Die Zeit, 6/1990)
Mai 1945 – 1949: Stationen einer Flucht
Am 7. Mai 1945 verkündete ein Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes vom Balkon des Rathausturmes aus auf deutsch und französisch die Kapitulation Deutschlands. Gegen 21 Uhr des darauffolgenden Tages rollten die ersten russischen Panzer in Theresienstadt ein.[4]
Der seinerzeit 33-jährige Malloth war nach Finkelgruen bereits drei Tage zuvor, am 5.5.1945, aus Theresienstadt geflohen. Da er nicht wusste, in welchen Teilen Österreichs russische Truppen waren, floh der SS-Mann aus Angst vor den Russen und Tschechen in die amerikanische Zone: nach Darmstadt in die Liebhowerstraße 18; später versteckte er sich bei seinen Schwiegereltern in der 55 km östlich von Innsbrucks gelegenen Kleinstadt Wörgl.
Bis Anfang September 1946 wurden auf Bitten des tschechischen Verbindungsbüros bei den alliierten Streitkräften 354 Mörder an die Tschechoslowakei ausgeliefert. Wegen des sich anbahnenden Kalten Krieges zwischen West und Ost fanden danach keine Auslieferungen von den Alliierten an die Tschechoslowakei mehr statt.
Malloths Vorgesetzter Heinrich Jöckel wurde am 25.10.1946 in Leitmeritz/CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt. Im Urteil wurden eine Vielzahl von Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge dokumentiert, die grausamste Misshandlungen und Willkürhandlungen dokumentieren.
Am 9.10.1947 übersandte die tschechoslowakische Gesandtschaft dem österreichischen Justizminister eine Liste von Personen, die „wegen Kriegsverbrechen verfolgt werden“ (PAF).[5] Darunter befand sich auch Malloth.
Am 29.12.1947 wurde der inzwischen 35-jährige Malloth, der sich bereits seit 1 ½ Jahren auf der Flucht befand, in Fulpmes, Tirol, von der österreichischen Polizei festgenommen. Er, der 1940 noch einen handschriftlichen Lebenslauf mit „SS-Mann Anton Malloth“ unterzeichnet hatte, bestritt nun gegenüber einem Innsbrucker Richter jegliche Beteiligungen an NS-Verbrechen. Selbst seine Mitgliedschaft in der NSDAP stellte er in Abrede. Dem Vernehmungsrichter diktierte Malloth, dass er „während meiner ganzen Dienstzeit keinen einzigen Menschen ermordet oder misshandelt“ habe. Ein Auslieferungsgesuch der CSSR wurde von den österreichischen Behörden bereits neun Tage (!) später abgelehnt, weil die tschechischen Behörden, wie das Justizministerium mitteilte, eine Frist zur Begründung ihres Auslieferungsantrages abgelehnt hätten.
Januar 1948: „Ich bin Südtiroler“ – kein Deutscher
Am 16.1.1948 stand Anton Malloth vor dem Untersuchungsrichter in Innsbruck, er wurde schwerer Kriegsverbrechen beschuldigt. Das Protokoll der Vernehmung ist äußerst kurz: Zwölf handgeschriebene Zeilen. Darin teilt Malloth – der bisher stets nur von einem eigenen Kind gesprochen hatte (s.o.) – u.a. mit, er habe die Pflicht sich um „Frau und zwei Kinder (5 u. 9 Jahre) zu sorgen.“ Die Existenz des anderen, älteren, unehelichen Kindes hatte Malloth gegenüber den Behörden hingegen verschwiegen. Bemerkenswerter jedoch: Gegenüber dem österreichischen Untersuchungsrichter stellte sich der auf der Flucht befindliche NS-Mann nun als Opfer widriger, ungerechter Umstände dar; und er bezeichnete sich selbst – dies ist für den weiteren Ablauf dieses Prozesses von Bedeutsamkeit – nun nicht mehr als Deutschen sondern als Österreicher: „Ich bin Südtiroler und kam am 17.12.1940 im Zuge der Umsiedlung nach Innsbruck.“ (Finkelgruen 1992, S. 90) Sein Opferstatus war laut Selbstauskunft noch ärger als anzunehmen: „1940 kam ich in Innsbruck zur Schutzpolizei … wurde … nach 14-tägigem Aufenthalt im Gefängnis Pankraz Prag nach Theresienstadt in das Polizeigefängnis kommandiert.“ Bei einer weiteren Anhörung erklärte Malloth, „er sei nie bei der SS oder beim SD gewesen. Er sei bei der Sicherheitspolizei gewesen und habe nur die Uniform des SD getragen“ (Finkelgruen 1992, S. 90). Nach einem Jahr Untersuchungshaft in Innsbruck wurde „die über Anton Malloth verhängte Auslieferungshaft wieder aufgehoben.“ Malloth fügte über das Ende seiner Tätigkeit in Theresienstadt hinzu: „Das Gefängnis wurde von den Tschechen übernommen. Ich habe mich mit diesen Tschechen soweit gut verstanden, und sie haben meiner Abfahrt auch nichts in den Weg gelegt.“ (ebd., S. 91)
Am 7.2.1948 teilte das Landgericht Innsbruck – „Betrifft: Auslieferungssache Anton Malloth“ – mit (Stempel vom 18.2.48), dass „der tschechoslowakischen Regierung für die Stellung eines Begehrens um Auslieferung des Anton Malloth eine Frist bis zum 1.5.1948 bestimmt worden ist“, deren Einhaltung „von hier aus“ überwacht werde. (PAV)
1948: Ein Todesurteil in der Tschechoslowakei gegen den „schönen Toni“
Im September 1948 wurde Malloth von einem tschechoslowakischen Gericht (Leitmeritz) in Abwesenheit angeklagt und am 24.9.48 zum Tode durch den Strang verurteilt. Die deutsche Übersetzung des Urteils, die sich im Privatarchiv Finkelgruens (PAF) befindet, ist 22 Seiten lang. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Malloth als NS-Vertreter ein brutaler, rücksichtloser Schläger war und in der Kleinen Festung Theresienstadt etwa hundert Häftlinge durch Schläge getötet habe. In scheinbarem Kontrast hierzu steht der Name Schöne Toni, den zahlreiche Häftlinge, Opfer von Malloths brutaler Willkür, Malloth verliehen hatten. Schöner Toni wurde Malloth von den Häftlingen bereits während seiner Zeit in Theresienstadt genannt, weil er im Konzentrationslager selbst während brutalster Misshandlungen ostentativ seine perfekte Kleidung zur Schau trug.
Ab 1948, nach seiner Verurteilung zum Tode durch ein tschechisches Gericht, lebte Malloth 40 Jahre lang relativ unbehelligt im italienischen Meran. Er besaß dort ein stattliches Haus, in dem er auch wohnte. In Schuberts autobiografischem Kinofilm Unterwegs als sicherer Ort (Schubert 1997) über Finkelgruens bewegte Vita sehen wir Finkelgruen und Schubert, wie sie gemeinsam vor Malloths Haus in Meran stehen. Erstmals sieht Finkelgruen den beschaulichen Ort, in dem der Mörder seines Großvaters Martin ungestört 40 Jahre seines Lebens verbracht hat, nach dem Todesurteil. Wenig später erleben wir Finkelgruen und Schubert im Film vor Malloths Münchner Altersheim; Fotos des inzwischen betagten Malloth werden eingeblendet: „Nein“, betont Finkelgruen im Film, eine direkte Konfrontation mit Malloth wolle er auf keinen Fall erleben. Dies wolle er sich auch nicht zumuten, seelisch. „Nein, das würde es nicht bringen“, konstatiert er lakonisch.
1949: Auslieferungshaft und ein Leben in Südtirol
Nach seiner Rückkehr nach Südtirol saß Malloth 1949 vorübergehend in Auslieferungshaft. Gegenüber der Innsbrucker Staatsanwaltschaft beteuerte er, „daß ich während meiner ganzen Dienstzeit keinen einzigen Menschen ermordet oder so mißhandelt habe, daß daraus dessen Tod erfolgte.“ (Spiegel, 1.6.1998) Die Behörden wollten die Angaben nicht einfach so glauben, forderten aus der Tschechoslowakei Prozessunterlagen an. Der Kalte Krieg begann, die Beziehungen zwischen den vier an Malloth „interessierten“ Staaten – Italien, Österreich, Deutschland sowie die Tschechoslowakei – waren nicht die Besten, deren strategischen und politischen Interessen waren höchst unterschiedlich. Für den Kriegsverbrecher Anton Malloth interessierte sich letztlich niemand mehr. Besagte Prozessunterlagen ließen drei Jahre nach dem Krieg auf sich warten – und der NS-Täter Malloth kam wieder frei.
Eine Zeitlang galt Malloth, so berichtete der Spiegel am 26.06.2000, auch als tot, „weil das Wiener Innenministerium deutschen Behörden irrtümlich mitgeteilt hatte, er sei nach dem Schuldspruch von Litomerice/Leitmeritz (September 1948) „hingerichtet worden“. Über Malloths Befindlichkeit während seiner Flucht in Schenna spekuliert Finkelgruen (1992, S. 38): „Er war zu Hause. Ich denke, er fühlte sich sicher. Er war bei den Seinen. Sie versteckten ihn. Sie schützten ihn. Er wußte, dass er sich auf sie verlassen konnte“ – um dann, auf seine eigene autobiografisch-familiäre Spurensuche Bezug nehmend, hinzuzufügen: „Je mehr ich den Spuren Anton Malloths folgte, desto klarer wurde mir, wie sehr er beschützt wurde.“ (ebd.)
Innsbruck, 15.1.1949: Entlassung aus der Auslieferungshaft
Am 15.1.1949 wurde Malloth in Innsbruck aus der Auslieferungshaft entlassen. Malloth ging, da er, durchaus begründet, eine erneute Verhaftung befürchtete, unverzüglich zurück nach Schenna, wo er untertauchte. Bereits 1949 hatten also, konstatiert Finkelgruen bitter, Richter und Staatsanwälte Malloth geholfen, einer Verurteilung zu entgehen. Bei jedem neu erlassenen Haftbefehl, bei jedem Steckbrief nach dem „Staatenlosen Anton Malloth“, wurde nun auf die laufende Fahndung verwiesen.
1949 – 1988: „Der Mörder muss einen Schutzengel gehabt haben“
Malloth widerrief nach eigenen Angaben am 20.1.1949 seine Option auf eine Staatsbürgerschaft in Deutschland und erhielt daraufhin am 11.3.1952 (nach anderen Angaben: am 1.3.1952) die italienische Staatsbürgerschaft zurück. Dies jedoch akzeptierten einige deutsche Verwaltungsbeamte nicht. So einfach könne niemand seine deutsche Staatsangehörigkeit verlieren: Ein „einseitiger Verzicht“ führe nicht automatisch „zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit“, vermerkten Spezialisten des Auswärtigen Amtes, so Der Spiegel (26.6.2000) im Rückblick auf diese unendliche Justizposse. Die Frage der Staatsangehörigkeit bildete für mehrere Jahrzehnte eine der juristischen Fallstricke bei den Gerichtsprozessen gegen Anton Malloth – bzw. sie scheinen insbesondere vom Dortmunder Oberstaatsanwalt Schacht dazu verwendet worden zu sein, so Finkelgruens Eindruck, um eine Verurteilung Malloths – bzw. dessen Übersendung an ein ausländisches Gericht – mit allen Mitteln zu verhindern. Es sei an dieser Stelle daran erinnert, wie schwer es für Finkelgruen und für zahlreiche weitere vertriebene deutsche Juden und Emigranten seinerzeit war, die deutsche Staatsbürgerschaft „wiederzuerlangen“ – obwohl sie diese i.d.R. nicht freiwillig abgegeben hatten: Sie waren als Juden ausgebürgert worden (s.u.). Auch Finkelgruen erhielt 1959, bei seiner „Rückkehr“ nach Deutschland, nicht seine Staatsbürgerurkunde zurück – sondern musste sich eine „neue“ ausstellen lassen.
Als Anton Malloth 1956 seine italienische Staatsangehörigkeit wieder aberkannt wurde ging der rechtskräftig Verurteilte einfach zum bundesdeutschen Generalkonsulat in Mailand – welches ihm unverzüglich, problemlos einen deutschen Pass ausstellte. Am 12.5.1962 meldete Malloth sich in Meran polizeilich an. Als Beruf gab er „Vertreter“, als Wohnsitz die Via Petrarca 30 an. Sein deutscher Pass hatte die Nummer 120 16 25. In den folgenden Jahrzehnten wurde der Pass mehrfach verlängert, erstmals im Februar 1973, obwohl deutsche und österreichische Justizbehörden wiederholt seine Auslieferung beantragten.
1964 Landesjustizverwaltung Ludwigsburg: Der höchst lebendige Tote mit dem Schutzengel
Ab 1964 verhandelte die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltung für NS-Verbrecher in Ludwigsburg ein Ermittlungsverfahren gegen das Wachpersonal der Kleinen Festung Theresienstadt. Am 18.6.1970 kamen sie in einem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass Malloth „als Aufseher in der Kleinen Festung an Folterungen und an der Ermordung zahlreicher Häftlinge teilgenommen“ habe (Schröm & Röpke 2002, S. 28). Daraufhin schlossen sie die Akten mit der Feststellung, dass Malloth 16 Jahre zuvor, am 24.9.1948, hingerichtet worden sei – obwohl die Gerichtsakten das Gegenteil besagten. Diese Behörde fahndete also ab 1964 nicht weiter, weil sie Malloth für tot erklärte.
Als bekannt wurde dass Malloth doch noch lebte änderte sich die Strategie der deutschen Behörden: Nun behaupteten sie, dass Malloth ein Deutscher sei – und dass damit frühere Gerichtsurteile gegen Malloth sowie diesbezügliche Auslieferungsersuche hinfällig seien. Die Solidarität der NS-Generation, so musste es dem Juden Finkelgruen zumindest erscheinen, war stärker als der Rechtsgedanke der demokratischen Rechtsstaates.
Um den Beschreibungen an dieser Stelle vorzugreifen: Der „Mörder Malloth“ muss – wie es die Schweizer Weltwoche am 8.3.1990 formulierte – „einen Schutzengel gehabt“ haben: Es wäre jedem deutschen Staatsanwalt ein Leichtes gewesen, den Sachverhalt bzgl. Malloths Staatsangehörigkeit festzustellen. Der mit Finkelgruen befreundete Kölner Schoah-Überlebende Ralph Giordano (vgl. Giordano 2012) betitelte seine in der Frankfurter Rundschau (9.1.1993) publizierten Buchbesprechung von Finkelgruens Haus Deutschland (s.u.) vor diesem Hintergrund mit Justiz-Schutz für Mörder. Aus dieser mit zorniger Feder verfassten Besprechung erwuchs ein Jahr später der Prozess von Oberstaatsanwalt Schacht gegen Giordano (sowie auch gegen Finkelgruen) (s.u.), der unter dem Begriff des „emotionslosen Ochsenfrosches“ in die politische Rechts- und Zeitgeschichte eingegangen ist. – Dieser geschichtsträchtige Gerichtsprozess zwischen Schacht und Giordano ist in diesem Themenschwerpunkt in einer weiteren Studie aufgearbeitet worden.
1968: Simon Wiesenthals Unterstützung
Simon Wiesenthal, Leiter des jüdischen Dokumentationszentrums am Wiener Rudolfsplatz, war, entgegen vereinzelter Justizäußerungen und vermutlich gezielt lancierter Falschmeldungen, Mitte der 1960er Jahre überzeugt davon, dass Malloth noch lebte. Mit Unterstützung des Mossad sowie zahlreicher Mitglieder jüdischer Gemeinden machte er sich auf die Suche nach Malloth. Mehr als zwei Jahrzehnte lang befasste er sich immer wieder mit dem „Fall Malloth“; mir liegen diverse Briefe Wiesenthals vor, u.a. vom 8.5.1973, 24.6.1976, 10.8.1988 und vom 21.12.1989; weiterhin Schreiben des Jerusalemer Büros (1 Mendele Street, Dr. Efraim Zuroff) des Simon Wiesenthal Centers u.a. vom 7.6.1999 an Günther Beckstein, seinerzeit bayrischer Staatsminister des Innern.[6] Malloth stand sogar seit 1958 auf der Fahndungsliste der „United Nations War Crimes Commission“ (UNWCC) der UN-Kommission für Kriegsverbrechen, was 40 Jahre später noch einmal in einer parlamentarischen Anfrage der Grünen-MdBs V. Beck und A. Buntenbach vom 27.11.1997 hervorgehoben wurde.[7] Seit dem 28.5.1958 wurde Malloth in Österreich per Steckbrief gesucht, der Druck auf Malloth hätte weiter zunehmen müssen. Zu diesem Zeitpunkt musste es schlicht als unvorstellbar erscheinen, dass die bundesdeutsche Justiz sich sogar 40 Jahre später nicht für diesen international gesuchten Kriegsverbrecher interessieren würde.
Wiesenthal 1968: „Malloth lebt in Meran!“
1968 wurde das tschechische Urteil gegen Malloth wieder aufgehoben. Malloth hatte jedoch bei seiner Erfassung durch bzw. in der CSSR einen neuen Prozess zu erwarten. Im gleichen Jahr stellte Simon Wiesenthal fest, dass Malloth im italienischen Meran lebte und dort von seiner Frau versteckt wurde. Wiesenthals nicht nachlassender Druck führte offenkundig dazu, dass die Dortmunder Staatsanwaltschaft 1970 ein Ermittlungsverfahren gegen Malloth und weiteres Aufsichtspersonal wegen „Misshandlungen und Tötungen von Gefangenen in der Kleinen Festung Theresienstadt“ einleiten musste. Dies war zugleich das erste derartige Verfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Die tschechischen Behörden schickten der Dortmunder Behörde hierfür eigene Unterlagen. Diese war also eigentlich bestens präpariert, verfügte über mehr als ausreichende Dokumente. Die Verurteilung Malloths wegen schwerer Kriegsverbrechen musste bereits 1970 als eine Selbstverständlichkeit erscheinen.
1972 lehnte Italien ein Auslieferungsersuchen mit dem Hinweis ab, dass es Malloth 1965 aus Italien ausgewiesen habe. Dennoch verlängerte die Deutsche Botschaft Malloth immer wieder seinen deutschen Pass. Seine Meraner Anschrift war den deutschen Behörden also durchaus bekannt.
Am 26.7.1972 wurde Malloth schließlich aus Italien ausgewiesen (vgl. Karny in Wiener Zeitung, 25.5.2001), lebte seitdem jedoch illegal in Meran. Gemäß Finkelgruens Standpunkt und dem seines Anwaltes war Malloth zu diesem Zeitpunkt staatenlos und hätte demgemäß an die CSSR ausgeliefert werden müssen, wo das verhängte Todesurteil immer noch gültig war. Sein Anwalt teilte dies dem Dortmunder Oberstaatsanwalt Klaus Schacht mehrfach mit – ergebnislos (vgl. auch Karny & Halbrainer 1996).
1973 wurde in Deutschland erstmals ein Ermittlungsverfahren gegen den ehemaligen SS-Oberscharführer eingeleitet. Die tschechischen Behörden schickten hierfür erneut Unterlagen an die Dortmunder Zentralstelle für die Bearbeitung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen. Vergeblich: Ab 1970, über 35 Jahre lang, unternahm die Zentralstelle dieser traditionell sozialdemokratischen Stadt Dortmund – die es in den Jahrzehnten danach zuließ, dass sie die NRW-Hauptstadt der Neonazismus wurde und mehrere Jahrzehnte lang immer wieder durch antisemitische Eklats teils weltweit Schlagzeilen machte (Kaufhold 2018a, 2018b, Kaufhold & Arndt 2018, Marken 2018) – absolut nichts gegen den zum Tode verurteilten NS-Täter Malloth, obwohl sogar dessen Meraner Wohnort wirklich kein Geheimnis war. Bereits sechs Jahre zuvor war in Köln gegen NS-Täter ermittelt worden. Immer wieder stellte die Dortmunder Zentralstelle das Gerichtsverfahren ein, mit der Begründung, es gäbe „keinen hinreichenden Tatverdacht“ – um das Verfahren dann, unter Druck, doch wieder neu aufzunehmen.
1973: Frederico Steinhaus, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Merans
Die Einstellung des Verfahrens empörte auch die Jüdische Kultusgemeinde in Meran. Deren Präsident, Frederico Steinhaus, übermittelte im April 1973 die Erkenntnisse zu Malloths Wohnort an das Bundeskanzleramt in Bonn. Von dort wanderte der Brief an das Bundesjustizministerium, welches am 2.5.1973 Frederico Steinhaus ein höchst erstaunliches Antwortschreiben schickte: „… darf ich Ihnen mitteilen, daß im Bundesministerium der Justiz keine Vorgänge über Anton Malloth ermittelt werden konnten.“ (Winkel 2001) Frederico Steinhaus unterstützte Finkelgruen in den nachfolgenden Jahrzehnten nachdrücklich. 22 Jahre später, am 9.6.1995 sowie am 31.8.1995, schickte Steinhaus in seiner Funktion als Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Merans Finkelgruen zwei im Stil persönlich gehaltene Faxschreiben, in denen er Finkelgruen, auf Grundlage eigener Nachforschungen in Meran, noch einmal die wichtigsten Daten über Malloths Lebensweg sowie dessen wechselnden Staatsangehörigkeiten bestätigte. Auch ein dankendes Antwortschreiben von Finkelgruen vom 19.6.1995 ist erhalten (PAF).
Steinhaus hebt in seinen Schreiben hervor, dass der italienische Staatsanwalt Dr. Cuno Tarfusser gerne – „sogar mit Begeisterung“ – bereit sei, zuständigen deutschen Gerichten alle entsprechenden Dokumente zu liefern. Tarfusser habe „1988 mit allen Kräften versucht, Malloth im Gefängnis zu halten.“ (Brief vom 9.6.1995, PAF) Einleitend formuliert Steinhaus seinen Optimismus – nach 22 (!) Jahren behördlichen versagens: „Lieber Herr Finkelgruen, diesmal scheint es, als wenn wir Glück hätten, und wenn die deutschen Behörden ihr Wort halten werden wir endlich den guten Malloth vor Gericht sehen!“ Elf Wochen später, am 31.8.1995, bestätigt er Finkelgruens per Fax („Die Akten sende ich heute per Post“), die Korrektheit von dessen Darstellungen in dessen Familienbiografie: „Soeben habe ich im Grundbuchamt die Akten abgeholt“: Der seit sieben Jahren, dank der fürsorglichen Unterstützung der Himmler-Tochter Burwitz, in der Pullacher Seniorenresidenz lebende Malloth – die Kosten zahlte das Münchner Sozialamt – sei „Nutznießer“ seines eigenen Hauses in Meran. 1976 hatte Malloth dieses formal, als juristischen Schutz, seiner gleichfalls in Meran lebenden Tochter Anneliese vermacht. „Auch Malloth´s Frau Aloisia ist Nutznießerin des Hauses.“ (PAF) (s.u.)
Wiesenthal 1973: „Der Genannte ist Inhaber des deutschen Passes Nr. 1201625“
Zurück zur zeitlichen Chronologie dieses „Falles“: Am 8.5.1973 legte Simon Wiesenthal den deutschen Ermittlern umfangreiche Materialien vor, insbesondere alle Informationen über Malloths Pässe. Er nannte ihnen auch Malloths Wohnort und dessen Meraner Anschrift. Wiesenthal schrieb den deutschen Behörden – rechtsstaatlich darauf vertrauend, dass diese ihrer Pflicht nachgehen würden: „Der Genannte ist Inhaber des deutschen Passes Nr. 1201625, ausgestellt vom Generalkonsulat in Mailand mit dem Datum vom 12. Feber 1968, gültig bis zum 12. Feber 1973 (vermutlich wieder verlängert). Die italienische Regierung hat ihn als unerwünscht erklärt, aber von Zeit zu Zeit taucht er in Italien auf, wird verhaftet, verhört, ausgewiesen und dann kommt er wieder. Seine Frau und Tochter leben nämlich in Meran.“ (Regele 2007)
Vergeblich.
Obwohl bzw. weil die Behörden den NS-Täter Malloth in Ruhe ließen insistierte Wiesenthal: Am 24.6.1976 wandte dieser sich schriftlich an den Oberstaatsanwalt Dr. Artzt von der Zentralem Stelle der Landesjustizverwaltungen in Ludwigsburg, verwies auf ihre einige Jahre andauernde Korrespondenz „in der Sache Malloth“ und teilte ihm mit, dass Malloth „wieder in der Bundesrepublik“ sei: „Er besitzt einen deutschen Pass.“ Weiterhin schickte Wiesenthal ihm Auszüge aus dem Buch „Terezin“, in dem er die Malloth betreffenden Passagen markierte.
Sieben Jahre später, 1983, erbrachte Wiesenthal mit einem Trick weitere unwiderlegbare Belege über Malloths Wohnort, indem er Malloth immer wieder kleine Beträge überwies, die Malloth persönlich abholte. Schröm & Röpkes Resümee (2002, S. 32) ist unzweideutig: „Für den Nazi-Jäger war es eine klare Angelegenheit, daß Malloth sowohl von deutschen als auch von italienischen Behörden gedeckt wurde.“ So suchte die italienische Polizei, weil Wiesenthal insistierte, im Mai 1976 Malloths Ehefrau auf und fragte sie, ob ihr Mann anwesend sei. Als diese dies verneinte begnügten sich die Polizisten mit dieser Auskunft. In den Akten – Schreiben des Polizeikommissariats Meran vom 31.5.1976 (PAF) – liest sich dies so: „…Bis zum 26. Juli 1972 hat der Vorgenannte als Vertreter der Firma Ratschiller, Bozen, gearbeitet. Gleichzeitig hat er auch Arbeiten für die Firma PLUNGER, Bozen durchgeführt. Am 26. Juli 1972 wurde er durch das Polizeipräsidium Bozen, bei dem er nach seiner Ausfindigmachung an dem vorgenannten Datum vorgeführt wurde, aus Italien ausgewiesen. Aufgrund der durchgeführten Ermittlungen hat sich herausgestellt, dass der Antonio Malloth nicht mehr in der Stadt Meran gesehen worden ist.“ Malloths familiäre Lebenssituation – er lebte mit seiner Ehefrau Aloisia zusammen, seine Tochter Anneliese arbeitete als Lehrerin in Verona – wird beschrieben (s.o.), und dann wurde hinzu gefügt: „Die Ehefrau, die über die augenblickliche Anschrift des Ehemannes befragt worden ist, hat sich geweigert, zu antworten und sich darauf beschränkt, zu sagen, dass sie nicht weiss, wo sich der Ehemann aufhält.“ Unterschrieben ist das Dokument mit „Der Leiter der Kriminalpolizei“. Dabei beließ es die Behörde. Bereits am nächsten Tag unterzeichnete der Amtsgerichtsrat eine Erklärung, „dass der Malloth seit Juli 1972 nicht mehr in Meran gesehen worden ist und dass sein augenblicklicher Aufenthaltsort unbekannt ist.“ (PAF)
Der verurteilte Kriegsverbrecher Malloth lebte zwölf weitere Jahre – nicht, wie andere untergetauchte Kriegsverbrecher, wie etwa Brunner und Eichmann, in totalitären Staaten Südamerikas – sondern im Herzen Europas: In Italien. Es gab keine weiteren Versuche, Malloth zu finden.
Über ein Jahrzehnt lang ruhten die Akten – bis 1988. Der Impuls zur Wiederaufnahme des Strafprozesses kam von Peter Finkelgruen.
Oktober 1988: Abschiebung Malloths mit dem Flugzeug von Italien nach Deutschland
Im Februar 1988 wurde der Fall Malloth auf Initiative des italienischen Grünen Abgeordneten Marco Boato sogar im italienischen Parlament erörtert; einige Jahre später sollten insbesondere Grüne Bundestags- sowie Landtagsabgeordnete aus NRW und Bayern (u. a. Brigitte Schumacher, Annelie Buntenbach, Volker Beck, A. Beer, Sophie Rieger) Finkelgruens Initiativen aufgreifen und politisch-publizistisch unterstützen. Der Handlungsdruck auf die Justiz und Politik nahm endlich wieder zu:
Am 5.8.1988 rief der Bozener Staatsanwalt Cuno Tarfusser – der 1954 Geborene sollte knapp zwei Jahrzehnte später, im Jahr 2009 Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag werden – Klaus Schacht an und teilte ihm mit, dass sie Malloth aufgegriffen hätten. Dieser habe einen abgelaufenen deutschen Pass bei sich. Da Malloth sich illegal in Italien aufhalte würden sie ihn nun nach Deutschland abschieben. Über 40 Jahre waren zwischenzeitlich vergangen. Schacht, der sein Beamtengehalt eigentlich dafür erhielt, nationalsozialistische Kriegsverbrecher zu verfolgen, teilte seinem italienischen Kollegen zu dessen ausgeprägter Überraschung jedoch mit, dass kein Haftbefehl gegen Malloth vorliege und dass er diesen auch nicht beantragen könne, da kein dringender Tatverdacht vorliege.
Vergeblich: Am 10.8.1988 wurde der inzwischen 76-jährige Malloth auf Initiative von Tarfusser von Verona aus nach München abgeschoben (Regele 2007). Die früheren strafrechtlichen Verurteilungen Malloths waren den Verantwortlichen offenkundig sehr bewusst. Diese galt es zu umgehen – um den NS-Täter Malloth „sicher“ nach Deutschland zu verbringen. Die Auslieferungsanträge nach Österreich bzw. in die Tschechoslowakei wurden ignoriert. Da in Österreich weiterhin ein Strafbefehl gegen Malloth vorlag wurde Malloth nicht mit der Bahn, sondern mit dem Flugzeug direkt nach Deutschland verbracht. Österreichisches Territorium musste er so nicht betreten. Seine Inhaftierung in Österreich wurde so verhindert.
Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz und deren Stille Hilfe
Als der NS-Täter und rechtskräftig zum Tode Verurteilte nun, 41 Jahre später, in München ankam blieb er auf freiem Fuß. Malloths anfängliche Sorgen erwiesen sich wieder einmal als unbegründet. Und er hatte alte Freunde, „nationale“ Freunde. Der NS-Verbrecher Malloth bekam kurz nach seiner „Rückkehr“ nach Deutschland äußerst prominenten Besuch: Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz vom steuerbegünstigten nationalsozialistischen Hilfeverein Stillen Hilfe[8] nahm nun direkten Kontakt mit ihrem prominenten Gesinnungsgenossen auf. Sie und ihr wirkmächtiger, im sehr rechten und rechtsradikalen Milieu gut verankerter nationalsozialistischer Unterstützerverein sicherte dem bedrohten NS-Mann eine klandestine, aber dennoch höchst wirksame juristische und materielle Unterstützung zu. Ihr der „guten Tradition“ geschuldetes Versprechen sollte die Tochter Heinrich Himmlers auch einhalten: Sie besorgte dem Mörder Anton Malloth kurz danach einen Platz in einem gut situierten München-Pullacher Altersheim und kümmerte sich um dessen Finanzierung durch die Münchner Sozialbehörde – obwohl Malloth weiterhin Besitzer eines mondänen Hauses in Turin war (s.o.). Malloths Ehefrau und dessen Tochter setzten Burwitz Stille Hilfe daraufhin als Alleinerbin von Malloths Münchner Nachlass ein.
Als Simon Wiesenthal vom unbehelligten, privilegierten Neubeginn Malloths in München erfuhr war dies selbst dem kampferprobten 79-jährigen „Nazijäger“ zu viel: Er rief Oberstaatsanwalt Schacht direkt an, um an die von ihm gesammelten Dokumente über Malloths Verantwortung für mehrere Morde zu erinnern. Als Wiesenthal sah, dass seine Bemühungen vergeblich waren schickte er Schacht am 10.8.1988 diese Dokumente mit Begleitbrief noch einmal zu. Wiesenthal schrieb Schacht:
„Im Anschluss an unser Telefongespräch übersende ich Ihnen beiliegend eine Reihe von Unterlagen: Ausschreibung von Malloth des Landgerichtes Innsbruck; Berichte über den Prozeß gegen Rojko, der 1963 vom Landesgericht Graz zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt wurde; Brief und Zeugenaussage von Frau Valy Sperl, Los Angeles. (…) Beurteilung der Geheimen Staatspolizei in Prag vom Oktober 1940 über Malloth und sein handgeschriebener Lebenslauf.“ Auch die im Brief erwähnten Dokumente lagen dem Schreiben als Kopie bei. (PAF)
Zusätzlich wandte Simon Wiesenthal sich an weitere, thematisch interessierte Institutionen: Die nationalsozialistischen Morde waren eine historische Realität. Daran vermochte der Shoah-Überlebende Wiesenthal nichts mehr zu ändern. Aber der Kampf für die historische Gerechtigkeit, für den Schutz der Opfer, den wollte und musste der jüdische Überlebende von Mauthausen Wiesenthal und im hohen Alter vielgefragte Zeitzeuge weiter ausfechten – wie auch Finkelgruens Kölner Freund Ralph Giordano (Kaufhold 2013a, 2013b). Für Finkelgruen war deren solidarische Unterstützung nahezu lebensrettend. Auf beide vermochte er zeitlebens zu setzen, wie auch auf seine FDP-Freunde Gerhard Baum (Baum 1981/2020, Baum 2019(2020) und Ulrich Klug (Kaufhold 2018d, e).
Am 12.8.1988, zwei Tage nach Malloths Auslieferung von Italien nach Deutschland, gab der Botschafter der CSSR eine im diplomatischen Stil formulierte Erklärung ab, die die indirekte Bitte enthielt, Malloth an die CSSR auszuliefern, damit ihm dort noch einmal der Prozess gemacht werde – diesmal jedoch in seiner Anwesenheit. In weniger diplomatischen Stil forderte der Botschafter von den Deutschen, über den weiteren Verlauf des Verfahrens in Kenntnis gesetzt zu werden.
Heinz Galinski, Vorsitzender des Zentralrats der Juden, reagierte zeitgleich nicht mehr diplomatisch, sondern empört auf diese Entwicklung. Obwohl Galinski sich ansonsten eher nicht in innerdeutsche Diskussionen einmischte sprach er nun von einem „ganz unwürdigen und beschämenden Verfahren“ und drohte mit einer Intervention beim Bundesjustizministerium (Schröm & Röpke 2002, S. 34, Neues Deutschland, 13.8.1988).
1988: „Mein Entschluss hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte…“
Nach der Lektüre des „Vernehmungsprotokolls“ des Dortmunder Oberstaatsanwaltes Schacht vom 22./23.8.1988 mit Malloth verfasste Finkelgruen eine einfühlsam formulierte Einschätzung von Malloths Entwicklung: Er versuchte, wohl um das aufsteigende, innere und erinnerte Entsetzen und die Empörung seelisch zu ertragen, die Motive, den Lebensweg des Mörders seines Großvaters Martin zu verstehen. Finkelgruen führte aus:
„Der Geselle Malloth erkannte die Chance, die ihm der deutsche Faschismus bot. Sein „Aufstieg“ in den Zeiten des Rassismus und brutalen Antisemitismus begann.“ Und: „Anton Malloth erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde aus der italienischen Armee entlassen. Im Gefühl, endlich dazuzugehören, wurde er jemand anders. Er war kein erfolgloses Nichts mehr, jetzt war er Teil von etwas Besserem, etwas Stärkerem. Er war als Österreicher geboren. Genau wie der Gefreite. Der Kaiser hatte sich als Verlierer erwiesen. Zu den Verlierern gehören, das wollte Anton Malloth nicht. Davon hatte er genug. Jetzt sollte es aufwärts gehen. Nicht nur mit den anderen. Auch mit ihm. Er war bereit, seinen Einsatz zu bringen. Sie sollten sich auf ihn verlassen können. Er wollte sich auch auf sie verlassen. Er wollte nicht enttäuscht werden. Sie würden sich für ihn einsetzen. Bis zum Schluss. Klaus Schacht unterbrach die Vernehmung des Anton Malloth um 18 Uhr.“ (Finkelgruen 1992, S. 52) Am nächsten Morgen um 9.20 sollte Schacht die Vernehmung fortsetzen.
Gegenüber Oberstaatsanwalt Klaus Schacht stellte sich der 40 Jahre zuvor wegen schwerer NS-Verbrechen zum Tode verurteilte, inzwischen 76-jährige Malloth am 22.8.1988 als ein unpolitisches, eher gutgläubiges Opfer widriger Umstände dar, das „für Deutschland optiert“ habe, „weniger weil ich mich für Hitlers Politik besonders interessiert hätte; ich kannte ihn kaum“ (Finkelgruen 1992, S. 54, Hervorheb. RK). Malloth, so dessen juristisch geschulte Selbstdarstellung – die Juristen aus Burwitz´ “Stiller Hilfe“ dürften da mitformuliert haben – , „erhielt die deutsche Staatsbürgerschaft. Dadurch bin ich auch aus der italienischen Armee entlassen worden.“ Der für die Verfolgung für NS-Täter Verantwortliche, Dortmunds Oberstaatsanwalt Schacht, begnügte sich mit dieser Selbstauskunft. Der Mörder Malloth war für Schacht offenkundig noch nicht einmal ein Anhänger Hitlers. Deutschland erschien dem nordrheinwestfälischen Oberstaatsanwalt, so könnte es erscheinen, als ein Land von Widerständlern und Oppositionellen. Malloth war offenkundig ein „Opfer widriger Umstände“, wenn nicht sogar ein Opfer von Hitler selbst.
Der NS-Täter Malloth fügte, sogar den Antisemitismus als Motiv in Abrede stellend, in seiner Vernehmung durch Schacht noch hinzu: „Mein Entschluß, mich zur Grenzpolizei zu melden, hatte auch nichts damit zu tun, dass ich das Judentum bekämpfen wollte. Mein Jugendtraum war es eigentlich immer gewesen, Kriminalist zu werden. (…) Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich auch nie der SS angehört habe, obgleich ich gelegentlich als SS-Mann bezeichnet worden bin. Als Polizeibeamter hatte ich natürlich den entsprechenden SS-Angleichungsgrad, und zwar Scharführer. Ich trug auch die SS-Uniform der Polizeibeamten. Eigentliches Mitglied der SS bin ich aber nie gewesen.“ (Finkelgruen 1992, S. 55, Hervorheb. RK)
Finkelgruen weist ergänzend darauf hin, dass das SD-Sonderkommando Prag eine Sonderdienststelle war, die eigens für die Besetzung von Böhmen und Mähren gebildet worden war. Schacht hätte dies wissen müssen, hatte Malloth doch bei seiner ersten Vernehmung in Innsbruck, vor Verkündung des Urteils in Leitmeritz, ausgesagt: „Das Polizeigefängnis Theresienstadt unterstand direkt der Gestapo in Prag.“
Noch ein halbes Jahrhundert später konnte „man“ sich aufeinander verlassen, so mein Eindruck. Die Loyalitäten, die gemeinsamen Interessen und Verbundenheiten bestanden fort und wirkten weiter. Es gab letztlich nur einen, der diesen kollektiven Frieden hartnäckig störte: Der Jude, der Rückkehrer Finkelgruen. Er störte den kollektiven Verdrängungsprozess. Diese Erfahrung hatte er bereits in den Jahren von 1978 bis 1984 gemacht, als er auf das Schicksal der widerständigen, unangepassten Kölner Edelweißpiraten https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/die-unangepassten/ aufmerksam wurde und als einer der ersten Publizisten einige von ihnen – vor allem seinen Freund Jean Jülich https://www.hagalil.com/2011/12/juelich-2/ – zum Sprechen und zum Wiedererinnern ermutigte (vgl. Finkelgruen 2020, Kaufhold 2020).
Exkurs Staatsbürgerschaften: Die Freiburger Richter „waren die ersten, die mir nahebrachten, dass Rückkehrer nicht wirklich gewollt waren“
Überlebende der Shoah bzw. deren Nachkommen kämpften, daran sei erinnert, hingegen überwiegend vergeblich um eine auch nur bescheidene Rente bzw. „Wiedergutmachung“ (vgl. Kaufhold 2020). Auch Peter Finkelgruen erhielt, als er 1959 – da war er 17 – gemeinsam mit seiner inzwischen 68-jährigen, schwer kranken und durch die dreijährige KZ-Zeit traumatisierten Großmutter Anna nach Freiburg ging, keine Entschädigung für den Tod seines Vaters sowie die Ermordung seines Großvaters: Am 27.2.1960, seinerzeit lebte Finkelgruen noch als Untermieter bei der Mussolini–Biografin Louise Diel[9], hatten ihm die Anwälte in Berlin lapidar mitgeteilt, dass sein Wiedergutmachungsantrag wegen der Martin Finkelgruen in Bamberg weggenommenen Besitztümer umfänglich abgelehnt worden sei: „In der Akte der Ansprüche nach Herrn Martin Finkelgruen hat das Amt festgestellt, daß Ansprüche wegen Vermögensschadens nicht in Betracht kommen… In diesem Fall werden wir die Bearbeitung einstellen und die Akte weglegen.“ (Finkelgruen 1997, S. 59)
In jenen Anfangsjahren in dem ihm anfangs vollständig fremden Deutschland, um das Jahr 1960 herum, als Finkelgruen bei seiner Vermieterin Diel den jüdischen Bankier Tuchler kennenlernte, hatte er gemäß den Bestimmungen des Bundesentschädigungsgesetzes einen Antrag auf eine Soforthilfe von 5000 Mark gestellt; dieser stand Rückkehrern eigentlich zu. Der 18-jährige Finkelgruen nahm die Pässe seiner Eltern, seine Geburts- und Einbürgerungsurkunde und ging, ohne juristischen Beistand, zum zuständigen Wiedergutmachungsamt. Er vertraute Deutschland, wie er mir gegenüber in persönlichen Gesprächen mehrfach betont hat. Der Großteil der dort tätigen Beamten war, das galt für alle deutschen Behörden, bereits in der Nazizeit tätig gewesen. Finkelgruen schilderte dem für „Wiedergutmachung“ zuständigen Beamten die Entrechtung und Verfolgung seiner Familie und legte die Dokumente vor. Dann geschah Unglaubliches und doch letztlich Alltägliches: „Als ich ihm die deutschen Reisepässe meiner Eltern vorlegte, blickte er diese sehr interessiert und aufmerksam an, blätterte sie durch und staunte über die fremden Visa und Stempel die (…) die lange Flucht meiner Eltern belegten. Dann griff er zum Kugelschreiber und zog, auf- und abwärts, von links nach rechts, Striche durch das auf dem Reisepass meines Vaters aufgedruckte Hakenkreuz. Das gelte ja heute nicht mehr, sei verboten.“ (Finkelgruen 1997, S. 152) Finkelgruen realisierte den Übergriff, die Auslöschung seiner Wirklichkeit, seiner familiären Geschichte. Die Unrechtmäßigkeit dieses Handelns erkannte er – und blieb doch wehrlos, wie gelähmt: „Ich hatte ein Unwohlgefühl, das sich als berechtigt erweisen sollte. Ebenso freundlich, wie er zuvor gelächelt hatte, ließ er mich wissen, dass meinem Anspruch auf Soforthilfe für Rückkehrer nicht entsprochen werden könne.“ (ebd.) Finkelgruen sei nicht in Deutschland geboren, dementsprechend könne er nicht als Rückkehrer behandelt werden. Er werde den Antrag auf jeden Fall ablehnen. Der gerade erst 18-jährige Peter Finkelgruen klagte dagegen, ohne juristischen Beistand. Der Antrag des Juden, des jüdischen „Rückkehrers“, der die deutschen Beamten durch seinen Antrag auf „Wiedergutmachung“ an die „unrühmliche“ Vergangenheit erinnerte, wurde abgelehnt: Die Freiburger Richter „waren die ersten, die mir nahebrachten, dass Rückkehrer nicht wirklich gewollt waren“, kommentiert er im Rückblick (Finkelgruen 1992, S. 153). Der junge Jude und Rückkehrer Finkelgruen personifizierte für diese Generation der Täter und Mitläufer das kollektive deutsche Unbehagen über „die Juden“, das latente Gefühl des „Bedroht-Sein“. Ihre eigenen furchtbaren Verbrechen an den Juden bereiteten ihnen hingegen weniger Unbehagen. Der junge, formal noch nicht mündige Finkelgruen personalisierte in seiner Person und Vita – um ein zentrales antisemitisches Ressentiment zu verwenden – das Fantasma der „jüdischen Rachsucht“. Der Jude, der Rückkehrer war die Gefahr. Wäre er nicht gekommen, wäre Finkelgruen in Israel geblieben, wäre alles entschieden einfacher. Hunderte von Studien über den „primären“ und den „sekundären Antisemitismus“ sind über dieses beeindruckende deutsche Phänomen geschrieben worden – vergeblich.
Man fühlt sich an dieser Stelle, um die Brücke zur bundesdeutschen Wirklichkeit des Jahres 2016 zu schlagen, an das unermüdliche Engagement des Essener Sozialrichters Jan-Robert von Renesse erinnert: Über sehr viele Jahre engagierte sich dieser mutige, engagierte Richter für eine angemessene juristische und menschliche Gestaltung der Entschädigungsverfahren, führte immer wieder persönliche Gespräche mit NS-Verfolgten, reiste nach Israel, um ehemals rassistisch Verfolgte persönlich anzuhören, ihnen hierdurch zumindest symbolisch Respekt, Anerkennung zu zeigen – und wurde deshalb über Jahre hinweg vom sozialdemokratisch dominierten NRW-Justizministerium auf kaum erträgliche Weise drangsaliert: In Israel war von Renesse hoch geachtet, wurde vielfach geehrt – in seinem Heimatland hingegen wurde er über Jahre und systematisch anmutend juristisch und disziplinarrechtlich attackiert (Richter 2010). Seine Existenz stand auf dem Spiel. Ein justizinternes Verfahren gegen ihn wurde erst 2016 in einem Vergleich abgeschlossen. In einem offenen Brief hatten sich kurz zuvor zahlreiche Prominente nachdrücklich für Renesses Rehabilitation eingesetzt: „Richter Renesse hat Empathie gezeigt“ war ihr eindrücklicher, an die NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft gerichteter Appell überschrieben (Jüdische Allgemeine, 29.08.2016).
Bestätigt werden Finkelgruens eigene Erfahrungen auch durch neue Forschungen zur NS-Geschichte des Justizsystems in NRW: Laut einer neue Studie der Bochumer Dokumentations- und Forschungsstelle der Sozialversicherungsträger waren von 169 Sozialrichtern „29 mehr oder minder belastet“ und trotz ihrer NS-Vergangenheit nach dem Krieg wieder im Justizdienst untergekommen. Das seien mehr „als dies angesichts des Forschungsstands zur NS-Belastung in der westdeutschen Justiz zu erwarten stand“, so Hans-Ulrich Dillmann (4.1.2017) in der Jüdischen Allgemeinen.
Um zu Malloth zurück zu kommen: Malloths Altersheim, dies sei nachgetragen, war auf einem Grundstück erbaut worden, das während der NS-Zeit Rudolf Hess gehört hatte. Unterstützt wurde Malloth auch in den nachfolgenden Jahren weiterhin und kontinuierlich durch Gudrun Burwitz´ nationalsozialistische Hilfeorganisation Stille Hilfe.
Alle, nachfolgend sowie in Finkelgruens (1992, 1997) beiden autobiografischen Büchern und seinen diesbezüglichen Aufsätzen (Finkelgruen 2002) beschriebenen Versuche, eine Verurteilung Malloths wegen vielfachen Mordes zu erreichen, scheiterten an der Dortmunder Staatsanwaltschaft. Bewegung in die Sache kam erst im Jahr 2000, als die Münchner Staatsanwaltschaft den Fall übernahm (s.u.). Im sozialdemokratischen NRW durfte Malloth sich hingegen sicher fühlen.
Piräus, August 1988: Eine Zeitungslektüre
Kommen wir zurück zu Peter Finkelgruens Lebensweg. August 1988: Peter Finkelgruen befindet sich auf der Rückfahrt per Schiff von Israel nach Deutschland. Es ist eine Bootsfahrt, die Finkelgruen mehrfach beschrieben hat (Finkelgruen 1992, Schubert 1997). Für den seinerzeit 46-Jährigen ereignete sich auf dieser Bootsfahrt zurück nach Deutschland die wohl schicksalhafteste Szene seines Lebens: Sie verband ihn für immer mit dem Wissen um den Mord an seinem jüdischen Großvater. Ein Mord, der auch für ihn selbst als Kleinkind vorgesehen war: Die im Shanghai lebenden deutschen Nationalsozialisten, Mitglieder der Shanghaier NSDAP/AO, entwickelten kurz nach seiner Geburt in Shanghai einen detaillierten Plan, alle deutschen und jüdischen Exilanten, einschließlich der etwa 250 in Shanghai geborenen Babys, zu ermorden. Finkelgruen musste 50 Jahre alt werden, bis ihn diese schickhafte Erkenntnis beim Abfassen seiner Familienbiografie überrollte.
Sommer 1988: Es ist ein sonniger Tag, nach sieben Jahren bereitet sich Finkelgruen innerlich auf sein neues Leben, nun wieder in Köln, vor. Hierfür benötigt er Zeit – und Abstand zu den aufregenden, vom Geiste der Hoffnung durchtränkten produktiven Jahre in Jerusalem. Die zahlreichen Tonbänder seiner regelmäßigen Gespräche mit sieben palästinensischen Politikern und Intellektuellen sowie mit sieben israelischen Politikern befinden sich in seinem umfangreichen Reisegepäck. Vier Tage dauert seine Rückreise auf der Paloma bereits. Im Hafen von Piräus macht sein Boot einen Stop. Finkelgruen verlässt es und kauft sich eine deutsche Tageszeitung: Die Süddeutsche Zeitung, weiterhin die für ihn seinerzeit unverzichtbaren Zigaretten. Dort liest er, es ist purer Zufall, eine Kurzmeldung über einen gesuchten NS-Täter, liest auch dessen Namen, der ihm seinerzeit noch nichts sagte. Die Kurzmeldung, auf Seite 5, handelte von Anton Malloth: „Der 1948 in der CSSR als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilte Anton Malloth ist von Italien in die Bundesrepublik abgeschoben worden“ schreibt die SZ. Und die taz titelt am 11.8.1988: „SS-Malloth in München. Nazi-Kriegsverbrecher gestern aus Italien abgeschoben / Staatsanwaltschaft: „Kein dringender Tatverdacht“ / Er soll nur zur Vernehmung vorgeladen werden.“
Die Dortmunder Staatsanwaltschaft habe „kein Interesse“ an der Auslieferung Malloths gehabt, da „kein dringender Tatverdacht“ bestehe (Finkelgruen 1992, S. 11). Die Kurzmeldung bedeutete ihm anfangs nicht viel: Finkelgruen hat Tausende vergleichbarer Meldungen über NS-Täter und Mitläufer gelesen und viele davon in Aktenordnern gesammelt. Ein Detail nistete sich jedoch in seinem Unterbewusstsein ein, alarmierte ihn: Der Aufseher habe im Gestapo-Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt gearbeitet. Dieses kannte Finkelgruen: Dort war sein Großvater ermordet worden, was ihm Anna, Martin Finkelgruens Lebensgefährtin und solidarische Beschützerin, mehrfach erzählt hatte. Und Anna hat ihm wirklich nicht viel erzählt über seine verwirrende Familiengeschichte. Dies jedoch schon. Die Ermordung seines Großvaters hatte sie ihm in Israel mehrfach beschrieben.
Diese Nachricht lässt ihm keine Ruhe mehr. Sein gesunder, realitätsangemessener Verdrängungsmechanismus funktioniert nicht mehr. Finkelgruen beginnt über den „Fall Malloth“ zu recherchieren, sucht hierfür in Prag, wo er als jüdisches Emigrantenkind fünf Jahre lang gelebt hatte, Zeitzeugen, Weggefährtinnen seiner Großmutter auf, die etwas über den Mörder und den Mord wissen könnten.
Der Mörder: „Ich bin einer von euch“
Ein halbes Jahr später, im Februar 1989, erfährt Finkelgruen bei einem Besuch in Prag bei „Tante Bela“ – Bela Krausova – die näheren Umstände des Mordes (vgl. Finkelgruen 1992, S. 39-44, 50-54). Finkelgruen schreibt über dieses Treffen:

„Tante Bela hatte meine Großmutter in der Kleinen Festung Theresienstadt kennengelernt, nachdem diese zusammen mit Martin und einer Frau namens Neumann eingeliefert worden war. Bela erlebte, wie Anna an diesem und den nächsten Tagen ununterbrochen weinte. Martin war tot. Ihre Welt war zusammengebrochen, die Hoffnung und der Wunsch nach ein wenig Glück, Geborgenheit und Zufriedenheit waren endgültig zerstört. Man hatte ihr nicht gesagt, auf welche Weise Martin gleich nach der Einlieferung in der Kleinen Festung zu Tode gekommen war. Man hatte, wie Bela später sagte, es nicht gewagt. Sie war nicht ansprechbar gewesen. Man fürchtete, Anna würde die Nachricht nicht ertragen können.“ (Finkelgruen 1992, S. 50f.)
Das Wissen um die Umstände seiner traumatischen Familiengeschichte löste zugleich, dies sei nur angedeutet, Finkelgruens frühkindlichen Traumatisierungen wieder aus – in einer Stärke, wie es sie nicht erwartet hatte. Die Untätigkeit der deutschen Justiz, im Zentrum der sozialdemokratischen Metropole Dortmund, verstärkte die Traumatisierung. Es war die gleiche SPD-dominierte NRW-Justizverwaltung, die Jahrzehnte später ihren – man muss es so formulieren – verbissenen Kampf gegen den humanen, um Verständnis, um historisch-biografische „Gerechtigkeit“ bemühten Richter Jan-Robert von Renesse führen sollte (DLF, 18.03.2016) (s.o.). Ein für Rentenzahlungen an Zwangsarbeiter in Ghettos während der Nazizeit zuständiger Richter, entsprechend der, wie es im Behördendeutsch wohl heißt, „Regelungen des Ghettorentengesetzes“: „Von den etwa 70.000 Anträgen auf Zahlung einer Ghettorente lehnten die deutschen Rententräger 96 % ab. Von Renesse führt dies auf die verfolgungsbedingte Beweisnot der Ghettoüberlebenden zurück, die „meist nichts anderes als die auf dem Arm eintätowierte KZ-Nummer (…) als Beweis hatten.“ Die Tätigkeit der deutschen Behörden fasste von Renesse wie folgt zusammen: „Ihren eigenen Berichten [der Ghettoüberlebenden] hörte die deutsche Bürokratie – die allein auf ungeeignete Formulare oder alte deutsche Akten vertraute – gar nicht erst persönlich zu und schenkte ihnen auch sonst keinen Glauben.“, wie es im aktuellen Wikipedia-Beitrag über von Renesse heißt.
Dennoch vermochte Finkelgruen (1992, 1997) seine beiden autobiografischen Bücher abzuschließen.
Die Zeugenaussage der 90-jährigen Bela Krausova im Februar 1989 in Prag veranlasste Finkelgruen, bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft Strafanzeige einzureichen. Parallel hierzu machte man ihn auf eine Fernsehsendung aufmerksam, in der Malloths Rückkehr „heim ins Reich“ (Finkelgruen 1992, S. 39), mit Fotos untermalt, filmisch nachgezeichnet wurde. Finkelgruen wandte sich an die Redaktion, erhielt zahlreiche Dokumente, darunter eine „Verfügung des Leiters der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen für die Bearbeitung von nationalsozialistischen Massenverbrechen bei der Staatsanwaltschaft Dortmund vom 23. April 1979“ (ebd., S. 41): Auf 248 Schreibmaschinenseiten wurden 764 „Fälle von Mord“ aufgeführt, in der auch die Namen der Täter aufgeführt werden: Jöckel, Rojko, Wachholz – und auch Malloth.
Finkelgruen beschreibt seine eigene Reaktion auf diese Fernsehdokumentation in dieser Weise: „So sah ich Anton Malloth zum erstenmal. Ein älterer Mann in leichter Sommerkleidung, mit hellem Hut, trat von der Gangway, unsicher und wie fragend um sich schauend: Was geschieht jetzt? Werdet ihr mich annehmen? Mich beschützen? Schließlich habe ich meine Treue unter Beweis gestellt. Ich bin einer von euch.“ (Finkelgruen 1992, S. 40)
Die Himmler-Tochter Gudrun Burwitz wartete bereits auf ihn.
1988 – 2000: Der Altersruhesitz: „Ab 16.6.1989 lautet meine Anschrift: Haus am Wiesenweg, Wiesenweg 5, 8023 Pullach“
Seit 1988 lebte der 76-jährige Malloth ungestört und umsorgt in München, zwölf Jahre lang. Auf Vermittlung der nationalsozialistischen „Stillen Hilfe“ lebte Malloth ab Juni 1989 in einem am Stadtrand von München – in Pullach – gelegenen gediegenen Altersheim. Obwohl er in Meran weiterhin ein Haus besaß bezahlten die Münchner Sozialbehörden seinen Altersruhesitz. Das durchaus stattliche Haus an der Petrarca-Straße war Mitte der 70er Jahre 45.000 Euro wert (Der Spiegel, 26.06.2000). Als Anton Malloth erstmals von der Bitte der Dortmunder Staatsanwaltschaft um Amtshilfe erfuhr – also erstmals überhaupt um seine Sicherheit besorgt sein musste – , begab er sich unverzüglich zu einem italienischen Notar und vermachte sein Haus seiner Tochter.
Als Reaktion auf die Anklage wegen Mordes gegen ihn schickte Malloth am 14.6.89 (Anschrift: Franziskanerstr. 17, 8000 München) einen Brief an die Dortmunder Staatsanwaltschaft, auf das Aktenzeichen 45 JS 25/70 Bezug nehmend, und teilte mit: „Ab 16.6.1989 lautet meine Anschrift: Haus am Wiesenweg, Wiesenweg 5, 8023 Pullach“ (PAF)[10]. Er fügte eine Kopie der amtlichen Bescheinigung der „Commune DI Scena/Gemeinde Schenna“ vom 26.9.1995 bei, gemäß der er am 16.12.39 „für die deutsche Staatsbürgerschaft optiert“, diese Option jedoch am 29.1.49 widerrufen habe.
1988: Eine Monitor-Dokumentation und die ZEIT: „Kein dringender Tatverdacht“
Am 8.11.1988, also nach Malloths Abschiebung, brachte das Fernsehmagazin Monitor einen kurzen Beitrag über Malloth – bzw. über die höchst wundersamen Umstände, die 40 Jahre lang eine Festnahme dieses bereits rechtskräftig verurteilten NS-Mörders verhindert hatten. Nun war Malloth auch für andere Medien ein öffentliches Thema: „Der Mörder, der offenbar einen Schutzengel hat“ titelte die Weltwoche (8.3.1990). Und die ZEIT (2.2.1990) konstatierte: „Kein dringender Tatverdacht. Der Fall Malloth: Wie ein KZ-Aufseher unbehelligt davonkam.“
Es lohnt sich, um die unendliche Malloth-Geschichte zu verstehen, die Folgewirkungen des Monitor-Fernsehbeitrages kurz zu skizzieren: Am 7.3.1990 tagte der Rechtsausschuss des Landtages NRW; auch in dessen Sitzung (es war laut Protokoll die 56.te), also 16 Monate nach Ausstrahlung des Monitor-Beitrages, wurde dort noch einmal ausführlich auf den Fernsehbeitrag Bezug genommen (Ausschussprotokoll 10/1478). Der CDU-Abgeordnete Klose monierte in dieser Sitzung, „dass mit der Berichterstattung über den Fall Malloth in der Sendung „Monitor“ in der Öffentlichkeit Unruhe ausgelöst worden sei.“ Bei der Diskussion über den „Fall Malloth“ habe er sich „in einer besonders mißlichen Lage“ befunden. Das Sitzungsprotokoll hatte eine andere CDU-Landtagsabgeordnete Finkelgruen mit Schreiben vom 23.4.1990 zukommen lassen (PAF).
Am 17.4.1990 reagierte der Klaus Bednarz, Chefredakteur von Monitor, persönlich auf ein Schreiben des SPD-Abgeordneten Friedrich Schreiber. Der erfahrene, mutige Journalist, der während seiner Korrespondententätigkeit in Moskau bereits Übleres durchlebt hatte, weist dessen Kritik an der Sendung in deutlichen Worten zurück: Juristen, denen sie diese Dokumente zuvor gezeigt hatten, hätten „die bezeugten Taten eindeutig als Mord qualifiziert.“ Bednarz fügt hinzu: „Wenn nun der Leiter der Zentralstelle Dortmund das Verfahren am 17. Januar 1990 eingestellt hat, ist dies für uns keine Veranlassung, unsere Schilderung des Tatbestands zu korrigieren. Es gibt in der deutschen Öffentlichkeit oft unterschiedliche Meinungen zu Verfügungen von Staatsanwälten und Urteilen von Richtern. (…) Ich hoffe, wir stimmen im Verständnis der freien Presse überein: Meinungsfreiheit besteht auch dort für Journalisten, wo Staatsanwälte zu einem anderen Urteil kommen.“ (PAF) Und sogar ein Jahr später, am 25.2.1991, reagierte die zuständige Redakteurin Ulrike Schweitzer noch einmal brieflich auf eine Anfrage eines Zuschauers (PAF).
Zurück zur Chronologie der Ereignisse: Am 5.8.1988 erreichte Oberstaatsanwalt Schacht der Anruf seines Bozener Kollegen, der mitteilte, dass Malloth „bei seiner Familie aufgegriffen“ worden sei. Oberstaatsanwalt Schacht blieb offenkundig nichts anderes mehr übrig: Er musste nun doch, zumindest formal, reagieren. Die italienische Justiz wollte den NS-Täter nun so rasch wie möglich loswerden: Fünf Tage nach ihrem Anruf bei Schacht, am 10.8.1988, setzten die italienischen Behörden Malloth ins Flugzeug nach München. Wie bereits erwähnt: Der Transport mit einem Auto bzw. der Bahn durch Österreich erschien ihnen als zu heikel, weil dort auf Malloth noch ein weiterhin gültiger Haftbefehl wartete.
Weitere Dokumente über Malloth: „Ich bin nun alt, sehr krank und auf Unterstützung angewiesen“
Am 10.8.1988 schickt das von Simon Wiesenthal geleitete Wiener Dokumentationszentrum des Bundes jüdischer Verfolgter des Naziregimes (Salztorgasse 6/IV, 5), auf ein Telefongespräch mit Schacht Bezug nehmend, Finkelgruen zahlreiche neue Unterlagen über Malloth: Zeugenaussagen aus der CSSR sowie aus Los Angeles; die Mitteilung dass in Graz ein Strafverfahren gegen Malloth anhängig sei; eine Beurteilung der Geheimen Staatspolizei in Prag vom Oktober 1940; eine Meldebestätigung der Gemeinde Meran; eine Mitteilung dass Malloth den deutschen Pass Nr. 1201625 habe, ausgestellt am 13.2.68, gültig für 5 Jahre (PAF).
Zwei Wochen später, am 28.8.88, führte Schacht in der städtische Klinik München Harlaching, „ohne Hinzuziehung einer Protokollführerin“ (Finkelgruen) eine mehrstündige Befragung von Malloth insbesondere über dessen Lebensweg durch. Diese hat nach Finkelgruens Beschreibungen jedoch eher den Charakter einer freundschaftlichen Begegnung als den einer juristischen Befragung. Bei seinen Recherchen hat Finkelgruen das von Schacht eigenhändig angefertigte Protokoll – „sechs einzeilig geschriebene Schreibmaschinenseiten“ (Finkelgruen) – erhalten. Hierin betont Malloth „Ich will nicht aussagen“ – und gibt doch in freimütigem Ton Auskunft über sein Leben. Sein Aufwachsen bei seinen Zieheltern ergänzt dieser mit dem Zusatz, dass er mit ihnen „nicht blutsverwandt“ sei. In diesem Gespräch schilderte der 76-jährige Malloth seine Flucht nach Italien und sein Leben in Meran. Er habe „die letzten 18 Jahre“ in Meran als Vertreter einer Elektrofirma gearbeitet und sei 1972 in Rente gegangen. In Meran habe ihn seine Frau „versteckt“. Nun sei er alt, sehr krank und auf Unterstützung angewiesen. Die Landschaft Merans, in der der Mörder aufgewachsen ist, hatte Finkelgruen übrigens im März 1951, da war Finkelgruen gerade neun Jahre alt, schon einmal erlebt, bei seiner Reise mit seiner Großmutter Anna von Prag nach Israel.
Finkelgruens Recherchen: Malloth der „Volksdeutsche“ und die „Akte 39“ (Josef Kleger)
Um auf Finkelgruens Recherchen zurück zu kommen: Ein halbes Jahr später, im Februar 1989, trifft Finkelgruen „Tante Bela“ – die 90-jährige Bela Krausova (s.o.). Diese erzählt ihm als Zeitzeugin die Details der Ermordung seines Großvaters. Sie erklärt sich auch bereit, dies trotz ihres Alters gerichtlich zu bezeugen. Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Köln erstattet Finkelgruen bei der Staatsanwaltschaft gegen Malloth eine Anzeige wegen Mordes. Als er mitbekommt dass die Staatsanwaltschaft kein Interesse an seiner Anzeige zeigt schaltet er wenig später einen Anwalt an.
In jahrelangen Bemühungen sammelt dieser von Finkelgruen beauftragte Anwalt öffentlich nicht zugängliche Gerichtsakten über Malloth. Allein diese Akten füllen mehr als zehn Aktenordner. Allein eine oberflächliche Beschäftigung mit diesen Akten löst Gefühle einer Lähmung aus: Es ist offenkundig, dass Teile der NRW-Justiz – deren Vertreter, wie spätere wissenschaftliche Untersuchungen belegen, ganz überwiegend noch während der Zeit der Nationalsozialismus ihre berufliche Ausbildung gemacht bzw. nur Vorgesetzte und Ausbilder hatten, die dem Nationalsozialismus ganz überwiegend nicht fern standen – alles versuchten, um Malloth zu schützen. Malloth ist für sie, so muss es scheinen, nicht „der Mörder“, „der Böse“ – er ist „einer von ihnen“ (Finkelgruen). Das harte Schicksal, eine Zufälligkeit hat Malloth als Aufseher nach Theresienstadt gebracht, eigentlich ganz gegen seinen Willen, so scheint es. Auch sie, die Oberstaatsanwälte, die noch in der Nazizeit ihre Ausbildung gemacht, ihre seelisch-biografische Prägung erfahren haben, hätten eine vergleichbare Tätigkeit wie Malloth ausführen können.
Anton Malloth war ein „Volksdeutscher“, einer von ihnen. Nur einer störte den gesellschaftlichen Frieden: Der „Rückkehrer“, der Jude Finkelgruen. Ohne ihn wäre alles besser, alles einfacher.
Erstmals in einem Film gesehen hat Finkelgruen Malloth nach seiner Rückkehr von seinem Besuch bei der Zeitzeugin und Bekannten aus seiner Kinderzeit, Tante Bela, im Februar 1989. Ihm erstmals begegnet ist Finkelgruen erst, als sich dies nicht mehr verhindern ließ: Anlässlich eines Gerichtstermins.
Die neuen Akten belegen Sammelverfahren, in denen mehrere Hundert Einzelfälle von „Tötungshandlungen“ in Theresienstadt untersucht wurden. Finkelgruen besucht den inzwischen 76-jährigen Josef Kleger im November 1989 in Prag und bekommt von diesem bestätigt, dass Malloth seinerzeit Martin Finkelgruen getötet habe. Die Zeit („Lein dringender Tatverdacht“, 2.2.1990) schreibt hierzu:
„Er habe damals gesehen, sagte Kleger zu Peter Finkelgruen, wie der alte Mann vom Gefängniskommandanten zu Boden geworfen wurde. Dann sei Malloth hinzugesprungen, habe auf den Mann eingeschlagen und sei auf ihm „herumgesprungen“. Kleger: „Dem Häftling floß Blut aus dem Mund, als Malloth sagte, man solle ihn in die Totenkammer bringen.“ Als Kleger am Abend von der Arbeit im Garten zurückkehrte, sei er an der Totenkammer vorbeigekommen. Sie habe offengestanden, darin habe „völlig blutig“ der alte Mann gelegen. Nachdem er die Schilderung beendet hatte, zeigte Finkelgruen dem Zeugen Kleger ein Photo seines Großvaters. Das habe er sich genau angesehen und dann gesagt: „No jo, das war er.““
Auch diese Zeugenaussage des tschechischen Staatsbürgers Josef Kleger befindet sich in Finkelgruens Privatarchiv. Der am 5.7.1913 Geborene hatte sie am 3.6.1975 vor der Staatsanwaltschaft Dortmund gemacht, im Bewusstsein der Strafbarkeit nicht zutreffender Aussagen. Auch dieses Dokument hatten Finkelgruens Anwälte in zähen Bemühungen aus den Dortmunder Archiven erhalten. Kleger, der 1942 sechs Monate lang Häftling in Theresienstadt war und die Ermordung Martin Finkelgruens erlebt hatte, verweist hierin darauf, dass er bereits am 5.1.1968 sowie am 13.11.1974 als ehemaliger Häftling von Theresienstadt Zeugenaussagen gemacht habe. An dokumentierten Zeugenaussagen ehemaliger Häftlinge hat es also nicht gefehlt. Er versichert, dass er Malloth, wie auch noch weitere NS-Wächter, eindeutig erkenne und beschreibt mehrere grausame Szenen. Einige kurze Ausschnitte seien wiedergegeben:
„Ich sah, wie Jöckel einen der Häftlinge umstieß, so dass dieser zu Boden fiel. Daraufhin sprang Malloth mit beiden Beinen auf den Körper des am Biden Liegenden und sprang auf ihm herum. Beim Vorbeigehen sah ich, wie diesem Häftling das Blut aus dem Mund spritzte. Von der Stelle vor dem Herrenhaus, wo wir bei den gärtnerischen Anlagen arbeiteten, konnte ich dann beobachten, wie der Körper des am Boden Liegenden in Richtung Totenkammer von zwei Häftlingen abtransportiert wurde. (…) Auf diesem Wege sind wir zur Totenkammer, die damals noch nicht abgeschlossen war, gegangen und dort habe ich den zu Tode getrampelten Häftling liegen sehen. Ich habe ihn an seinem Gesicht und an seiner Kleidung wiedererkannt.“ Kleger beschreibt weitere furchtbare Grausamkeiten, die Malloth wehrlosen Häftlingen vorsätzlich antat, auch Szenen, wie Malloth zwei Häftlinge abschließend mit einem Knüppel totschlug und fügt hinzu: „Das eigentliche Erschlagen der Häftlinge mit dem Stock hat Malloth jedoch alleine vorgenommen. Ich kann mich heute noch an diesen Vorfall ganz genau erinnern.“ (PAF) Kleger benennt auch weitere Zeugen, die bei den Morden dabei gewesen seien.
Februar 1989: Strafanzeigen von Finkelgruen oder: „Mit diesem Juden werden wir doch auch noch fertig. Den werden wir erledigen.“
Wie bereits angedeutet: Allein Finkelgruens Korrespondenzen mit Rechtsanwälten und mit Schacht zu dokumentieren (PAF) würde den Umfang dieser Studie bei weitem sprengen. Einige Schreiben, die seine erste Strafanzeige gegen Malloth wegen der Ermordung seines Großvaters betreffen, seien in zeitlich chronologischer Reihenfolge dennoch knapp dokumentiert:
Am 24.2.1989 – seinerzeit lebte Finkelgruen noch im Köln-Zollstocker Kalscheurer Weg – schickte Finkelgruen, auf besagtes Aktenzeichen 45 JS 25/70 Bezug nehmend, an die „Dortmunder Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Schacht“ eine Strafanzeige gegen Malloth wegen Mordes an seinem Großvater. Er verwies auf die bezeugende Aussage seiner Großmutter Anna wie auch auf die Zeugenaussage von Bela Krausova, die gemeinsam mit Martin Finkelgruen in Theresienstadt inhaftiert war. Diese bezeugte schriftlich ihm und seiner Frau Gertrud Seehaus (Seehaus 2017a, b) die Haft und die Umstände der Ermordung Martin Finkelgruens, einschließlich der dem Mord unmittelbar vorhergehenden Aussage „Mit diesem Juden werden wir doch auch noch fertig. Den werden wir erledigen.“ (PAF).
Zwei Tage später schickte er eine Kopie des Schreibens an die Kölner Rechtsanwälte Burghard und Fieguth, mit der Bitte um Weiterleitung. Finkelgruen erwägt hierin, „auch bei angenommener Aussichtslosigkeit“, eine Verfassungsklage, um eine Zulassung als Nebenkläger zu erlangen, da kein direkter Nebenklageberechtigter mehr lebe. In den folgenden Monaten korrespondierte Finkelgruen mehrfach mit Bela und mit Zdenka seinen sehr persönlich gehaltenen Brief.
Am 11.8.1989 teilte Schacht Finkelgruen mit, dass dessen Anwälte die Akten der Ermittlungsverfahren nicht erhalten könnten, da diese zu umfangreich seien. Sie stünden ihnen „hier auf der Geschäftsstelle der Abteilung 45 (…) zur Einsichtnahme zur Verfügung“.
Am 24.8.1989 schickten die Anwälte eine handschriftlich, sowohl auf deutsch als auch auf tschechisch verfasste Zeugenaussage von Bela Krausova an Schacht.
Am 27.11.1989 übersandten Finkelgruens Anwälte eine „eidesstattliche Versicherung des Zeugen Kleger, aufgenommen vom staatlichen Notariat in Prag.“ In Finkelgruens Archiv befinden sich, dies sei ergänzend angemerkt, zahlreiche, umfangreiche Dokumente bzgl. Anhörungen und Zeugenvernehmungen von Kleger, so vom 5.1.1968 (Litomerice, CSSR); 20.11.68: Zeugenaussage durch Vaclav Myslivec (geb. 1895), in welcher er Klegers Aussagen unterstützt (Innenministerium CSSR).
Schacht setzte offenkundig auf Zeit. Er ist – wie man auch seinen Schreiben entnehmen könnte – offenkundig „genervt“. Am 1.12.1989 bittet Schacht um die Zusendung eines Lichtbildes des Zeugen Kleger.
Finkelgruen vermochte all diese Jahre nur „durchzuhalten“ und kontinuierlich, zielorientiert weiter zu arbeiten, weil er immer wieder kostenlos von einigen Politikern (vor allem aus dem seinerzeitigen „linken“ FDP-Flügel (Ulrich Klug, Gerhard Baum, Burkhard Hirsch) sowie auch von den Grünen (u.a. Brigitte Schumacher und Volker Beck) sowie von einzelnen, hoch qualifizierten Juristen unterstützt wurde. Allein dieses Netz zu beschreiben würde den Rahmen dieses Beitrages sprengen. Hervorheben möchte ich Gerhart Baum (vgl. Baum 1981, 2020). Am 19.5.1989 – seinerzeit gehörte Baum noch dem Bundestag an, seine Tätigkeit als Bundesinnenminister hatte 1982 mit der „Wende“ von Schmidt zu Kohl geendet – schickte er Finkelgruen bzgl. der „Nebenklagebefugnis der Enkel von Naziverfolgten“ eine juristische Auskunft aus dem Justizministerium und bot ihm zugleich ein Telefongespräch hierüber an (PAF). Und am 12.2.1990 schreibt ihm eine Mitarbeiterin des Archivs von Yad Vashem und informiert ihn über eigenes Material „concerning the war criminal Anton Malloth“.
Am 12.12.1989 leiten Finkelgruens Anwälte Burghard & Fieguth beim Generalstaatsanwalt in Hamm eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein: „Soweit von hieraus zu beurteilen, hat unser Schreiben keinerlei Aktivitäten der Staatsanwaltschaft Dortmund ausgelöst. (…) Soweit ersichtlich, sind nicht einmal Anstalten gemacht worden, den Augenzeugen Kleger in Anwesenheit eines ermittelnden Staatsanwalts von den tschechischen Behörden vernehmen zu lassen“. (Finkelgruen 1992, S. 164) Und sie verweisen auf die Aussage einer Journalistin, Schacht „sähe keinen Anlass, tätig zu werden, da er dem Zeugen Kleger ohnehin nicht glaube.“
Am 18.12.1989 lehnte der Oberstaatsanwalt in einem Schreiben an Finkelgruens Anwälte die Annahme eines dringenden Tatverdachtes ab. Gleichfalls in diesen Tagen teilte er einer Journalistin sowie Simon Wiesenthal (s.o.) mündlich mit, dass er das Verfahren auf jeden Fall einstellen werde. Am 7.2.1990 stellte der Generalstaatsanwalt in Hamm die Beschwerde gegen die Oberstaatsanwaltschaft in Dortmund ein.
Auch Simon Wiesenthal reagierte auf das Schreiben von Finkelgruens Anwälten, welches Finkelgruen ihm zugeschickt hatte: Zwei Tage später rief er Schacht an und drückte seine Verwunderung darüber aus, dass dieser Malloth immer noch nicht verhaftet habe. Schacht teilte ihm lakonisch mit, „dass der Fall praktisch vor der Einstellung stehe“, er werde Frau Krausova noch anhören und den Fall dann einstellen. Die Begründung sei 300 Seiten lang. Wiesenthal verweist, im Wissen um die Aussichtslosigkeit sachlicher Argumente, auf eine weitere Zeugin, eine in Los Angeles lebende Valy Sperl, die am 31.1.1989 in seinem Büro eine ausführliche Zeugenaussage gemacht habe – und fügt gegenüber Finkelgruen lakonisch hinzu: „Oberstaatsanwalt Schacht hält Frau Sperl anscheinend nicht für eine Augenzeugin.“ (PAF) Auch diese zwei Seiten umfassende Zeugenaussage schickt er Finkelgruen zu.
Am 16.3.1990 reagieren Finkelgruens Anwälte auf Schachts Schreiben vom 15.2.1990 und bezeichnen dessen Anfrage, „wie die Staatsanwaltschaft Dortmund bei den Ermittlungen weiter verfahren solle“ als „polemisch“: „Da Opfer, Tathergang und Tatzeitpunkt bekannt sind, könnte es angezeigt sein, den Zeugen Kleger zeugenschaftlich nach dem Täter zu vernehmen. Weniger angezeigt erscheint die Diffamierung zunächst des Zeugen Kleger und nunmehr des Zeugen Finkelgruen.“
Dortmund, 17.1.1990: Erneute Einstellung des Verfahrens
Dennoch: Oberstaatsanwalt Schacht zeigte keinerlei Interesse an der Zeugenaussage. Er lud Finkelgruen am 6.6.1989 noch einmal vor, in der deutlich erkennbaren Absicht, diesen einzuschüchtern und die Akten endgültig zu schließen, erinnert sich Finkelgruen (persönliche Mitteilung). Überschrieben ist das drei Seiten umfassende Vernehmungsprotokoll mit: „Oberstaatsanwalt Schacht als Vernehmender, Justizangestellte K. als Protokollführerin“ (PAF)
Schacht bestritt, dass der Zeuge Kleger im November 1989 in der Lage gewesen sein könne, den ein gutes halbes Jahrhundert zuvor Ermordeten wiederzuerkennen. Er bezeichnete den Zeugen als unglaubwürdig und lehnte dessen erneute Vernehmung ab. Die Zeugin Bela Krausova – in Finkelgruens „Haus Deutschland wird sie als Tante Bela bezeichnet – lässt er durch einen Kollegen in der CSSR vernehmen.
Das 1979 eingestellte Mammut-Ermittlungsverfahren habe zwar in rund 40 Mordfällen Malloth als Verantwortlichen festgehalten, so Schacht. Hierbei handele es sich jedoch um Taten wie Totschlag oder Körperverletzung, die nach 30 Jahren verjährt seien. Seine Behörde habe nie Kenntnis vom Aufenthaltsort des 1912 in Innsbruck Geborenen gehabt. Insofern habe sie nie etwas gegen Malloth unternehmen können. Damit sei der Fall endgültig abgeschlossen.
Am 17.1.1990 stellte Oberstaatsanwalt Schacht das Ermittlungsverfahren gegen Malloth erneut ein. Er habe Malloth selbst vernommen, alle Zeugenaussagen seien unglaubwürdig. Die Einstellungsverfügung umfasst 186 Seiten und listet 105 Fälle auf, in denen Malloth belastet wurde. Selbst äußerst grausame Zeugenaussagen wie die von Vojtech S. sowie von Frantisek S. seien entweder unglaubwürdig oder juristisch nicht haltbar.
Die ZEIT (2.2.1990) titelt: „Kein dringender Tatverdacht. Der Fall Malloth: Wie ein KZ-Aufseher unbehelligt davonkam“. Sie zieht das Resümee: „Anton Malloth lebt weiterhin unbehelligt in einer kleinen Stadt bei München. Peter Finkelgruen hat die Adresse. Am Anfang, erzählt er, habe er „archaisch“ reagiert: „Du kaufst dir jetzt ’ne Pistole und erschießt ihn!“ Dann habe er sich gemäßigt: „Nein, du schlägst ihn nur nieder.“ Schließlich siegte die Vernunft, Finkelgruen erstattete Anzeige, wie es sich gehört. Daß dies nun aber offensichtlich nicht zur erhofften Sühne führen wird, muß er erst noch verarbeiten: „Das prägt den Alltag, man denkt ständig daran.“
Finkelgruen, der nach den erlittenen Traumatisierungen inzwischen arbeitsunfähig war, ließ nicht nach. Er war nicht bereit, das offenkundige Unrecht, den ungesühnten Mord an seinem Großvater hinzunehmen. Um dem weiteren Ablauf vorzugreifen: Verurteilt wurde Malloth erst elf Jahre und drei Monate später, am 30.5.2001, in München – nicht in Dortmund.
taz 1989: „Abwarten – bis die Zeugen sterben…“ – FR: „Nur keine Eile“
Einigen Medien war aufgrund der langen Vorgeschichte klar, wie der Prozess ausgehen würde. Und sie interpretierten den Ausgang politisch. So titelte die taz am 13.12.89 recht drastisch: „Abwarten – bis die Zeugen sterben…“ Und in der Unterzeile konstatierte sie nüchtern: „NS-Verbrecher Anton Malloth auch eineinhalb Jahre nach Rückkehr in die BRD auf freiem Fuß.“
Vergleichbar deutlich war ein drei Wochen später publizierter Beitrag in der Frankfurter Rundschau (3.1.1990) formuliert: „Nur keine Eile, dann erledigt sich der Prozeß fast von selbst. Der Fall Anton Malloth: gegen mutmaßliche NS-Verbrecher wird oft sehr gemächlich ermittelt“. Verfasst war er von der erfahrenen, in Köln lebenden Gerichtsreporterin Ingrid Müller-Münch; er erschien zwei Wochen vor dem offiziellen Dortmunder Urteilsspruch. Sehr detailliert und kenntnisreich wird die quälend lange Vorgeschichte beschrieben. Die postulierten „umfangreichen Nachforschungen“ der Dortmunder Oberstaatsanwaltschaft werden mit den 1970 begonnenen und 1979 „vorläufig eingestellten“ Ermittlungen verglichen. Der, so heißt es im Zeitungsbeitrag wörtlich, „Eifer“, das „Engagement“ der Ermittlungen werde allein an dem Umstand deutlich, dass „ein Dachauer Häftling“ 1971 „ganze zehn Minuten“ gebraucht habe um zu klären „wo Malloth in Meran als Vertreter für deutsche Firmen lebte“. Die Dortmunder Staatsanwälte hingegen seien so vorgegangen: „„Wir haben immer mal wieder nachgefragt bei den italienischen Behörden – doch die trafen ihn nie an, und ich habe keinen Anlass, an dieser Auskunft zu zweifeln.“ Dabei beließ es Oberstaatsanwalt Klaus Schacht.“ Finkelgruens zunehmend auswegloser erscheinende Gefühlssituation, sein schon als „Naivität“ wahrgenommenes Vertrauen auf die Ermittlungsbereitschaft der Staatsanwaltschaft wird im FR-Beitrag herausgearbeitet. Immerhin ging es für den im Shanghaier Exil geborenen Juden Finkelgruen um die Ermordung eines seiner engsten Verwandten. Und dieser Mord entsprach dem Schicksal, welches die in Shanghai herrschende NSDAP/AO auch für den jüdischen Säugling fest eingeplant hatte. Dies alles wurde Finkelgruen erst in seinen Nachforschungen als 50-Jähriger bewusst. Der Schock über das Wissen, dass ihm die Deutschen selbst als unschuldigem jüdischen Säugling sein Existenzrecht aberkannten, sogar im 20.000 km von Deutschland entfernten Shanghai, war eine schwer traumatische Erkenntnis für ihn. Sie kumulierte seelisch mit Finkelgruens frühkindlichen schweren Traumatisierungen, die wiederum durch die Traumatisierungen seiner Eltern sowie deren frühen Tod massiv verstärkt wurden. Die erkennbare Weigerung des zuständigen Staatsanwaltes, seiner Pflicht nachzukommen, und dies über viele Jahre hinweg, war eine mehr als schockhafte Erfahrung. Sie lähmte Finkelgruen, sie rief abgrundtiefe Ängste und Verzweiflung in ihm hervor. Er vermochte diese mehr als zehn Jahre andauernde Erfahrung einer quälenden Hilflosigkeit nur durch seine Akribie zu ertragen, mit der er sich juristische Kenntnisse aneignete, mit der er sich Bündnispartner suchte: Befreundete Juristen, fortschrittlich-liberale Politiker, überlebende Juden, die vergleichbare Erfahrungen wie er selbst gemacht hatten wir er selbst. Ihnen vermochte er zu vertrauen, mit ihnen kämpfte er für den demokratischen Rechtsstaat und für eine gleichermaßen individuelle wie auch historische Gerechtigkeit. Die linksliberale Journalistin Ingrid Müller-Münch, die Finkelgruen kennenlernte, verstand dies alles sehr genau und fand die treffenden Worte. Sie kommentiert: „Als Finkelgruen die Ungewissheit nicht mehr aushalten konnte, fuhr er auf eigene Faust noch einmal nach Prag, um den überlebenden Augenzeugen des Geschehens, das er für den Mord an seinem Großvater hält, selbst zu interviewen. Eile war geboten. Josef Kleger, der Augenzeuge, ist alt. Bereitwillig schildert der ihm jenen Vorfall. Auf einem Foto erkannte Kleger anschließend in Martin Finkelgruen das damalige Opfer des Malloth wieder. Hatte er das Gesicht des zu Tode Getrampelten doch an jenem Tag noch einmal klar und deutlich durch die offenstehende Tür der Totenkammer sehen können.“
1994: „Hessens Justiz schreibt neues Kapitel der Nichtverfolgung von NS-Prozessen.“
Zur Erinnerung – es sei auf den haGalil-Aufsatz über Ralph Giordanos Verdikt vom „emotionslosen Ochsenfrosch“ im vorliegenden haGalil-Themenschwerpunkt verwiesen: Drei weitere Jahre vergingen, bis Ralph Giordano diesen für Finkelgruen schwer traumatisierenden Prozess mit einigen wenigen Worten durchbrach, die er gleichfalls in der linksliberalen Frankfurter Rundschau publizierte. Und es verging noch einmal mehr als ein Jahr, bis diese Grausamkeit in einem Gerichtsprozess mündete, die Oberstaatsanwalt Schacht nun nicht gegen Malloth führte – sondern gegen die wohl einzigen Juden, zu denen er in einem beruflichen Kontakt stand: Gegen Ralph Giordano und Peter Finkelgruen.
Auch diese Absurdität wurde in Zeitungsbeiträgen präzise beschrieben: Die Berliner Zeitung titelte am 13.4.1994 über den anstehenden Prozess von Malloth gegen Giordano und Finkelgruen: „Hessens Justiz schreibt neues Kapitel der Nichtverfolgung von NS-Prozessen. Ein Mord und seine Folgen.“
Eröffnet wird der Beitrag in einer sprachlichen Deutlichkeit: „Die deutsche Justiz ist im Begriff, den Ruf mangelnder Aufarbeitung der NS-Zeit zu festigen: Am Freitag findet im Amtsgericht Frankfurt a. M ein Prozeß wegen „Beleidigung und öffentlicher Herabwürdigung eines Oberstaatsanwalts“ gegen den jüdischen Schriftsteller Ralph Giordano statt. Die Geschichte des Verfahrens beginnt am 10. Dezember 1942 im KZ Theresienstadt…“
Februar 1989: „Liebe Tante Bela… Dieser Mann lebt heute in München – und ich bin entschlossen, ihn seiner Strafe zuzuführen.“
Kommen wir zu Finkelgruens nicht nachlassendem Engagement zurück: Im Februar 1989 traf der 46-jährige Peter Finkelgruen innerlich eine Entscheidung: Er wollte versuchen, endgültig Licht in die Umstände der Ermordung seines Großvaters Martin Finkelgruen zu bringen. Finkelgruen, der inzwischen durch die reaktivierten Traumata in Frühpension gekommen war, spürte, dass es für ihn wohl keinen Weg zurück in die Zeit des nicht-Wissens über seine Familiengeschichte geben würde, wenn er den Brief an „Tante Bela“ losschicken würde. Bela hatte er als Kind in Prag kennengelernt. Sie gehörte zu den wenigen Vertrauten, die seine schwerkranke Mutter Esti in Prag hatte. Da der fünfjährige Peter Finkelgruen in Prag außer seiner Mutter Esti und seiner Großmutter Anna ansonsten keine lebenden Verwandten mehr hatte nahm er, wie seinem Buch (1992) zu entnehmen ist, Bela als Tante wahr.
Vor mir liegt ein akkurat maschinengeschriebener Brief, den Finkelgruen am 22.2.1989, von seiner Wohnung in Köln-Zollstock aus an Bela geschrieben hat. Da Finkelgruen diesen für den Malloth-Prozess sowie seine Identitätsentwicklung als Jude in Deutschland zentralen Brief in seinen Büchern noch nicht eingearbeitet hat werde ich ausführlicher aus ihm zitieren. „Tante“ Belas Erinnerungen hatten ihm eine ihm bisher völlig unbekannte Seite seiner Großmutter Anna vermittelt: Anna war nun nicht mehr die durchsetzungsfähige, robuste, kämpferische, durchaus nicht immer einfühlsame Groß- und Ersatzmutter. Die Frau, die als einzige bereit war, für den weitgehend elternlosen Jungen Verantwortung zu übernehmen. Seine bereits sehr kranke Mutter Esti war mit Peter in das kommunistische Prag gegangen, hatte also ihre ursprünglichen Emigrationspläne nach Peru verworfen, um wieder mit ihrer Mutter Anna zusammen zu sein (vgl. Kaufhold 2020a).
22.2.1989: Der Brief an Bela Krausova: „Da ich wusste dass mein Großvater im Jahre 1942 in Theresienstadt erschlagen wurde, habe ich die Meldung ausgeschnitten“
Und zugleich war die 90-jährige Bela Krausova – Tante Bela – die erste Zeitzeugin, die ihm den Mörder seines Großvaters (sowie zahlreicher anderer Häftlinge) eindeutig benennen konnte: Malloth war der Mörder. Das Trauma war wieder da. Finkelgruen schrieb am 22.2.1989 an Bela Krausova:
„Liebe Bela (…) Zuerst wollte ich Dir sagen, dass es für mich eine sehr große Freude war Dich zu sehen und mit Dir sprechen zu können. Es war auf irgendeine Art und Weise eine Rückkehr zu einem Teil meiner Kindheit. Ich habe gemerkt dass ich so gerührt war dass es mir nicht gelungen ist selber sehr viel zu reden und zu erzählen.
Nachdem Gertrud und ich von Dir weggefahren sind, fuhren wir wie es unsere Absicht war nach Theresienstadt. Auf dem Weg dahin waren wir sehr schweigsam. Denn ich hatte von Dir zum ersten Mal geschildert bekommen wie mein Großvater in Theresienstadt umgebracht wurde – und von wem.“
Nachfolgend beschreibt Finkelgruen den ihn erschütternden Lernprozess ab August 1988, während seiner Rückkehr von Israel nach Deutschland; wie er erfuhr, dass Malloth der Mörder seines Großvaters war – und ungestört, umsorgt in Deutschland lebte: „Da las ich eine Meldung in einer Zeitung über einen Mann, der beschuldigt wird in Theresienstadt viele Häftlinge geschlagen und umgebracht zu haben. Es ist ihm gelungen aus Italien – wo er vorher gewohnt hat – nach Deutschland zu fliehen und damit seine Auslieferung an die CSSR, die seine Auslieferung von Italien verlangt hatte, zu verhindern. Er lebt heute in München und der Staatsanwalt der ihn anklagen soll, meint er hätte nicht genug Beweise. Das stand alles in der Zeitung hier und ich habe es mir ausgeschnitten weil in der Meldung auch gesagt wurde dass dieser Mann von 1940 bis 1945 in Theresienstadt gewesen sei. Da ich wusste dass mein Großvater im Jahre 1942 in Theresienstadt erschlagen wurde, habe ich die Meldung ausgeschnitten – ich dachte, das könnte der Mörder gewesen sein.“
Finkelgruen schreibt weiter an Bela: „Du kannst Dir vorstellen was es bedeutete als Du von der Ermordung des Großvaters erzählt hattest und davon wie ihr tagelang der Großmutter nichts erzählen konntet, und dabei den Namen des Mörders genannt hast und gesagt hast was er beim Erschlagen des Großvaters gesagt hat.“ Der Name des Mörders sei identisch mit dem von ihr genannten Namen: „Dieser Mann lebt heute in München – und ich bin entschlossen das was ich tun kann um ihn seiner Strafe zuzuführen oder wenigstens ihm seine Ruhe zu stören, zu tun.“ Anschließend fragt er Bela, ob sie bereit wäre, diese Aussage noch einmal, trotz der damit verbundenen Belastungen, vor einem Richter in Prag zu wiederholen.
Zdenka: „Würdest Du mir nochmal alles über die Zeit mit der Großmutter im Konzentrationslager erzählen?“
Am gleichen Tag schickt er einen zweiten Brief, diesmal gerichtet an Zdenka Nedvedová-Nejedlá (vgl. Finkelgruen 1992, S. 13-17). Zdenka hatte der viereinhalb jährige Peter Finkelgruen im Winter 1946 gleich nach seiner Ankunft in Prag kennengelernt: Die Kinderärztin war eine Bekannte seiner Großmutter Anna und wohnte auch in ihrer Nähe in Prag. Anna brachte den wegen der verheerenden Zustände in Shanghai unterernährten und an den Folgen einer Amöbenruhr laborierenden Enkel zu ihr. Die am 20.8.1908 geborene Kinderärztin Zdenka Nedvedová-Nejedlá[11] war gemeinsam mit Anna Häftling im Konzentrationslager Ravensbrück. Dort versorgte sie, so gut es ging, ihre Mithäftlinge medizinisch, so auch Anna. Zdenka, Tochter eines Prager Professors, hatte ab 1926 Medizin studiert und 1938 in Prag eine kinderärztliche Praxis eröffnet. Sie verstand sich als Kommunistin, wie auch ihr Ehemann, und hatte sich nach der Besetzung der CSR dem Widerstand angeschlossen. Im Juni 1942 wurde sie verhaftet, monatelang verhört und am 27.1.1943 gemeinsam mit ihrem Mann in das Konzentrationslager Auschwitz verschleppt. Ihr Mann verstarb dort zwei Monate später an Fleckfieber. Sie selbst wurde am 20.8.1943 in das KZ Ravensbrück verschleppt und arbeitete dort als Häftlingsärztin. Am 31.5.1945 kehrte sie mit einem Krankentransport von etwa 100 Frauen nach Prag zurück, wo sie wieder als Kinderärztin arbeitete. Die überzeugte Kommunistin wurde Vorsitzende der tschechoslowakischen Lagergemeinschaft Ravensbrück und trat 1948/49 als Zeugin in den britischen Ravensbrücker Prozessen in Hamburg auf. 1968 protestierte sie öffentlich gegen die Okkupation der CSSR und trat 1969 aus der KP aus (De Gruyter 2011).
Ab dem Winter 1946 gehörte Zdenka zu den wenigen Vertrauten seiner Großmutter und von ihm selbst. Er hielt sich regelmäßig in ihrer Küche auf, wo er sie als Köchin, Haushälterin und Geschichtenerzählerin erlebte. 1949 nahm sie den siebenjährigen Peter zu einem Opernbesuch im imposanten, am Moldauufer gelegenen Prager Nationaltheater mit – es wurde „Die verkaufte Braut“ von Smetana gegeben – , was „einen überwältigenden Eindruck“ in Finkelgruen hinterließ (Finkelgruen 1992, S. 14). Auch die am 20.8.1908 geborene, gut 80jährige Zdenka sucht er bei seinem Besuch in Prag – es war wohl im Jahr 1989 – auf.
Finkelgruen beschreibt ihr noch einmal seine seelische Erregung, das Gefühl der Irrealität, welches diese Begegnung in ihm ausgelöste. Er wurde an seine Jugend in Prag erinnert – während der ihm doch niemand etwas über seine Familiengeschichte zu erzählen vermochte: „Es war für mich wie in einem Traum. Ich bin aus dem Wagen gestiegen, unten in der Leva Unice und bin einfach wie das sechsjährige Kind das ich mal war einen Weg gegangen und direkt auf sein Haus zu das ich erkannt habe und hinauf zu Deiner Wohnung.“ Er beschreibt auch ihr die Bedeutung, die diese beiden Begegnungen für ihn haben: Zum Verständnis der Ermordung seines Großvaters, aber auch zum Verständnis seiner tiefen, unbewussten Ambivalenz, die er gegenüber Anna empfindet. Und er fragt auch sie: „Würdest Du mir nochmal alles über die Zeit mit der Großmutter im Konzentrationslager erzählen? (…) Wenn ich von Dir und Bela Bescheid habe, werde ich ganz schnell wieder nach Prag kommen.“
Exkurs: Die Ermittlungsakten der 1970er Jahre – ein Schock für Finkelgruen
Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Sommer 1988 hatte Finkelgruen, wie beschrieben, mit seinen Recherchen über die den Lebensweg und die Verbrechen von Malloth begonnen. Nach dem Besuch bei Tante Bela im Februar 1989 hörte er von einem kürzlich ausgestrahlten kurzen Filmportrait, in dem Malloths Weg „heim ins Reich“ nachgezeichnet worden war. Er rief bei der Redaktion an und bat darum, den Film sehen zu dürfen: „So sah ich Anton Malloth zum ersten mal. Ein älterer Mann in leichter Sommerkleidung, mit hellem Hut, trat von der Gangway auf das Rollfeld, unsicher und wie fragend um sich schauend: Was geschieht jetzt? Werdet ihr mich anschauend? Mich beschützen? (…) Ich bin einer von euch.“ (Finkelgruen 1992, S. 40) Und er fügt, auf den Oberstaatsanwalt bezogen, hinzu: „In dem Fernsehbeitrag sah ich ihn zum ersten mal. Seinen Überdruß konnte er kaum verbergen. Die Arroganz des pensionsberechtigten Karrieristen, dachte ich.“ (S. 44) Ralph Giordano hatte den gleichen nachhaltigen Eindruck von Schacht.
Später erhielt Finkelgruen Fotos von Malloth, dann reiste er im Rahmen von Dietrich Schuberts (1997) Filmprojekt zu Malloths Altersheim. Dies waren Schritte einer vorsichtigen, ambivalenten Annäherung, um ein konkreteres Bild vom Mörder zu gewinnen. Sie brachten ihm Albträume und schwere psychosomatische Belastungen ein. Er wurde nun zum Opfer, zum Träger einer Last – weder der Mörder Malloth noch der deutsche Oberstaatsanwalt Schacht litten unter der Tat, der systematischen Verfolgung, dem Mord.
Finkelgruen muss von Anfang an und dann immer wieder gespürt haben, wie existentiell ihn dieses aus dem Aktenstudium gewonnene Wissen um die Identität des Mörders gesundheitlich gefährdete. Er beschreibt seine abgrundtiefe Ambivalenz so: „Der Gedanke, es nicht zu tun, überfällt mich immer wieder. Mich nicht darauf einzulassen. Mir zu sagen, damit hast du nichts zu tun. Mich zu verkriechen. Mein Wissen zu verbannen. Vorstellung und Wissen zu verbannen. Sie aus meinem Gehirn zu tilgen. Das Stück herauszuschneiden, in dem der Film – wie ein Mensch in Uniform auf einem alten Mann herumtrampelt – immer wieder abläuft. Die Bilder sind aber da. Je mehr ich lese, von Zeugen über diese und andere Taten in der Kleinen Festung erfahre, desto detaillierter sind sie geworden.“ (1992, S. 44) Und doch dürfte er sich damals, im Frühjahr 1989, selbst in seinen pessimistischsten Erwartungen nicht vorgestellt haben, dass er nun dreizehn Jahre lang an diesen Mörder, an dieses Trauma gebunden bleiben sollte.
Kommen wir zur publizistischen Aufarbeitung der Geschichte Malloths zurück: Zahlreiche Zeitungen, auch Spiegel und ZEIT, griffen das Thema auf. Bald war der NS-Prozess, Dank Finkelgruens Insistieren, sogar ein internationales Thema: Die Vielzahl der Presseausschnitte und Stellungnahmen füllen mehrere Ordner. Auch italienische, tschechische, israelische und amerikanische Medien schrieben über den Prozess.
Zu seinem ungläubigen Erstaunen musste Finkelgruen nun feststellen, dass sogar Malloths Anschrift bekannt war. Und doch weigerten sich die zuständigen deutschen Stellen, die Geschichte, den Mord und die Morde aufzuklären. Sie verweigerten bewusst die Grundstandards des demokratischen Rechtsstaats.
Finkelgruen begann nun, noch intensiv zu recherchieren. Im Februar 1989 erstattete Finkelgruen, nach seinem Gespräch mit Tante Bela, eine Anzeige gegen Anton Malloth wegen Mordes (s.o.). Dem beauftragten Rechtsanwalt gelang es, nach und nach und auf Umwegen, einen Teil der bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft liegenden umfangreichen Akten aus den 70er Jahren anzufordern. Finkelgruen hat auch diese Akten bis heute aufbewahrt.[12] Das erste Strafverfahren war am 23.4.1979 von der Dortmunder Ermittlungsbehörde eingestellt worden. Je mehr sich Finkelgruen nachts in seinem Keller in der Kölner Siebengebirgsallee in die Akten vertiefte desto größer wurde sein Schock. Seine abgrundtiefe Empörung über das „wortreiche deutsche Schweigen“ – so lautet ein Buch seines Freundes Peter Ambros (2013; vgl. Kaufhold 2013c) – über Akten, in denen 764 Fälle von Mord und Totschlag untersucht wurden, ohne zu einer einzigen Verurteilung zu kommen.
Die besagte Akte 45 Js 25/70 schockierten ihn besonders. In Haus Deutschland bemerkt er hierzu: „Ein umfangreiches Typoskript elektrisierte mich. Es war die Kopie einer Verfügung des Leiters der Zentralstelle im Lande Nordrhein-Westfalen (…) vom 23. April 1979. Auf 248 Schreibmaschinenseiten waren 764 Fälle von Mord aufgeführt, an denen ausschließlich verstorbene, nicht zu ermittelnde oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland lebende Beschuldigte beteiligt gewesen sein sollen.“ Auf S. 21 dieser Verfügung fand er eine Kurzbeschreibung, die er seinem ermordeten Großvater Martin zuordnete: „Fall 39 a) zweite Hälfte des Jahres 1942, b) Block A der KFT, c) Malloth (u.), d) ein alter Jude, e ) erschlagen“, wie es nüchtern in den Akten heißt. Kleger taucht immer wieder in den Dokumenten auf. Für Finkelgruen wurde beim Lesen der Akten rasch klar: Die Staatsanwaltschaft wusste seit Jahren von diesen und von weiteren Morden, sie kannte auch die Namen der Täter. Und doch hatte es kein einziges Gerichtsverfahren gegeben.
Immer wieder wird in den Gerichtsakten Malloth erwähnt; Finkelgruen strich diesen Namen in den Akten über 100 mal an. Hieraus erwuchs seine Reflexion über die Frage, was einen „perfekten Mord“ ausmache – in der Eingangsszene zu Schubert Kinofilm Unterwegs als sicherer Ort (1997), während einer gemeinsamen Autofahrt am frühen Morgen, entlang der Kölner Nord-Süd-Fahrt.
Dementsprechend eröffnet Finkelgruen Haus Deutschland so: „Dies ist die Geschichte eines ungesühnten Mordes. Keines persönlichen Mordes – oder doch? Ist ein perfekter Mord einer, der begangen und nicht entdeckt wird? Oder ist der perfekte Mord jener, der auf offener Bühne vor den Augen aller begangen wird?“ (ebd. 1992, S. 9) – um dann hinzuzufügen, dass er mit seinem Buch eigentlich eine Erzählung über seine ihm Jahrzehnte lang weitgehend unbekannten Eltern schreiben wollte: „Aber ich stieß auf einen Mord und auf einen Mörder. Ich wechselte vom Chronisten zum Detektiv. Zum Schnüffler. Es war unmöglich, der Lebensgeschichte der Eltern nachzugehen, ohne diesen Mord zu schildern.“ (Finkelgruen 1992, S. 9).
„Ich habe Anton Malloth nicht umgebracht. Ich habe ihm nicht einmal Angst gemacht…“
Die jahrelangen Prozesse gegen Malloth bzw. gegen die Dortmunder Oberstaatsanwaltschaft haben tiefe Spuren in Finkelgruen hinterlassen. Ich frage mich bei der Lektüre der Schriften und Akten immer wieder, wie er dies seelisch und körperlich hat überstehen können. In Haus Deutschland bemerkt der inzwischen 50-Jährige, als er Malloths Auslieferung von Italien nach Deutschland per Flugzeug beschreibt, erschüttert:
„Anton Malloth wurde von Meran nach München geflogen. In die Sicherheit. Ich habe mir keine Pistole in der Kölner Unterwelt besorgt. War ich zu feige? Manchmal träume ich davon, dass Überlebende des Holocaust zu Terroristen werden, um die Mörder von damals – nein, nicht umzubringen, sondern ihnen das Gefühl einer permanenten, sie nie verlassenden Angst zu verschaffen. Damit sie wenigstens entfernt ahnen, womit die Überlebenden den Rest ihres Lebens verbringen.“ (Finkelgruen 1992, S. 134)
Finkelgruen ringt mit der Aufrichtigkeit seiner – unbewussten – Motive, indem er fortsetzt:
„War es Feigheit, die mich abgehalten hat, etwas zu tun, das ich als richtig empfand? Waren die Argumente des Rechtsstaats nur Vorwände? Ich werde es wohl nie wirklich wissen. Aber immer werde ich die Lästerstimmen hören: Es war doch nur Angst. Es ist Selbsttäuschung, zu denken, dieser Staat sei so organisiert dass der einzelne um des Gemeinschaftsfriedens willen auf den Atavismus der Selbstjustiz verzichten könne. (…) Um die Täter zu schützen, versagt sich diese Gesellschaft ihre Gefühle und betrügt die Opfer um ihr Recht. Ich habe Anton Malloth nicht umgebracht. Ich habe ihm nicht einmal Angst gemacht.“ (Finkelgruen 1992, S. 134)
1992: Der staatliche „Kostenfeststellungsbeschluss“
Finkelgruen beendet seine 1992 erschienene Familienbiografie Haus Deutschland mit einem persönlich gehaltenen „Nachtrag“. Seinerzeit dachte er wohl, dass die Justizgeschichte um den Mörder Anton Malloth nun, nach drei Jahren, bald ein Ende finden werde. Dass die formalen juristischen Auseinandersetzungen noch neun Jahre weiter gehen würden vermochte er sich beim Abschluss seines ersten Buches nicht vorzustellen.
Seine Anzeige gegen Malloth hatte Finkelgruen am 24.2.1989 gestellt. Am 21.2.1992 erhielt er vom Landgericht Dortmund einen „Kostenfeststellungsbeschluss“, dass er 509 DM an das Land NRW zu zahlen habe. Weiterhin erhielt er eine Rechnung in Höhe von 315 DM, da seine Nachforschungen und Strafanzeigen nicht „dem mutmaßlichen Willen des beklagten Landes“ entspreche. Es war wohl insbesondere diese Formulierung, die Finkelgruen zutiefst erschütterte. Sein Freund Ralph Giordano verstand dies intuitiv, verfasste seine ungestüme Besprechung von Haus Deutschland (Frankfurter Rundschau, 9.1.1993) – und lockte den Oberstaatsanwalt Schacht mit seiner Formulierung vom „emotionslosen Ochsenfrosch, dem die Untat ins Gesicht geschrieben“ stehe – verstärkt noch durch den Zusatz von der „schändlichen Geschichte einer schändlichen Justiz“ – aus der juristischen Reserve – mit durchschlagendem Erfolg. Für die Dramatik dieses Prozesses, dieses staatlichen Täterschutzes, wählte Giordano diese Formulierung: „Es heißt, der Mensch kann nur einmal sterben. Auch das ist ein Irrtum. Martin Finkelgruen, wie unzählige seiner Leidensgenossen, wurde zweimal getötet: einmal physisch, und ein anderes Mal dadurch, daß gegen Anton Malloth kein Verfahren eröffnet wurde.“
Finkelgruen zeichnet in seinem „Nachtrag“ zum Buch Schachts offenkundig wohl kalkulierten formalen Schritte und Begründungen nach, um die Akte des NS-Täters endlich und für immer vom Tisch zu bekommen. Gut drei Monate nach seiner ersten Anzeige, am 6.6.1989, fand die bereits erwähnte Vorladung Finkelgruens statt. In der Anhörung wollte Schacht von Finkelgruen nur wissen, „woher ich mein Wissen über den Inhalt der besagten Verfügung hätte.“ Später stieß er noch auf einen Aktenvermerk der Dortmunder Staatsanwalt vom 5.8.1988, in dem notiert war: „…Eine andere Möglichkeit, das Verfahren abzuschließen, ist nicht zu ersehen.“ (in: Finkelgruen 2002, S. 105)
Dass seine Bemühungen als Enkel eines am 10.12.42 in Theresienstadt ermordeten jüdischen Großvaters und als Sohn eines am 29.7.43 in Shanghai an den Folgen der Verfolgung verstorbenen jüdischen Vaters nicht „dem mutmaßlichen Willen des beklagten Landes“ entsprechen sollte enthielt für Finkelgruen die unzweideutige Botschaft, dass er als Jude nicht in Deutschland leben dürfe. Es erinnerte ihn an seine gut zehn Jahre zurückliegenden Bemühungen um die zumindest posthume Ehrung der Kölner Edelweißpiraten. Seinerzeit, so merkt er in seinem Nachtrag an, „schlugen mir überall die Kälte und der Zynismus der Behörden entgegen.“ (1992, S. 168) Finkelgruen beschließt sein Buch (1992) mit einem Gedicht Erich Frieds, welches dieser ihm im Januar 1980 am Rande einer gemeinsamen Podiumsdiskussion gewidmet hatte: Beschreibung der ehrenhaften Bürger, die den Mord nicht Mord und die Opfer nicht Opfer nennen wollen ist es überschrieben. Es endet so:
„Sie sind furchtbar jämmerlich / und sie sind jämmerlich furchtbar / und sie sind immer noch / erbärmlich erbarmungslos.“
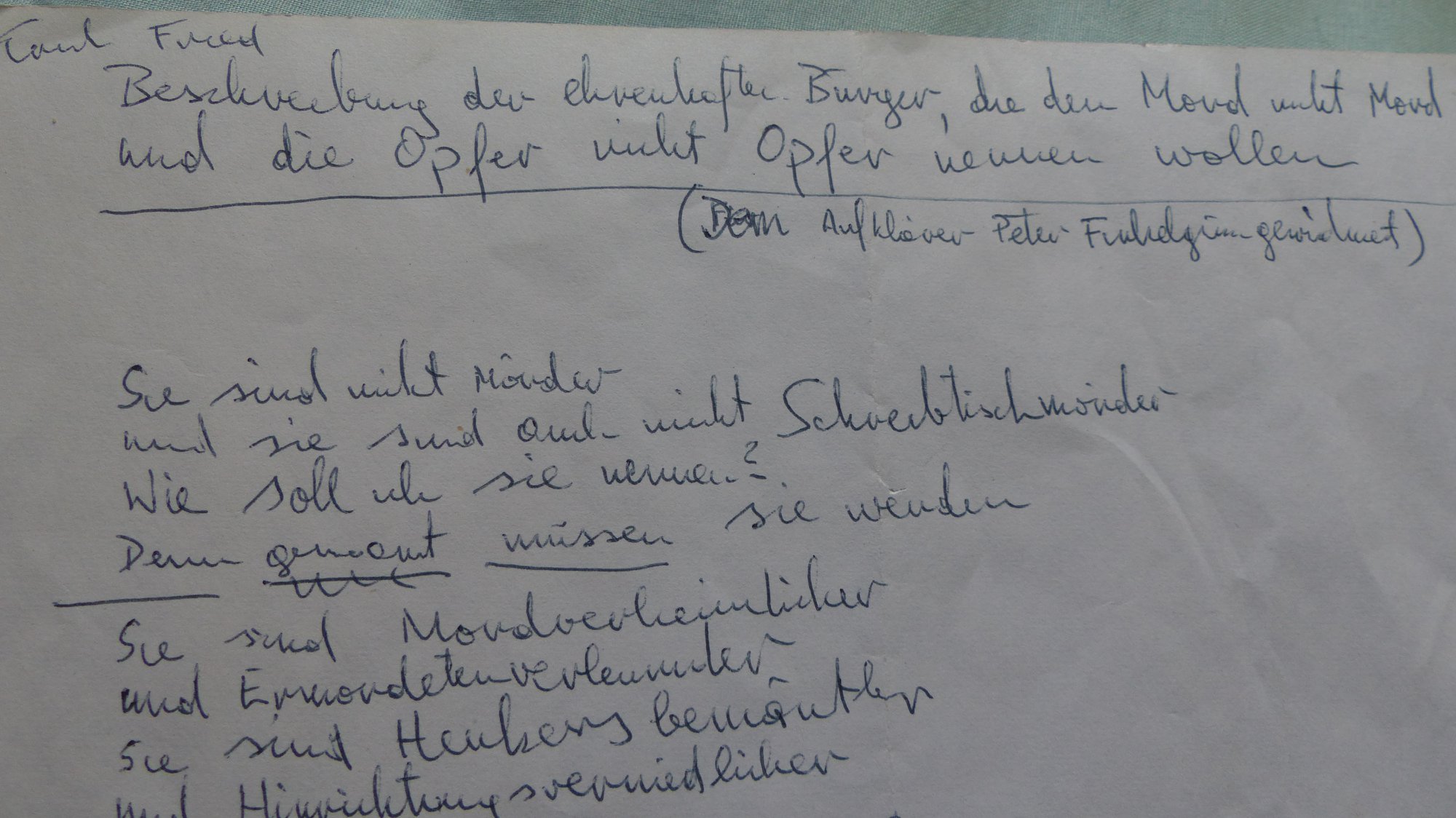
1993: Antisemitische Drohbriefe: „Du ekelhafter Pressejud!“
Finkelgruens langjähriger Freund und Unterstützer Ralph Giordano vermochte die Anzahl der Morddrohungen, die ihn brieflich und telefonisch erreichten, kaum noch zu zählen. Anfang der 1990 Jahre ereilte ihn die 221. Morddrohung (Kaufhold 2013a, 2013b); der streitbare Journalist und Überlebende nahm es mit Gelassenheit. Er stand weiterhin im Kölner Telefonbuch, mit Festnetznummer und seiner Köln-Bayenthaler Anschrift. Seine am 9.1.1993 in der Frankfurter Rundschau publizierte kämpferische Besprechung von Finkelgruens Buch dürfte die Anzahl der gegen ihn gerichteten Morddrohungen noch einmal erhöht haben. „Ich bin angenagelt an dieses Land“ blieb Giordanos ein Jahr zuvor in Buchform gegossenes Credo.
Den türkischstämmigen Rechtsanwalt Mehmet Daimagüler, seit 2012 Anwalt im NSU-Prozess, ereilen wegen seines Insistierens und seiner auch in Talkshows geäußerten klaren Worte nahezu täglich Morddrohungen. In einem Interview mit dem Stern vom April 2017 (Hernkind 2017) schätzte er sie auf etwa 1000 pro Jahr: „Wenn ich bei Anne Will in der Talkshow sitze, habe ich danach etwa 50, 60 Morddrohungen im Mailordner. Früher habe ich Vieles angezeigt. Aber das ist mir zu mühsam. Es kommt ja eh nichts dabei heraus“, merkt er lakonisch an.
Die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Friesel hat 14.000 judenfeindliche Briefe wissenschaftlich aufgearbeitet; die Mehrzahl von ihnen wurde mit Klarnamen und Nennung der eigenen Anschrift verschickt. Adressat war der in Berlin sitzende Zentralrat der Juden. Aber auch die israelische Botschaft in Berlin erreicht eine Vielzahl vergleichbarer Schreiben. Schwarz-Friesel hebt in einem Interview mit der Wochenzeitung Jüdische Allgemeine (2014) die emotionale Belastung hervor, die allein das systematische Aufarbeiten dieser Briefe für die Wissenschaftler darstellt: „Ich hatte am Anfang der Studie eine hoch motivierte Mitarbeiterin, die nach einem Monat in Tränen aufgelöst zu mir kam und sagte: „Ich kann nicht mehr, ich steige aus!“ Auch als Konsequenz daraus sprechen wir als Team einmal in der Woche ausführlich über diese Belastung. Das ist notwendig – andernfalls würde man wohl bei dieser Art von Briefen früher oder später verzweifeln.“ (Engel 2014)
Wie jeder bekanntere jüdische Publizist hat auch Peter Finkelgruen im Laufe der Jahre antisemitische Schreiben, vor allem jedoch telefonische Drohanrufe erhalten. Einige hiervon finden sich in seinen Malloth-Unterlagen. Zwei seien in exemplarischer Hinsicht wiedergegeben. Sie stammen aus dem Jahr 1993, offenkundig als Reaktion auf Haus Deutschland (1992).
Ein roter Briefumschlag, korrekt frankiert, die Farbe ist schon etwas ausgeblichen. Der Stempel vom 12.11.1993 verzeichnet 45127 Essen als Postleitzahl des Absenders (also die Nachbarstadt Dortmunds). Ordentlich mit Schreibmaschine getippt steht auf dem Briefumschlag: „An den Juden Peter Israel Finkelgrün, Siebengebirgsallee 77, 51147 Köln.“ Der Brief kann anfangs nicht zugestellt werden, die Postleitzahlen haben sich 1993 verändert. Per Kugelschreiber hat der Postbeamte die falsche Postleitzahl – 51147 – durchgestrichen und handschriftlich „50939“ ergänzt. Das „Jude Peter Israel“ hat ihn offenkundig nicht irritiert.
Im Umschlag ein kleiner, eigenhändig mit der Schere zugeschnittener, beidseitig maschinengeschriebener Brief. Er wurde, wie die gelegentlichen nach oben verschobenen Buchstaben nahelegen, mit einer Schreibmaschine getippt:
„Du ekelhafter Pressejud! Wir werden Dich und Deinen Rassegenossen R. Giordano sonderbehandeln, wenn Du nicht aufhörst, anständige Volksgenossen zu verleumden und zu beleidigen! Wenn Du das gleiche Schicksal erleiden willst wie Dein Großvater, mach´ nur so weiter! Hier ist immer noch Deutschland und nicht Dein Judenstaat! Das deutsche Volk hat von Dir die Schnauze voll, Du dreckiges Judenschwein!“
Dann folgt, akkurat in vier Zeilen getippt:
„Merkvers: Jude Itzig / Nase schwitzig / Kaftan speckig / Arschloch dreckig.“ Gegenüber steht: „Trau keinem Fuchs auf gruener Heid´/ und keinem Jud bei seinem Eid! Dr. Martin Luther. ALSO: Halt´ die Fresse, wenn Du weiterleben willst! Mit deutschem Gruß, Aktionsfront kritischer Deutscher. b.w.!“
Auf der Rückseite dann: „Auch der Herr Engert kann Dich nicht vor uns schützen! Wir bitten vielmals um Entschuldigung, daß unser Schreiben nicht rechtzeitig zum 55. Jahrestag der Reichskristallnacht eingetroffen ist!“
Der zweite Brief, diesmal ein verblichenes weiß-grau, vom 29.12.1993 – also ein würdevoller, formvollendeter Jahresabschluss. Der Brief ist korrekt mit 100 Cent frankiert, als Anschrift steht, diesmal mit korrekter Postleitzahl: „ISRADOK Postfach 420248, 50937 Köln“; auch bei diesem Brief fehlt die Absenderangabe. Der Brief wurde mit dem Computer erstellt, ein großformatiger Schriftzug, überschrieben mit „Warnung! / Ihr Juden ohne Vorhaut ! seid nicht immer so vorlaut!“
Darunter steht rechts ein aus dem Internet kopierter gelber Davidstern, darunter prangt ein breit lachender Mann.
1993: Dritte Wiederaufnahme. Der Fund der Gauck-Behörde
1993 muss Schacht das Verfahren wieder aufnehmen, weil die Gauck-Behörde einen Überraschungsfund gemacht hatte: Sie fanden Akten, gemäß denen 1968 ein Kamerad Malloths aus der Kleinen Festung Theresienstadt vom (Ostberliner) Stadtgericht Groß-Berlin zu Tode verurteilt worden sei. Die Stasi hatte 80 Stunden lang ein Tonband mitlaufen lassen (Der Spiegel, 26.6.2000). Die Akten beziehen sich auf den 1968 in der DDR geführten Prozess gegen Wachholz, gleichfalls Aufseher in der Kleinen Festung Theresienstadt.
Als Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage der NRW-Grünen teilte das NRW-Justizministerium am 20.4.1994 mit, dass Schacht die Ermittlungen doch wieder aufgenommen habe.
1998: „Der schöne Toni, nicht behelligt durch besonders eifrige Ermittlungen deutscher Staatsanwälte“
Die traurige Geschichte ging weiter. Malloth lebte fünf weitere Jahre ungestört im Pullacher Altersheim. Im Juni 1998, zehn Jahre nach Prozessbeginn, berichtete der Spiegel – in der Rubrik: Recht – unter dem Titel „Der schöne Toni“ über den Stand des Verfahrens: Zwei Bonner Juristen, darunter der Rechtsprofessor Raimund Wimmer, hatten nachgewiesen, dass der inzwischen 86-Jährige – „unterstützt von einer Hilfsorganisation für Alt-Nazis und nicht behelligt durch besonders eifrige Ermittlungen deutscher Staatsanwälte“ – kein deutscher Staatsbürger sei und somit problemlos an Tschechien ausgeliefert werden könne. Juristisch war dies ein Durchbruch. Die Staatsanwaltschaft wusste, dass ihr dies Schwierigkeiten einbringen könnte.
Malloths fünfjährige Tätigkeit in Theresienstadt beschrieb der Spiegel mit diesen Worten: „Bei der Arbeit gab sich Anton Malloth gern elegant. Er trug Handschuhe, war glatt rasiert und im Gesicht gepudert. Wenn er mit Stahlruten einen Häftling blutig geschlagen hatte, schob er das dunkle, gescheitelte Haar zurück und richtete seine Uniform. Seine Opfer nannten ihn den „schönen Toni“. Malloth galt als einer der brutalsten Aufseher im berüchtigten Polizei-Gefängnis Kleine Festung Theresienstadt in Nordböhmen. (…) Mehr als 700 Menschen wurden während des deutschen Protektorats in der Kleinen Festung ermordet oder zu Tode gequält.“
Und er zitierte aus weiteren Zeitzeugenberichten: „“Der schöne Toni war ungewöhnlich erfinderisch beim Foltern“, erinnert sich der ehemalige Häftling Albert Mayer, 78. „Er hat Menschen getötet, die nichts verbrochen hatten“, sagt Vera Zahourková, 73, die ebenfalls in Theresienstadt einsaß: „Malloth war eine Bestie, das sollen alle wissen.““ Finkelgruen wird vom Spiegel mit den Worten zitiert, dass es ihm nicht vorrangig um die Verurteilung der betagten Mörders, sondern „um die Würde der Opfer und um die Glaubwürdigkeit des Rechtsstaates“ gehe.
Der Spiegel zeichnet noch einmal im Detail die Prozessgeschichte und die rechtsgültigen Urteile gegen Malloth aus der CSSR sowie aus Österreich nach: „Die deutsche Justiz sah sich bislang nicht in der Lage, den früheren SS-Mann vor Gericht zu stellen oder wenigstens eine Anklage zu formulieren. Dabei ließ sie sich auch nicht von der Tatsache irritieren, daß Malloth bereits 1948 in der Tschechoslowakei in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden war und daß in Österreich ein Haftbefehl gegen ihn vorliegt.“
Im April 1998, zwei Monate vor der neuen Spiegel-Dokumentation zum Malloth-Prozess, war Schacht noch einmal zur Vernehmung nach Prag gefahren; der inzwischen 86-jährige Malloth schwieg weiterhin. An seinem Willen, das Verfahren wieder einzustellen, ließ Schacht erneut keinen Zweifel aufkommen. Die vollständig vorhandenen Gerichtsakten aus dem Jahr 1948 lehnte er als Verhandlungsbasis erneut ab. Finkelgruen hingegen, zitiert ihn der Spiegel, habe ihn darauf verwiesen, dass die Entscheidung doch Sache des Gerichts sei – und nicht die der Staatsanwaltschaft. Vergeblich.
In dem Beitrag zeichnete sich auch bereits die – scheinbar überraschende – Wendung des Prozesses ab, die dann drei Jahre später zum Urteil gegen Malloth führte: Der bayerische Innenstaatssekretär Regensburger (CSU) wandte sich nun an seinen italienischen Kollegen Sinisi und bat „um eine abschließende Klärung der tatsächlichen Staatsangehörigkeit des „SS-Kämpfers“ Malloth“. Zugleich versicherte er: „Die bayerische Verwaltung hat keinerlei Anlaß, sich in irgendeiner Weise vor Malloth zu stellen.“ Wenn Malloth kein Deutscher sei könne er „in ein Land abgeschoben werden, das ihn aufnimmt.“ Tschechiens Justizministerin Vlasta Parkanová habe angekündigt, sie würden Malloths Auslieferung beantragen.
Der Präsident des tschechischen Senats, Petr Pithart – dessen Vater hatte gleichfalls in Theresienstadt gelitten – , setzte sich zeitgleich gleichfalls dafür ein, dass Malloth angeklagt werde – und sei es in seinem eigenen Land. Die Todesstrafe sei ja zwischenzeitlich in der Tschechei abgeschafft. „Dieser Mensch muß vor Gericht, damit seine Schuld in aller Form festgestellt wird“, zitiert der Spiegel Pitthart abschließend.
Es kam, wie nicht anders zu erwarten war: Ein Jahr später, im April 1999, wurde auch dieses Verfahren eingestellt. Am 18.6.1999 erhielt Finkelgruen über seinen Anwalt vom Staatsanwalt Hamm den letzten Bescheid: Es gebe weiterhin keinerlei Erkenntnisse, die für „einen hinreichenden Tatverdacht gegen Malloth“ ausreichten. „Dies gilt auch für den beklagenswerten Tod Ihres Großvaters Martin Finkelgruen.“ (Winkel 2001)
Am 21.6.1999 berichtete der Spiegel unter der Überschrift „Ergebnislos ermittelt“ von der erneuten Einstellung auch dieses Verfahrens gegen den inzwischen 87jährigen Malloth durch Schacht. Trotz eigenen Bemühens, so betonte Schacht, habe ein „im Sinne eines hinreichenden Tatverdachts beweissicherer Nachweis“ von Mordtaten nicht erbracht werden können. Die „generelle Feststellung“ von Malloth Brutalität und von seinen Morden sei nicht ausreichend. Zeitgleich teilte die Prager Staatsanwaltschaft, dass sie nun ein Ermittlungsverfahren gegen Malloth überprüfe.
2000: „Aus Langeweile getötet“. Der unbekannte Zeuge
Ein weiteres Jahr später berichtete der Spiegel (26.06.2000), diesmal unter der Überschrift „Aus Langeweile getötet“ von einem erneuten Verfahren gegen Malloth: Im November 1999 hatte sich bei der Prager Staatsanwaltschaft ein inzwischen 73-jähriger Mann, Richard L., gemeldet: Er könne bezeugen, dass Malloth im September 1943 „bei der Feldarbeit einen jüdischen Gefangenen erschossen habe – weil der offenbar hungrige Mann einen Kohlkopf unter seiner Jacke versteckt hatte.“ Der Zeuge war seinerzeit erst 16 Jahre und in der „Kleinen Festung“ Theresienstadt der jüngste Häftling. Er habe sich den Judenstern von der Kleidung gerissen, sei aber dennoch wiedererkannt und fürchterlich misshandelt worden. „Im Winter 1944/45, hat er aus der jüdischen Zelle im I. Hof der Kleinen Festung mit angesehen, wie zwei Gefangene sich bei bitterer Kälte nackt ausziehen mußten und mit kalten Wasser aus einem Schlauch bespritzt wurden, bis sie tot umfielen“, schreibt Winkel (2001).
Nun jedoch fühlten sich die Dortmunder Staatsanwaltschaft nicht mehr zuständig: Sie gab den Vorgang an die für Pullach örtlich zuständige Staatsanwaltschaft München 1 ab. Was in Dortmund gut 35 Jahre lang gedauert hatte ging in München überraschend schnell: Bereits am 25.5.2000 bewirkte die Münchner Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Haftbefehl gegen Malloth. Georg Bönisch vom Spiegel beendet seinen Beitrag mit der lakonischen Bemerkung: „Ob Malloth je der Prozess gemacht wird, ist ungewiss. Der Mann ist 88, fast blind und kann kaum noch laufen.“ (Spiegel, 26.06.2000)
2001: Die Zeugin Vera Treplin – und das Münchner Urteil
Das Gerichtsverfahren fand nun, basierend auf dem Gutachten der beiden renommierten Bonner Juristen – diese hatten ihr Gutachten für Finkelgruen kostenlos erstellt – einen ganz ungewohnt und überraschend zügigen Abschluss: Am 27.11.2000 berichtete der Spiegel von der unmittelbar bevorstehenden Verfahrenseröffnung. Am 30.5.2001, nach nur drei Wochen Prozessdauer, wurde der inzwischen 89-jährige Malloth wegen Mordes in zwei Fällen zu einer lebenslangen Haftstrafe rechtskräftig verurteilt (Der Spiegel: „Lebenslang für KZ-Aufseher Malloth“, 30.5.2001) – 56 Jahre nach Ende der Nazizeit. Nur diese zwei Morde konnten Malloth noch zweifelsfrei nachgewiesen werden. Der Mord an Martin Finkelgruen fand hierbei keine Berücksichtigung mehr. Die meisten Zeugen und Opfer lebten nicht mehr, die Versäumnisse der bundesdeutschen Justiz hatten Malloth 56 Jahre lang geschützt. Der Spiegel zitiert Malloth mit der Bemerkung: „Nicht alles war in Ordnung, was gesagt worden ist“.
Dem 1944 geborenen Jürgen Winkel, er hatte schon in den 1960er Jahren für die Aktion Sühnezeichen in Theresienstadt gearbeitet und war Verfasser des Theresienstadt-Lexikons, war der Name Malloth seit 1968 geläufig. Überlebende hatten ihm immer wieder zwei NS-Täter genannt, die ihnen durch ihre besondere Brutalität aufgefallen waren. Einer davon war Anton Malloth. Die Prozessgeschichte gegen Malloth erscheint ihm, der sehr viele NS-Prozesse erlebt hatte, als eine besonders „groteske und in ihren Verästelungen kaum nachvollziehbare Geschichte.“
„Vermutlich gibt es außer uns niemanden mehr, der noch ein hohes persönliches Interesse haben könnte, Anton Malloth auf der Anklagebank zu sehen“
Der Prozess sollte wegen des hohen Alters des Angeklagten möglichst rasch abgeschlossen werden. Nur ein Teil der Anklagepunkte und Zeugen wurde berücksichtigt. Eine weitere Zeitzeugin, 1938 in Köln geborene Psychotherapeutin Vera Neubrand – später: Vera Treplin – selbst eine jüdische Überlebende – , sollte eigentlich am 22.6.2001 vor Gericht gegen Malloth aussagen. Ihre Großmutter hatte im September 1944 im jüdischen Altersheim in Köln auf ihre Deportation gewartet, am 1.10.1944 war sie in das Kleine Lager Theresienstadt verbracht worden, wo sie dem Terror Malloths ausgesetzt war. Nach der Befreiung hatte sie als einzige Überlebende Anzeige erstattet und Massaker gerichtlich dokumentiert. Sie starb 1955. Ihre Enkeltochter Vera Neubrand – sie überlebte das Konzentrationslager Theresienstadt – hatte für ihre vorgesehene Zeugenaussage ihre traumatischen Erinnerungen zusammen gefasst (Neubrand 2001): „Als die Medien 1988/89 über einen gewissen Anton Malloth berichteten, der von Italien nach München abgeschoben worden sei, wurde mir erst durch die Nennung des Beinamens „schöner Toni“ und den Ort Theresienstadt bewußt, daß dies der Mann war, dessen grauenhafte Taten mich seit meiner Kindheit begleiten und den zu finden ich mir nie hatte vorstellen können.“ (Neubrand 2001)
Da das Urteil zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits gesprochen war brauchte Vera Treplin nicht mehr angehört zu werden. Später hat sie ihre Zeugenaussage dennoch schriftlich niedergelegt (Neubrand 2001). Am 17.1.1998, dies sei nur angedeutet, nahm Vera Treplin mit Peter Finkelgruen brieflich Kontakt auf und dankte für die Zusendung von Erlkönigs Reich (PAF). Treplin war Psychotherapeutin geworden, hatte hierbei jedoch, wegen ihrer jüdischen Biografie als Überlebende, vielfältige – wie ich es unter Verweis auf Sammy Speier (Kaufhold 2012) sowie auf Edith Jacobson (Kessler & Kaufhold 2015) formulieren würde – typische Reaktionen von massiver Ablehnung und Einfühlungsverweigerung durch ihre Berufskollegen erfahren. Dennoch unternahm sie immer wieder verzweifelte Versuche eines „Dialoges“ mit ihrer psychotherapeutischen Zunft. Nach mehreren Versuchen musste sie für sich selbst zur Kenntnis nehmen, dass ihre Prägungen als Jüdin und KZ-Überlebende mit ihrer psychoanalytischen deutschen Zunft nicht kompatibel sind: Sie musste diese verschweigen, um keine Ablehnung zu erleben (Neubrand 1991, Treplin 1992, 1997). Ihr 1997 publiziertes Manuskript „Versuchte Enteignung“ ist ein eindrücklicher Beleg für die Unmöglichkeit dieses Dialoges auch unser Psychotherapeuten (vgl. Way 2007).
In besagtem Brief vom 17.1.1998 an Finkelgruen bemerkt die 60-Jährige: „Über das Buch und die Widmung habe ich mich sehr gefreut und es gleich noch einmal gelesen. (…) Allerdings braucht man eine hohe Konzentration, um die parallel angeordneten Lebensläufe in der jeweiligen Tragweite zu erfassen. Stilistisch ist Ihr Text wunderbar. (…) Vermutlich gibt es außer uns niemanden mehr, der noch ein hohes persönliches Interesse haben könnte, Anton Malloth auf der Anklagebank zu sehen; wobei ich persönlich mich mehr noch über Herrn Schacht aufregen kann. Die Feigheit und Verschlagenheit eines Massenmörders, der sich seiner Strafe entzieht, ist mir noch eher begreiflich, als der Versuch des Juristen, diesen Mann zu decken. Überhaupt verbindet mich mit dieser nachgewachsenen Generation ein hohes Maß an Wut und Enttäuschung. In meinem Aufsatz (s.o., d. Verf.) (…) beleuchte ich recht typische Verhaltensweisen einer Berufsgruppe, in diesem Fall die der Psychotherapeuten; wobei ich glaube, daß diese Erfahrungen in jeder anderen Gruppe ähnlich ausgefallen wären. Abgesehen davon, daß wir als Enkel uns wünschen, daß endlich Recht gesprochen wird über einen Mann, der massiv in unser persönliches Leben eingegriffen hat, ohne daß wir ihm je begegnet wären (Gott sei Dank!), verbinden uns noch einige andere, sehr traurige Erfahrungen, wie z.B. der frühe Verlust der Eltern.“ (PAF)
Weitere Reaktionen auf diesen Urteilsspruch im Jahr 2001, so der Prozessbericht von Andrea Livnat (seinerzeitiger Name: Übelhack (2001)), werfen ein ergänzendes Licht auf den Prozess und auf Malloth selbst:
„Schon der Weg in den „Gerichtssaal“ ist unangenehm. Der Prozeß gegen den 89-jährigen Anton Malloth findet in der Justizvollzugsanstalt statt, da man dem Angeklagten die Fahrten ins Gerichtsgebäude nicht zumuten möchte. (…) Warten im Eingangsbereich, eine schwer zu beschreibende Unruhe, auch unter den routinierten Journalisten, Sprachengewirr, Deutsch, Tschechisch, Hebräisch. (…)
Der Vorsitzende Richter Jürgen Hanreich wendet sich zunächst direkt an Malloth, um ein paar eindringliche Worte voraus zu schicken. Es werde kein Verfahren um jeden Preis geben (…) aber „wir haben eine Verpflichtung den Menschen gegenüber, die unsägliches Unrecht erlitten haben“. Daher lege er Malloth nahe, noch einmal zu überdenken, ob er sich dem Verfahren nicht stellen wolle, „es wäre ein großer Tag, vielleicht auch für Sie“. Malloth bleibt regungslos. (…) Aber Mitleid kam mir keine einzige Minute in den Sinn. Was bleibt ist Ekel. Ekel vor einem alten Greis, der von einem Speiseröhrentumor spricht und diesen nicht untersuchen läßt (…), der seine Staatsangehörigkeit nicht weiß und angeblich auch der Anklageschrift nicht folgen kann. Der vor 60 Jahren unvorstellbar grausame Taten beging und über den man heute sagen muß, man dürfe kein Mitleid mit ihm haben.“ (Übelhack 2001)
„Im Innern meines Körpers ein Zittern. Der Magen verkrampft sich. Ich werde gleich kotzen.“
In Haus Deutschland beschreibt Finkelgruen seine emotionale Reaktion auf Schachts jahrelangen Verweigerungsstrategien an einer Stelle eindrücklich:
„Im Augenblick, in dem die Wut hochdrängen will, spüre ich die Angst. Sie war zuerst, blockiert jetzt die Wut, gewinnt Herrschaft über meinen Körper. Im Innern meines Körpers ein Zittern. Der Magen verkrampft sich. Ich werde gleich kotzen. Aber es geschieht nicht, ich kotze nach innen. Ein Druck in der Brust, wie vor einer Explosion, vor dem großen Knall. Aber auch das geschieht nicht. Ich werde implodieren. Ein Ring um meinen Kopf. Ein Gürtel, der mich hält und zusammendrückt. Ich erkenne die Dinge nicht, die die ich sehe. Starrheit breitet sich aus in mir, die Gegenbewegung zum Zittern. Ein Verwundern, dass ich nicht umfalle. Ich falle nicht um. Ich schrumpfe nach innen, löse mich auf, bringe mich zum Verschwinden. Bis zum Schluss stehe ich aufrecht und gerade, während im Innern alles zerbröselt.
Ich wehre mich gegen dagegen, meine Wut auf die Falschen zu richten. Bitte undeutlich um Verzeihung. Danach ein Gefühl der Entfremdung. Schuldgefühle. Brennmaterial für meine Wut auf die, die meine Angst verursachen. Wie Stämme sich verästeln, verzweigt sich die Angst in kleinste, dünnste Zweige. Ein vielfältig verästelter Strauch wächst heran. Ja, Wut und Angst sind ein Paar. Das Paar bin ich.“ (Finkelgruen 1992, S. 96)
Die Angst ist in ihm geblieben. Mal ist sie da, mal wieder weg. Literarisch hat er sie beispielsweisein seiner kurzen Erzählung Der Bus war halb leer (Finkelgruen 2009) in einem Band seines Exil-Pens aufgearbeitet.
Der deutsche Mörder, der „niemals der NSDAP angehört“ und während seiner „ganzen Dienstzeit keinen einzigen Menschen ermordet oder misshandelt“ haben will wie auch der deutsche Oberstaatsanwalt und „emotionslose Ochsenfrosch, dem die Untat ins Gesicht geschrieben“ stehe, lebten frei von Schuld und Scham ihr – vermutlich relativ glückliches – Leben. Sie waren die Gewinner.
Der historische Bruch, den Auschwitz „und alles, was der Name symbolisiert und materialisiert“ (Ralph Giordano) gerissen hat, bleibt und wird noch für weit über 200 Jahre bestehen bleiben.
Ein kurzer Epilog: Vor vielen Jahren, Mitte der 1990er Jahre, bei einer seiner zahlreichen Lesungen aus Haus Deutschland, wurde Finkelgruen von einem ihm unbekannter Mann angesprochen. Diesem lag ersichtlich daran, mit Finkelgruen in Kontakt zu kommen. Irgendwann stellte er sich vor: Er sei der Sohn von Schacht. Er habe durchaus Schwierigkeiten mit dem Verfahren gegenüber Malloth, hob er hervor. Zugleich betonte er jedoch seine Loyalität zum Vater.
[„Mich erfüllte ein Gefühl von Stolz. Ich hatte es geschafft“ – Peter Finkelgruen wird 80]
Literatur:
Ambros, P. (2013): Das wortreiche deutsche Schweigen. Hamburg: Argument Verlag; Buchbesprechung: http://buecher.hagalil.com/2013/08/ambros/
Baum, G. (1981/2020): „Wie wird heute mit jenen umgegangen, die ihren Widerstand gegen die Nazis konsequent zu Ende brachten?“ Ein Vorwort von Gerhart Baum. In: Kaufhold/Livnat/Engelhart (Hg., 2020), S. 21-23.
Baum, G. (2019/2020): „Unsere Aufgabe ist es, die Demokratie zu verteidigen.“ Ein Vorwort von Gerhart Baum. In: Kaufhold/Livnat/Engelhart (Hg., 2020), S. 13-17
De Gruyter, S. (2011): Der Nürnberger Ärzteprozess 1946/47. Erschließungsband zur Mikrofiche-Edition.
Der Spiegel (1998): Der schöne Toni, 1.6.1998.
Der Spiegel (1999): NS-Verbrechen: Ergebnislos ermittelt, Der Spiegel 21.06.1999.
Der Spiegel (2000): SS-Verbrechen: Aus Langeweile getötet, Der Spiegel 26.6.2000.
Der Spiegel (2000): NS-Prozess: Viertes Verfahren, Der Spiegel, 27.11.2000.
Dillmann, H.-U.: Juristen in Seilschaft. An NRW-Sozialgerichten gab es mehr Nazirichter als bislang vermutet, Jüdische Allgemeine, 5.1.2017.
Engel, P. P. (2014): „Antisemitismus ist ein Glaubenssystem“. Monika Schwarz-Friesel über 14.000 judenfeindliche Briefe, gefährliche Stereotype und Jakob Augstein, Jüdische Allgemeine, 17.2.2014. Internet: http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/18418
Finkelgruen, P. (1992): Haus Deutschland. oder Die Geschichte eines ungesühnten Mordes. Hamburg: Rowohlt.
Finkelgruen, P. (1997): Erlkönigs Reich. Die Geschichte einer Täuschung. Hamburg: Rowohlt.
Finkelgruen, P. (2002): Kleine Festung Theresienstadt. Oder wie man Geisel der Verhältnisse bleibt. Protokoll einer Scheidung. In: Behrens, K. (Hg.) (2002): Ich bin geblieben – warum? Juden in Deutschland – heute. Gießen: Psychosozial Verlag.
Finkelgruen, P. (2009): Der Bus war halb leer. In: Alioth, G./H.-C. Oeser (Hg.): Nachgetragenes. 75 Jahre PEN-Zentrum deutschsprachiger Autoren im Ausland, Heidelberg: Synchron Publishers.
Giordano, R. (2012): Für Peter Finkelgruen. Zum 70. Geburtstag, haGalil, 5.3.2012: https://www.hagalil.com/2012/03/finkelgruen-6/
Heitzer/Jander/Kahane & Poutrus (Hg., 2018): Nach Auschwitz: Schwieriges Erbe DDR. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung, Wochenschau Verlag; Buchbesprechung durch R. Kaufhold: https://www.hagalil.com/2019/06/schwieriges-erbe-ddr/
Herrnkind, K. (2017): Anwalt Daimagüler: „Die sogenannten Herrenmenschen sind hinterhältig und feige.“, Der Stern, 8.4.2017.
Karny, T. (2001): Nach 56 Jahren steht der SS-Mann Anton Malloth vor Gericht. Rechenschaft statt Rache, Wiener Zeitung, 25.5.2001. Internet: https://www.wienerzeitung.at/startseite/archiv/208563_Rechenschaft-statt-Rache.html?em_cnt_page=2
Karny, T. & H. Halbrainer (1996): Geleugnete Verantwortung – Der „Henker von Theresienstadt“ vor Gericht. Grünbach: Edition Geschichte der Heimat.
Kaufhold, R. (2012): Der Psychoanalytiker Sammy Speier (2.5.1944 – 19.6.2003). Ein Leben mit dem Verlust oder: «Kehrt erst einmal vor der eigenen Tür!» In: Roland Kaufhold & Bernd Nitzschke (Hg.) (2012): Schwerpunktband der Zeitschrift Psychoanalyse – Texte zur Sozialforschung: Jüdische Identitäten nach dem Holocaust in Deutschland Heft 1/2012, S. 96-112. (Siehe auch haGalil, Mai 2016: https://www.hagalil.com/2016/05/sammy-speier/
Kaufhold, R. (2013a): Unermüdlich streitbar. Filmemacher, Romancier, Essayist und Mahner: Ralph Giordano wird 90, Jüdische Allgemeine, 20.3.2013; sowie in Finkelgruen, P. (Hg.) (2013): Jubeljung begeisterungsfähig. Zum 90. Geburtstag von Ralph Giordano (BoD).
Kaufhold, R. (2013b): Du bist davongekommen, du bist davongekommen!“ Filmemacher, Romancier, Essayist und Mahner: Ralph Giordano wird 90, haGalil, 21.3.2013. Internet: http://www.hagalil.com/2013/03/giordano-4/
Kaufhold, R. (2013c): Das wortreiche deutsche Schweigen. Eine Abrechnung von Peter Besprechung von Peter Ambros, haGalil, 1.8.2013: http://buecher.hagalil.com/2013/08/ambros/
Kaufhold, R. (2013d): Im KZ-Drillich vor Gericht. Ein Sammelband beschreibt, wie Serge und Beate Klarsfeld Schoa-Täter aufspürten und der Gerechtigkeit zuführten, Jüdische Allgemeine, 4.7.2013: https://www.juedische-allgemeine.de/kultur/im-kz-drillich-vor-gericht/
Kaufhold, R. (2013e): „Ich erinnere mich an diesen Deutschen ganz genau“ – Erinnerungen an den Lischka-Prozess, haGalil, 29.5.2013: http://buecher.hagalil.com/2013/05/lischka-prozess/
Kaufhold, R. (2018a): Judenfeindliche Gewaltserie in Dortmund, in: Störungsmelder, 26.6.2018: https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2018/06/26/judenfeindliche-gewaltserie-in-dortmund_26715?sort=asc&comments_page=4
Kaufhold, R. (2018b): Vom Feuerwehr-Chef zum Holocaust-Leugner? Störungsmelder, 5.6.2018: https://www.hagalil.com/2018/06/holocaust-leugner/
Kaufhold, R. (2018c): Der Tod einer Nazi-Ikone. Gudrun Burwitz, Protagonistin des Nazi-Unterstützervereins Stille Hilfe, ist tot, haGalil, 3.7.2018: https://www.hagalil.com/2018/07/gudrun-burwitz/
Kaufhold, R. (2018d): Adresse der Linksliberalen. In Köln erinnerte eine Festveranstaltung an die Gründung des Liberalen Zentrums vor 40 Jahren, Neues Deutschland, 27.8.2018
Kaufhold, R. (2018e): Radikaldemokraten und Liberale unter einem Dach. Vor 40 Jahren wurde in Köln das Liberale Zentrum (LZ) gegründet, haGalil 9/2018: https://www.hagalil.com/2018/09/lz-koeln/;
Kaufhold, R. & M. Arndt (2018): „Der Staat Israel ist unser Unglück“. Dortmunds „Die Rechte“ praktiziert öffentlich Antisemitismus und Hetze gegen Israel, in: haGalil, 15.5.2018: https://www.hagalil.com/2018/05/dortmund/
Kaufhold, R. (2020): „Die Kölner Kontroverse“? Bücher über Edelweißpiraten (1980 – 2019). Eine Chronologie, in: Kaufhold/Livnat/Engelhart (Hg. 2020): Peter Finkelgruen: „Soweit er Jude war…“, a.a.O., S. 217-342.
Kaufhold, R. (2020a): Beinahe wäre er Peruaner geworden. Der Weltbürger Peter Finkelgruen und ein Hain zu seinen Ehren, JNF-KKL-Magazin Herbst 2020, Nr. 45, S. 14f. https://www.jnf-kkl.de/wp-content/uploads/NEULAND-46-JNF-KKL-Magazin-Herbst-2020.pdf
Kaufhold, R., A. Livnat & N. Engelhart (Hg., 2020): Peter Finkelgruen: „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln. Norderstedt: Books on Demand. (Buchbesprechung von Martin Stankowski in WDR 3: https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-mosaik/audio-neues-buch-von-peter-finkelgruen—soweit-er-jude-war-100.html)
Keldungs, K.-H. (2019): NS-Prozesse 1945–2015. Eine Bilanz aus juristischer Sicht. Düsseldorf: Edition Virgines.
Kessler, J. & R. Kaufhold (Hg., 2015): Edith Jacobson: Gefängnisaufzeichnungen. Gießen: Psychosozial Verlag.
Kirsch, R. (1990): Kein dringender Tatverdacht. Der Fall Malloth: Wie ein KZ-Aufseher unbehelligt davonkam, Die ZEIT (Nr. 6), 2.2.1990.
Klee, E. (2013): Täter, Opfer und was aus ihnen wurde. Ein Personenlexikon, Frankfurt/M.: Fischer.
Marken, J. (2018): Siegfried Borchardt: Der lange Abstieg einer Naziikone, in: Störungsmelder, 27.9.2018: https://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2018/09/27/haftstrafe-fuer-neonazi-anfuehrer-siegfried-borchardt_27299
Meenzen, S. (2010): Wie ehemalige Nazis in der DDR Karriere machten, Sächsische Zeitung, 21.1.2010.
Müller-Münch, I. (1990): Nur keine Eile, dann erledigt sich der Prozeß fast von selbst. Der Fall Anton Malloth: gegen mutmaßliche NS-Verbrecher wird oft sehr gemächlich ermittelt, Frankfurter Rundschau, 3.1.1990, S. 5.
Neues Deutschland (1988): Galinski empört über Schonung des Kriegsverbrechers Malloth, Neues Deutschland, 13.8.1988.
Neubrand, V. (2001): Zur Urteilsverkündung im Fall Malloth: Eine nicht gehörte Zeugenaussage, in: Lexikon Ghetto-Theresienstadt: http://www.ghetto-theresienstadt.info/pages/m/Mallotha.htm
Regele, L. W. (2007): Meran und das Dritte Reich. Wien-Bozen: Studien Verlag.
Richter, K. (2010): Entschädigung: Reise in eine andere Welt. Wie ein Sozialrichter durch persönliche Gespräche mit NS-Opfern neue juristische Wege beschreitet.
Schröm, O. & A. Röpke (2002): Stille Hilfe für braune Kameraden. Das geheime Netzwerk der Alt- und Neonazis. Berlin: Ch. Links Verlag.
Schubert, D. (1997): Unterwegs als sicherer Ort. Kinofilm. Internet: http://www.schubertfilm.de/dvds/unterwegs-als-sicherer-ort/
Seehaus, G. (2017a): Wo denn und wie?, Books on Demand; s. diese Buchrezension: https://www.hagalil.com/2017/10/seehaus-finkelgruen/
Seehaus, G. (2017b): Vatersprache, Books on Demand; s. diese Buchrezension: https://www.hagalil.com/2017/11/vatersprache/
Treplin, V. (1992): Eine Auseinandersetzung mit dem Buch von A. Eckstaedt, Nationalsozialismus in der „zweiten Generation“, Luzifer-Amor (5. Jg.), H. 9: Hitlerdeutungen.
Treplin, V. (1997): Versuchte Enteignung, Manuskript (Privatarchiv Peter Finkelgruen). Gekürzt erschienen im November 1997 unter dem Titel „Fremde in der Psychotherapie“ in der Zeitschrift „Die Psychotherapeutin“ (Edition Das Narrenschiff)
Übelhack, A. (2001): Prozess gegen Anton Malloth eröffnet: Mitleid mit einem alten Greis?, haGalil, 24.4.2001: http://judentum.net/deutschland/malloth.htm
Way, I. (2007): Spannung aushalten. Zum ersten Mal seit der Nazizeit trafen sich internationale Psychoanalytiker zu einem Kongress in Berlin, Jüdische Allgemeine, 2.8.2007: http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/4200
Wagner, B. (2017): Vertuschte Gefahr: Die Stasi & Neonazis, Bundeszentrale für politische Bildung, 2.1.2017. Internet: https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-geschichte/stasi/218421/neonazis
Winkel, J. (2001): Anton Malloth: Laßt sie doch endlich in Ruhe?, in: Lexikon Ghetto-Theresienstadt: http://www.ghetto-theresienstadt.info/pages/m/Mallotha.htm
Der Verfasser dieser Studie, Dr. Roland Kaufhold, hat zu Peter Finkelgruens Buch über die Edelweißpiraten diese Begleitstudie verfasst:
Kaufhold, R. (2020): „Die Kölner Kontroverse“? Bücher über Edelweißpiraten (1980 – 2019). Eine Chronologie, in: Kaufhold/Livnat/Engelhart (Hg. 2020): Peter Finkelgruen: „Soweit er Jude war…“, S. 217-342, in:
Kaufhold, R., A. Livnat & N. Engelhart (Hg., 2020): Peter Finkelgruen: „Soweit er Jude war…“ Moritat von der Bewältigung des Widerstandes. Die Edelweißpiraten als Vierte Front in Köln. Norderstedt: Books on Demand.
[1] Ein Hinweis: Der Nachname „Finkelgruen“ wurde ursprünglich als „Finkelgrün“ geschrieben, insofern findet man in der Literatur die Schreibweise „Martin Finkelgrün“. Nach Peter Finkelgruens Einwanderung nach Deutschland im Jahr 1959 verwandelte sich die heute gängige Schreibweise in „Finkelgruen“ – die zuständige englische Behörde hatte kein „ü“ in ihrer Tastatur. Zur Vereinfachung habe ich den Nachnamen deshalb durchgehend als „Finkelgruen“ ausgeschrieben.
[2] Peter Finkelgruens „Vorlass“ ist im Archiv der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA), Vorlass Peter Finkelgruen, Köln, unter der Nummer RWWA 570-16-1 archiviert.
[3] Alle nachfolgenden, nicht näher gekennzeichneten Seitenangaben beziehen sich auf Finkelgruens „Haus Deutschland“ (1992).
[4] Die Details der Befreiung sind hier beschrieben: http://www.ghetto-theresienstadt.info/pages/b/befreiung.htm
[5] Für diese sehr umfangreiche Studie habe ich die gesamten, seinerzeit in meiner Wohnung befindlichen Unterlagen Peter Finkelgruens zur Verfügung gehabt. Darunter befanden sich ca. 20 Aktenordner Finkelgruens mit Prozessunterlagen, Dokumenten, privaten Briefen etc. Hieraus habe ich längere Passagen und zahlreiche Dokumente in dieser Studie eingearbeitet. Diese Quellen kennzeichne ich in dieser Studie durchgehend mit PAV: Privatarchiv Finkelgruen. Peter Finkelgruens „Vorlass“ ist im Archiv der Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA), Vorlass Peter Finkelgruen, Köln, unter der Nummer RWWA 570-16-1 archiviert. Ein Großteil der Angaben zum Malloth-Prozess beziehen sich, sofern sie nicht anderweitig gekennzeichnet sind, auf Materialien aus dem Privatarchiv von Finkelgruen (PAF).
[6] Einige weitere Stellungnahmen der damaligen Zeit wurden seinerzeit von verschiedenen Internetmagazinen veröffentlicht, u.a. ein Brief von Zuroff: Shalom: http://www.shalom-magazine.com/Article.php?id=410223; weiterhin diverse, miteinander verlinkte Presseerklärungen zu Malloth auf haGalil: http://www.hagalil.com/archiv/99/07/Malloth.htm
[7] Siehe u.a. die sechs Seiten umfassende Anfrage der Grünen MdBs Annelie Buntenbach und Volker Beck für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 27.11.1997, die sich im Vorlass Finkelgruens befindet und zusätzlich publiziert worden ist: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/13/093/1309310.pdf
[8] Siehe die von Roland Kaufhold verfasste Studie über die Stille Hilfe, die demnächst in diesem Finkelgruen-Themenschwerpunkt auf haGalil erscheint; sowie: Kaufhold (2018c): Der Tod einer Nazi-Ikone. Gudrun Burwitz, Protagonistin des Nazi-Unterstützervereins Stille Hilfe, ist tot, haGalil, 3.7.2018: https://www.hagalil.com/2018/07/gudrun-burwitz/
[9] Siehe die Studie von Kaufhold: „Neuanfang in Freiburg (1959): Mussolinis „alles beherrschende Kraft““ in diesem haGalil-Themenschwerpunkt zu Finkelgruen.
[10] Alle von mir verwendeten, aus dem Privatarchiv Finkelgruens stammenden Materialien werden von mir nachfolgend mit PAF gekennzeichnet.
[11] Im Newsletter des Bulletins des Terezin Memorial findet sich ein mit „The Sun of the Camp“ betitelter Beitrag über Nedvedová-Nejedlá Biografie und Überlebenskampf im Lager Ravensbrück: http://newsletter.pamatnik-terezin.cz/slunicko-lagru-pribeh-zdenky-nedvedove-nejedle/?lang=en
[12] Diese Akten sind in dem von Dr. Ulrich Soénius geleiteten Archiv – Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln (RWWA) – archiviert, einschließlich Finkelgruens gesamtem Vorlass.



