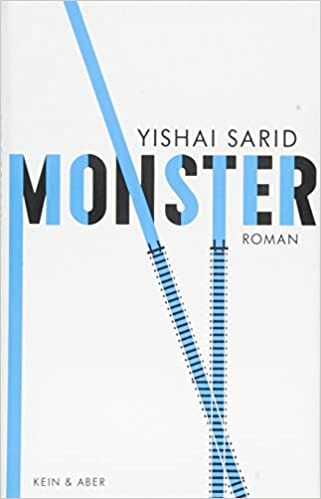Auf der letzten Seite von Yishai Sarids Roman kassiert ein deutscher Dokumentarfilmer in der Gedenkstätte des Vernichtungslagers Treblinka zwei krachende Faustschläge ins Gesicht. „(…) nicht innehalten, kräftig, mit voller Wucht. Ich musste das tun“, so die Worte des jüdischen Protagonisten. Ein guter und durchaus provokanter Schluss eines kurzen und fesselnden Romans, der sich aus der Sicht eines nicht weiter benannten israelischen Historikers und Antisemitismus-Experten mit der Erinnerungs- und Bildungsarbeit zur Shoah beschäftigt…
Von Patrick Helber
Die Handlung ist fiktiv, die Information über die deutschen Vernichtungslager im besetzten Polen basiert auf historischen Fakten. Der Roman ist also zwei in einem: Bildungsarbeit über die nationalsozialistischen Verbrechen, Täter und Täterinnen, Opfer und Überlebende und zugleich ein lesenswerter und kritischer Kommentar über Bildungsarbeit und ihre Wirkung (nicht nur) auf die israelische Gegenwart.
Den Vorfall mit dem Dokumentarfilmer nimmt der Protagonist zum Ausgangspunkt, seinem Vorgesetzten, dem Direktor der Gedenkstätte Yad Vashem, von seinen erschütternden Erlebnissen und aufwühlenden Gefühlen zu schreiben. Sarids Roman hat die Form eines Berichts, der sich bis zu den abschließenden Faustschlägen steigert.
Hauptakteur und Erzähler ist ein junger Mann. Er pendelt zwischen seiner Frau Ruth und seinem kleinen Sohn Ido in Israel und Polen. Dort begleitet er Reisegruppen von israelischen Schüler*innen, Tourist*innen und Soldat*innen zu den Relikten der deutschen Vernichtungstopographie und erläutert die Einzelheiten des Judenmordes. Qualifiziert hat er sich für diese Tätigkeit durch seine herausragende Promotion mit dem Titel „Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Arbeitsmethoden deutscher Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg“. In ihr hat er den industriellen Massenmord mit Akribie und wissenschaftlicher Distanz studiert.
Seine Tätigkeit als Guide beginnt er mit ähnlicher Genauigkeit, die nicht bei allen Zuhörer*innen auf Akzeptanz stößt: „Später sagte mir die Abteilungsleiterin, ich hätte durch mein Wissen geglänzt, aber Sie hätten auch angemerkt, dass es mir etwas an Gefühl und Opferbezug mangelte. Ich bin ein Historiker und keine Sozialarbeiterin, dachte ich.“ Sein Schutzpanzer, die wissenschaftliche Distanz, bröckelt aber mit der Zeit immer mehr und so gerät er immer stärker in die persönliche Auseinandersetzung mit dem „Monster der Erinnerung“, wie das Buch im hebräischen Original lautet (Mifletzet HaSikaron 2017).
Seinem Sohn Ido beschreibt der Ich-Erzähler die Arbeit als Kampf gegen dieses Monster. Ido stellt sich diese Auseinandersetzung heldenhaft vor und schenkt dem Vater eine Zeichnung. Sie zeigt ihn beim Schlagabtausch mit einem Ungetüm mit vielen Köpfen und Beinen.
Für den Vater entpuppt sich das Monster der Erinnerung letztendlich als unbesiegbar. Weder auf rationalem, noch auf emotionalem Wege ist es zu bezwingen. Wie die Köpfe einer Hydra schildert der Roman diverse Perspektiven auf das Thema Shoah-Erinnerung in der israelischen Gesellschaft, die dem Protagonisten nach und nach immer mehr zu schaffen machen. Besonders zwischen den Stationen seiner Führungen getuschelte oder geraunte Äußerungen der Zuhörer*innen bleiben an ihm haften:
Rechte Israelis nutzen den Holocaust, um die Politik linker Israelis gegenüber den Palästinenser*innen als Zeichen der Schwäche zu denunzieren. Mizrahim sehen in der Vernichtung der europäischen Juden und Jüdinnen einen Beweis für die Wehrlosigkeit der Aschkenasim: „Diese Aschkenasen, hörte ich mehrmals, diese Erzlinken haben es nicht hingekriegt, ihre Frauen und Kinder zu schützen, haben mit den Mördern kooperiert, sind keine echten Männer, können nicht zurückschlagen, sind ängstlich, weichlich, machen den Arabern Zugeständnisse.“
Orthodoxe Juden wiederum, die der Erzähler bei ihren Pilgerfahrten zu den Gräbern verstorbener Rabbiner in Kraków antrifft, verstören ihn mit ihrer Bejahung des Lebens. Über das Verharren des Protagonisten bei den Themen Tod, Vernichtung und Vergangenheit können sie nur den Kopf schütteln: „Was haben wir mit diesen Orten des Bösen zu tun? Wir führen das Leben fort. Suchen das Heilige und meiden Unreines. Thora und Mizwot, Lehre und Gebote, dafür leben wir. Und hier waren mal viel Thora und Mizwot, und, dem Ewigen sei Dank, setzen wir das heute fort.“
Überlebende der Shoah, die der Protagonist sucht, damit sie ihn bei seiner Arbeit unterstützten, fühlen sich von den Wissenschaftler*innen aus Yad Vashem bloßgestellt. Ihre persönliche Erinnerung stimmt nicht exakt mit der Forschung überein oder sie zerbrechen an der Konfrontation mit den Orten des Grauens, die sie nie wirklich hinter sich lassen konnten.
Das teils instrumentelle Verhältnis israelischer Politiker*innen und Militärs zur Shoah-Erinnerung, die besonders zur Legitimation von jüdischer Wehrhaftigkeit in Form des israelischen Staats dient, stößt wiederum den Protagonisten vor den Kopf. Gleiches gilt für die Gamification des Holocausts, die Sarid bis ins Unerträgliche steigert.
Das Panorama an Blicken auf die Shoah in der israelischen Gesellschaft ist auch für deutsche Leser*innen bereichernd. Problematisch wird es aber, wenn Sarid die Charaktere Bezüge zwischen den antisemitischen Verbrechen der Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen und dem israelisch-palästinensischen Konflikt ziehen lässt. Eine Argumentation, die unfreiwillig an einer Täter-Opfer-Umkehr heranrückt. Sie findet sich in der Äußerung eines Schülers, der meint, „zum Überleben müssen wir auch ein bisschen Nazis sein“ oder „so müsste man es mit den Arabern machen“-Getuschel bei den Schülergruppen angesichts der Gaskammern in den Gedenkstätten.
Auch wenn es Rassismus gegen Palästinenser*innen in Israel gibt, ist diese Verbindung eine problematische Komplexitätsreduktion. Speziell weil der Roman zwar diverse israelische, polnische und deutsche Sichtweisen auf die Shoah zeigt, eine palästinensische Perspektive aber gänzlich fehlt. Über Palästinenser*innen wird lediglich gesprochen. Das beraubt sie ihrer Handlungsmacht und macht sie zugleich zu vermeintlich wehrlosen Opfern.
Trotzdem wird deutschen Schuldabwehrantisemit*innen das Lesen nicht zu einfach gemacht. So stellt das Buch die provokante Frage an die israelische Gesellschaft, warum es ihr so schwer fällt, die Deutschen zu hassen. Den Protagonisten frustriert, dass während rassistische Vorurteile gegenüber Palästinenser*innen existieren, die deutschen Mörder und Mörderinnen in ihren strahlenden Uniformen unantastbar und in ihrer kaltblütigen Konsequenz manchen sogar fälschlicherweise als Vorbilder für bedingungsloses Handeln gelten: „Aber Menschen wie die Deutschen können wir schwerlich hassen. Schaut euch die Fotos aus dem Krieg an, man muss der Wahrheit die Ehre geben, sie sahen total cool aus in diesen Uniformen, auf ihren Motorrädern, entspannt, wie die Models auf Straßenreklamen.“
Für den Protagonisten ist dieser Widerspruch unerträglich und als wäre das nicht bereits genug, instrumentalisiert ihn ein deutscher Dokumentarfilmer als echten jüdischen Statisten in Treblinka, worauf es zur Entladung und zum Faustschlag kommt. Ein Volltreffer, der auch als Rebellion gegen das von Michal Bodemann und Max Czollek beschriebene „Gedächtnistheater“[1] verstanden werden kann. Anstatt seine Rolle einzunehmen, empowert sich der jüdische Protagonist und setzt seiner Instrumentalisierung ein jähes und selbstbestimmtes Ende. Für ein deutsches Lesepublikum, das sich für Bildungsarbeit und den Umgang mit den nationalsozialistischen Verbrechen interessiert, sicher das erhellendste Fazit.
Yishai Sarid, Monster, Kein & Aber Verlag 2019, Euro 21,00, Bestellen?
[1]Max Czollek: Desintegriert euch! Hanser, 5. Auflage, München 2018, S. 19.