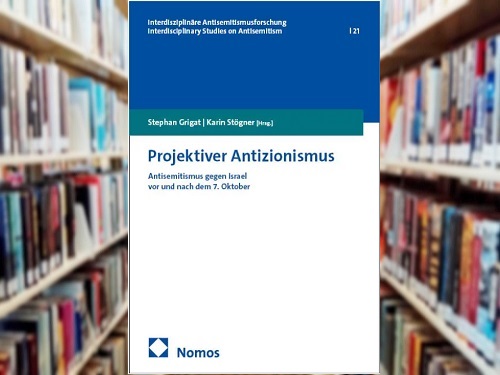Protest und antisemitische Projektion auf TikTok, Instagram & Co im Schatten des 7. Oktobers
Von Tobias Ebbrecht-Hartmann
Der Beitrag erschien in: Stephan Grigat / Karin Stögner (Hg.): Projektiver Antizionismus. Antisemitismus gegen Israel vor und nach dem 7. Oktober, Nomos Verlag 2025, Lizensiert unter BY-NC-ND 4.0.
Die folgenden Ausführungen werden von der Frage geleitet, welche Rolle soziale Medien und insbesondere Plattformen wie Instagram und TikTok vor und nach dem 7. Oktober 2023 im Hinblick auf die globale Intensivierung des Nahostkonflikts und insbesondere die Verbreitung antisemitischer Bilder und Projektionen spielten und wie sich die Diskurse über den 7. Oktober und den Krieg in Gaza auf diesen Plattformen einordnen und verstehen lassen. Sie basieren auf einzelnen Fallstudien und Beobachtungen, die durch Close Readings und multimodale Inhalts- und Formanalysen ausgewählter Beispiele gewonnen wurden. Diese Beispiele sind nicht repräsentativ für den Diskurs über den Nahostkonflikt in sozialen Medien, sondern bilden die Ergebnisse eines explorativen Verfahrens ab, mit dessen Hilfe in den Monaten seit dem 7. Oktober 2023 und dem Beginn des Gaza-Krieges signifikante und symptomatische audiovisuelle Beiträge auf Instagram und insbesondere auf TikTok identifiziert und mit dem Ziel einer Kategorisierung ausgewertet wurden. Beide Plattformen spielen eine wichtige Rolle im Spannungsfeld zwischen kreativen und spielerischen Formen des Aktivismus auf der einen und antisemitischen Projektionen auf der anderen Seite. Gerade das Format der kurzen Videos eignet sich sowohl für die Kommunikation von Informationen und unterschiedlichen Sichtweisen auf den Krieg als auch für die Weitergabe von, an moderne Kommunikationsformen in sozialen Medien angepassten, antisemitischen Bilderwelten. Die Untersuchung dieses Spannungsfeldes steht im Zentrum der folgenden Analyse, deren Ziel es ist, Begrifflichkeiten und Kategorien zur besseren Bestimmung und Unterscheidung aktivistischer und antisemitisch motivierter Interventionen auf diesen Plattformen zu entwickeln.
Der 7. Oktober und die sozialen Medien
Bereits in Artikel 13 ihrer Charta von 1988 hatte die islamistische Terrororganisation Hamas unmissverständlich klargestellt: „Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad [den heiligen Krieg] gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung […].“ (Hamas 2023 [1988]: 9) An dieser Haltung hat sich auch in der Neuformulierung ihrer Ziele und Strategien von 2017 nichts geändert. In Artikel 19 dieser Version heißt es: „Es gibt keine Anerkennung der Legitimität der zionistischen Einheit.“ (Hamas 2023 [2017]: 4) Und in Artikel 20 bekräftigt die Hamas die gewaltsame Zerstörung Israels in den Grenzen vor 1967 und erteilt jeder Form von Verhandlungslösung eine Absage. Sie erklärt, dass „kein Teil des Landes Palästina aufgegeben oder zugestanden werden darf“ und „lehnt jede Alternative zur vollständigen und uneingeschränkten Befreiung Palästinas [also der Zerstörung Israels und Unterwerfung oder Vertreibung seiner Bewohnerinnen] vom Fluss bis zum Meer ab.“ (Ebd.) Für Israel, zumeist nur als „zionistisches Projekt“ oder „Feind“ chiffriert, findet die Organisation klare Worte: „Das israelische Staatsgebilde ist der Spielball des zionistischen Projekts und seine Basis der Aggression.“ (Ebd.)
Aus diesen Formulierungen geht klar hervor, dass trotz der späteren Beteuerung in 2017, die Hamas richte sich nicht gegen Jüdinnen und Juden im Allgemeinen, das Weltbild, das beiden Fassungen ihrer Charta zugrunde liegt, zutiefst vom Antisemitismus geprägt ist. Dieses Weltbild ist handlungsleitend für die politischen und militärischen Initiativen der Organisation. Die Konstruktion eines absoluten Feindbildes, die Zuschreibung von weltweitem Einfluss und Macht, die Betonung der „Künstlichkeit“ des israelischen Staaten“gebildes“ gegenüber der als natürlich behaupteten Ursprünglichkeit des palästinensischen Volkes – all das sind Adaptionen klassischer antijüdischer Zuschreibungen, die in eine von relationalen Bezugsgrößen wie sozialer Realität, Geschichte oder Politik völlig losgelösten Fiktion von Israel als Projektionsfläche münden, die am 7. Oktober 2023 angegriffen wurde. Getroffen wurden mit diesem grausamen Angriff auf Dörfer, Städte und Kibbuzim in der Nähe des von der Hamas kontrollierten Gazastreifens aber konkrete Menschen: Alte, Junge, Kinder, Jüdinnen und Juden, muslimische Araber:innen, Beduin:innen, ausländische Arbeiter:innen, die durch diese Form exkludierenden Denkens zu vermeintlich legitimen Zielen gemacht wurden. Nach den Gräueltaten erklärte ein Sprecher der Hamas unumwunden in einem auf Arabisch veröffentlichten Statement:
Israel ist ein Staat, der von der Weltkarte entfernt werden muss. Die Araber und die gesamte islamische Umma müssen ihn beseitigen, und wir scheuen uns nicht, das mit allem Nachdruck zu sagen. Dieser Angriff war nur der erste, und es wird einen zweiten, dritten und vierten geben. Man nennt uns eine Nation von Heiligen, und wir sind stolz, unsere Heiligen zu opfern. (Leshem 2024: 39)
Aber so wie unbestreitbar ist, dass es ohne diese antisemitische Ideologie der Hamas nie zum eruptiven Ausbruch genozidaler Gewalt am 7. Oktober des vergangenen Jahres gekommen wäre, so ist doch auch richtig, dass die Massaker, Verstümmelungen, Demütigungen, Plünderungen und Vergewaltigungen ohne digitale Videotechnologie, mobile Live-Streams und soziale Medien so nicht möglich gewesen wären und nicht dieselbe Wirkung entfacht hätten. In den Morgenstunden des 7. Oktobers diente unter anderem der Kurznachrichten- und Messengerdienst Telegram der Hamas dazu, ihre verbrecherischen Taten mit ihren Anhängern und einer weltweiten Öffentlichkeit zu teilen. Mit Hilfe von an den Uniformen von Hamas-Kämpfern befestigten mobilen Kameras wurden die Angriffe auf Militärbasen, Zivilist:innen in Ortschaften und Städten wie Be’eri oder Sderot sowie die Besucher:innen des NOVA-Festivals live über die Kurzvideoplattform TikTok gestreamt. Videos vom Angriff der Hamas und der Entführung von Israelis nach Gaza wurden am 7. Oktober über die Plattform X einer weltweiten Öffentlichkeit bekannt. In einem Telegram-Post vom 9. Oktober 2023 betonte die Hamas, diese fortgesetzten Live-Aufnahmen ihrer „Mujahedin“ legten Zeugnis über die „Kämpfe“ ab und sprächen somit für sich selbst. Damit erklärte sie explizit, dass diese Bilder und ihre Verbreitung in sozialen Netzwerken als offizielle Erklärungen über Ziele und Strategien der Hamas zu verstehen seien (zit. n. Azani/Haberfeld 2023: 4). Dem Journalisten Eric Cortellessa zufolge verdeutlichen die über soziale Medien geteilten Gräuelbilder eine „neue Social-Media-Strategie“ der Hamas: „by recording and broadcasting the savagery of its own attack, Hamas is trying to assert itself as the dominant resistance movement in the Middle East” (Cortellessa 2023).
Auf Grundlage dieser globalen Bilderflut, welche die von der Hamas euphemistisch als „Al-Aqsa-Flut“ bezeichneten Angriffe begleitete, müssen auch die ersten Reaktionen auf die Gewalt vom 7. Oktober verstanden werden. Während in Israel Tausende Raketen auf Städte wie Tel Aviv niedergingen und sich erst langsam ein Bild vom Ausmaß der Gewalt an der Grenze zum Gazastreifen abzeichnete, wurde der Angriff der Hamas bereits an einigen Orten der Welt mit Süßigkeiten gefeiert und mit Solidaritätsbekundungen beantwortet. Sinnbildlich steht dafür ein vielfach auf unterschiedlichen Plattformen geteiltes Internet-Meme, das die Silhouette eines Paragliders zeigt, der mit einer palästinensischen Fahne markiert ist. Darunter steht zu lesen: „I stand with Palestine.“ Es wurde u. a. von der Gruppe Black Lives Matters Chicago Anfang Oktober 2023 verbreitetet.(1)
Solche Memes bestehen aus Bildern, Videos und/oder kurzen Texten und sind die kreativen Ergebnisse von nutzergenerierten Inhalten, die mit Mitteln von Nachahmung reproduziert und als interpretative Variationen leicht und schnell verbreitet werden können. Die Medienwissenschaftlerin Limor Shifman hebt hervor, dass Memes auch „die Denkweisen, Verhaltensweisen und Handlungen sozialer Gruppen“ prägen (Shifman 2014: 2014:347). Was hier wie eine harmlose Solidaritätsbekundung wirkt, affirmiert den Angriff bewaffneter Kämpfer mit entsprechenden Fluggeräten auf das NOVA-Musikfestival. Die Umwertung ziviler in militärisch genutzte Gegenstände erleichtert dabei die Dekontextualisierung und macht es möglich, Formen von Online-Aktivismus, die beispielsweise aus der Klima- oder der Black-Lives-Matter-Bewegung bekannt sind, für die verharmlosende Heroisierung von Terrorismus zu adaptieren.
Tatsächlich passierte der Angriff am 7. Oktober nicht in einem Vakuum. Er war nicht nur lange und detailliert von der Hamas geplant worden, er konnte sich auch in seiner Symbolik und damit im Hinblick auf die Mediatisierung der Gewalt auf frühere Formen und Formate stützen. So war es bereits im Sommer 2018 an der Grenze zu Gaza zu Angriffen aus der Luft gekommen. Palästinenser:innen hatten damals Lenkdrachen und Ballons mit explosiven Materialien über die Grenze nach Israel geschickt und dort enormen Schaden angerichtet. Die Konnotation als Kinderspiel führte jedoch zu einer massenmedialen Verharmlosung der Angriffe, die als Formen kreativen Protests in das emotional gesteuerte Narrativ des Nahostkonflikts integriert wurden (Yarchi/Ayalon 2023). So bezeichnete beispielsweise die Deutsche Welle die als Ballons und Lenkdrachen getarnten Bomben als die „Waffen der Armen aus Gaza“ (Knipp 2018).
Solche früheren, global bereits bekannten Rahmungen konnten mit dem Bild des Paragliders und seiner Ikonisierung in dem entsprechenden Meme aufgerufen werden. Solche Rahmungen sind ein essentieller Bestandteil von Kommunikationsprozessen. Erving Goffman beschreibt sie als kulturelle Schemata, die beim Verständnis von Ereignissen helfen und zu ihrer Interpretation und Einordnung beitragen (Goffman 1974). Daher spielen Rahmungen gerade in der politischen Kommunikation eine wichtige Rolle. Der Medienwissenschaftler Robert Entman weist auf die Bedeutung von Praktiken der Selektion und der Hervorhebung bei kommunikativen Rahmungen hin:
To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation. (Entman 1993: 52)
Die durch das Paraglider-Meme aufgerufene Rahmung verknüpft die Gewalt des 7. Oktobers mit der früheren massenmedialen Interpretation des als „spielerischer“ Aktivismus gerahmten Hamas-Terrorismus von 2018 und wurde dadurch „umgedeutet zu Symbolen des Muts und der Freiheit“ (Leshem 2024: 42). Der Kommunikationswissenschaftler Dietram Scheufele betont, dass Massenmedien bewusst Referenzrahmen einsetzen, welche die Leser:innen zur Interpretation und Diskussion von Ereignissen heranziehen können (Scheufele 1999: 103). Dies passiert auch, allerdings noch wesentlich dynamischer und flexibler, in der Kommunikation auf sozialen Medien. Memes können dabei als kondensierte Referenz- und Interpretationsrahmen dienen.
Am Beispiel des hier diskutierten Internet-Memes zeigt sich eine wichtige Voraussetzung für das Verständnis der Geschehnisse, während und nach dem 7. Oktober. Gerade im Hinblick auf ihre Verstärkung in den sozialen Medien sehen wir ein Oszillieren zwischen einem spielerischen Aktivismus auf der einen und antisemitischen Projektionen auf der anderen Seite. Für beides gibt es Vorläufer in der jüngeren Geschichte des Konflikts. Diese beziehen sich zum einen auf frühere Protestformen und ihre mediale Verstärkung, zum anderen auf den kaum verhohlenen Antisemitismus der Hamas, der im Diskurs der sozialen Medien jedoch auf einen jeweils spezifischen nationalen Resonanzboden fällt.
Eine zweite Beobachtung ist mindestens ebenso wichtig: Soziale Medien dienten am 7. Oktober nicht nur der medialen Verstärkung von Gewalttaten oder propagandistischen Zielen, sondern sie boten auch angegriffenen Zivilisten Möglichkeiten der Orientierung in vollkommen unübersichtlichen und lebensbedrohlichen Situationen. Auf Telegram konnten sie überlebenswichtige Informationen zur Taktik und Standortbestimmung von Hamas-Kämpfern finden (Leshem 2024: 34). Selbst die israelische Armee nutzte in sozialen Netzwerken zirkulierende Informationen und Videos, um Terroristen zu identifizieren (Ynet 2023). Über den in Israel populären Messengerdienst WhatsApp wurden eigene Geodaten geteilt, um Rettungskräfte zu unterstützen und Hilferufe abzusetzen (Leshem 2024: 36). Bereits am 7. Oktober diente WhatsApp zur Dokumentation der Verbrechen vor allem durch Videos, die später zu forensisch analysierbaren Beweismitteln wurden. Journalist:innen erhielten über den Dienst Informationen, die zu dieser Zeit offiziell noch nicht verfügbar waren (Leshem 2024: 35). Später wurden auf verschiedenen Plattformen hochgeladene Videos im Hinblick auf Informationen ausgewertet, die Erkenntnisse über entführte Zivilist:innen und Soldat:innen liefern konnten.
Dies macht deutlich, dass soziale Medien, auch wenn sie vielfach der Verstärkung von Polarisierung, Hass und Stigmatisierung dienen, Gegenstand ganz unterschiedlicher Nutzungspraktiken sein können. Das ist wichtig im Blick zu behalten, um zwischen verschiedenen Ausprägungen von auf diesen Plattformen geteilten Inhalten unterscheiden zu können. So zirkulierten auch auf Instagram zahlreiche Fotos und Videos von den Gräueltaten der Hamas. Bereits in den ersten drei Tagen hatte der Meta-Konzern knapp 800.000 hebräische und arabische Inhalte von seinen diversen Plattformen entfernt. TikTok löschte bereits in der ersten Woche nach dem 7. Oktober 500.000 Videos und 8.000 Liveübertragungen (Spiegel 2023); 2023); bis Ende des Monats waren 925.000 Videos allein aus der Konfliktregion wegen Verstößen gegen Richtlinien zu Gewalt, Hassrede, Falschinformation und Terrorismus gelöscht worden, inklusive Inhalten, welche die Hamas glorifizierten.
Im weiteren Verlauf diente Instagram aber Palästinenser:innen aus Gaza auch zur Dokumentation von israelischen Militärschlägen und ihren Folgen. In manchen Fällen dokumentierte ein und derselbe Account erst die Ereignisse des 7. Oktobers – zum Beispiel die Ankunft gekaperter israelischer Militärfahrzeuge – und dann Videos von Luftangriffen. Auch auf israelischer Seite wurde Instagram schnell zu einem Forum, um die Erfahrungen des 7. Oktobers und der Hamas-Angriffe zu teilen. Beispielsweise finden sich auf dem Account „Israel War Story“ Beiträge, die individuelle Geschichten und Erfahrungen aus israelischer Perspektive zum Gegenstand haben.(2)
TikTok wurde schon wenige Tage nach dem Hamas-Angriff zu einem globalen Forum für palästinensischen Aktivismus. Allerdings mischten sich darunter schnell auch Verschwörungsfantasien und antisemitische Symboliken. Mit etwas Verzögerung nutzten aber auch israelische TikToker kurze Videos zur Verbreitung von Informationen. Offizielle Accounts, wie jener der israelischen Streitkräfte, berichteten beispielsweise über das Auffinden von Waffenlagern und Tunneln der Hamas, individuelle TikToker produzierten erklärende Videos mit Informationen über die Geschichte des Konflikts. Erst in den letzten Monaten – mit größerem Abstand zu den Ereignissen des 7. Oktobers – adaptieren israelische und jüdische Influencer:innen und Kreator:innen auch spielerische Formen der politischen und aktivistischen Kommunikation über den Konflikt.
Soziale Medien zwischen algorithmisch verstärktem Hass, Information und Aktivismus
Social Media-Plattformen sind mittlerweile zu populären und einflussreichen
Quellen für Informationen und politische Nachrichten geworden. Ein Bericht des US-Amerikanischen Think Tanks Pew Research Center zeigt, dass soziale Medien zunehmend eine „entscheidende Rolle“ beim Nachrichtenkonsum spielen. Etwa die Hälfte der amerikanischen Erwachsenen bezieht ihre Informationen regelmäßig aus sozialen Medien. Instagram rangiert dabei auf Platz drei, TikTok rangiert auf Platz vier der am häufigsten genutzten Plattformen zur Informationsbeschaffung, nach Facebook und YouTube und noch vor der Microblogging Plattform X. Diese Zahl steigt stetig an. So verwendeten 2023 bereits doppelt so viele Nutzer TikTok-Videos als Nachrichtenquelle als im Jahr 2020. Auch bei Instagram-Nutzer:innen stieg die Zahl, während bei X und Facebook die Tendenz eher abnehmend ist (Pew Research Center 2023).
Diese Entwicklung hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen auf den Plattformen. Einerseits steigt das Interesse daran stetig an. Andererseits gibt es abseits der plattformeigenen Moderation keine Qualitätskontrolle. Emotionalisierende Meinungsbekundungen folgen auf Aufklärungs- und Bildungsvideos, die wiederum mit Desinformationskampagnen und Fake News konfrontiert sind. Politischer Aktivismus auf der Plattform findet zwischen Aufklärung und Propaganda statt. Die Formate sind oft dieselben: die spielerische Aneignung von aktuellen Trends oder die erklärende Ansprache in die Kamera. Für Nutzer:innen ist es jedoch oft schwer die Unterschiede zwischen Falschinformation, Verschwörungserzählung, Aktivismus und Informationsvermittlung zu erkennen. Gerade als „Kommunikationssystem, das hochgradig medial vermittelt ist“ (Ebbrecht-Hartmann 2021), passt sich der Antisemitismus an die auf sozialen Medienplattformen vorherrschende Bildsprache und Praktiken effektiv an.
Anhand von verschiedenen Beispielen sollen im Folgenden beide Formen, spielerischer Aktivismus und antisemitische Projektionen, genauer bestimmt und insbesondere im Hinblick auf bereits bestehende politisch-visuelle Diskurse auf den Plattformen eingeordnet werden. Auf diese Weise möchte ich verdeutlichen, dass die Empörung über die „TikTok Intifada“ (Ward 2021; Ball 2021; Berendsen/Schnabel 2024), den „Hashtag Krieg“ (Altland/Eichhorn 2021) oder medial verstärkte Kontroversen wie jene über kurze Videos über Osama bin Ladens „Brief an Amerika“ (Blome 2023; Baeck 2023) nicht in einem kontextlosen Raum entstanden sind, aber eben auch nicht durch eine ausschließlich Hass und Propaganda fördernde algorithmische Struktur von sozialen Medienplattformen zu erklären sind.
Im November 2023 machte eine Reihe von Videos Furore, in denen TikToker das antisemitische Machwerk bin Ladens feierten. Dessen „Brief an Amerika“ mit seinen antisemitischen und Israel dämonisierenden Passagen habe ihnen die Augen geöffnet, erklärten einige Kreator:innen in ihren Videos. Insgesamt soll es rund 274 davon auf TikTok gegeben haben (Nover 2023). Rund 2 Millionen Nutzer:innen sollen sich Videos mit dem entsprechenden Hashtag angeschaut haben (Blome 2023). Einige Expert:innen wiesen darauf hin, dass dies im globalen Maßstab eine relativ geringe Zahl sogenannter „Views“ sei, mit denen die Wirkung von Inhalten auf Social Media gängigerweise gemessen werden (Nover 2023). Was genau ein „View“ ist, differiert jedoch von Plattform zu Plattform. Auf TikTok, wo Nutzer:innen normalerweise schnell durch die vorgeschlagenen Inhalte navigieren, reichen wenige Sekunden, um ein Video als „gesehen“ zu markieren.
Wirklich globale Aufmerksamkeit erhielt Osama bin Ladens Präsenz auf TikTok erst, als auch andere Plattformen, insbesondere der durch massive Desinformation in der Kritik stehende Kurznachrichtendienst X von Elon Musk (Jikeli/Soemer 2022), darauf aufmerksam machten. Dass die britische Zeitung The Guardian schließlich bin Ladens Machwerk aus seinem Onlinearchiv löschte, spornte das Interesse noch mehr an. Soziale und traditionelle Medien agieren längst als gegenseitige Aggregatoren und Verstärker von Medienphänomenen und tragen damit zur ohnehin starken Polarisierung bei. Eine Studie der Anne Frank Bildungsstätte spricht von einem „Schema algorithmischer Radikalisierung“ (Berendsen/Schnabel 2024: 6).Das lässt sich auch angesichts des Gaza-Krieges beobachten und liegt oft an mangelnden Kenntnissen über die Logiken und Praktiken der Nutzung von entsprechenden Plattformen.
Es handelt sich in erster Linie um einen politischen Konflikt, der eben auch einen Platz in sozialen Medien gefunden hat, und dessen ganz reale und existentielle Auswirkungen in Israel, Gaza und den Palästinensischen Gebieten Menschen überall auf der Welt bewegen und aktivieren. Teilweise werden diese realen und existentiellen Auswirkungen jedoch durch Diskurse in sozialen Medien entkontextualisiert und derealisiert; oder – gerade im deutschen Kontext – durch Angriffe im Raum der sozialen Medien in der realen Welt sogar noch intensiviert und mitunter eskaliert, wie man beispielsweise im Rahmen einiger der jüngsten Hörsaal- und Unibesetzungen sehen konnte, die in besonderer Weise auch soziale Medienphänomene bzw. Medienereignisse sind. Soziale Medien spielen dabei eine wichtige Rolle: „In Bezug auf den 7. Oktober ist hier eine Flut fragwürdiger, feindseliger, antisemitischer und offen demagogischer Inhalte entstanden, in denen die problematischen Tendenzen Sozialer Medien sich in bisher beispielloser Weise potenziert haben.“ (Berendsen/Schnabel 2024: 5)
Diese Tendenzen sollen im Folgenden punktuell genauer untersucht werden, insbesondere in Abgrenzung zu aktivistischen Formen spielerischen Protests und in Unterscheidung zum informativen Potential kurzer Videos. Nach einer kurzen Einordnung von Online-Antisemitismus und spielerischem Aktivismus in und mit kurzen Videos, die dabei helfen soll, die Entwicklungen auf sozialen Medienplattformen nach dem 7. Oktober im Zuge des sich verschärfenden Gaza-Krieges besser zu verstehen, möchte ich skizzenhaft eine Typologie von Video-Memes entwerfen, die verschiedene, auch graduelle Facetten des audiovisuellen Diskurses über den 7. Oktober und den Gaza-Krieg nachzeichnen. Ich werde mich dabei auf die Kurzvideoplattform TikTok als Beispiel konzentrieren.
TikTok ist mittlerweile die siebtbeliebteste Social-Media-Plattform der Welt (Iqual 2024). Mit seiner „For You“-Seite mit algorithmisch generierten Inhalten von weit entfernten und oft unbekannten Urhebern, die auf der Grundlage des Nutzungsverhaltens auf die individuellen Interessen abgestimmt werden sollen, bietet TikTok eine unterhaltsame Bühne für kurzweilige Videos. Die auf einem Empfehlungsalgorithmus basierende Auswahl der Videos für individuelle Nutzer:innen führt dabei dazu, dass individuelle „For You“-Seiten sehr unterschiedlich aussehen können (Berendsen/Schnabel 2024: 10). Entscheidend dafür, was eine Nutzerin sieht, ist das eigene Nutzungsverhalten und das darin ausgedrückte Interesse an bestimmten Themen und Formaten.
2017 von der privaten chinesischen Firma ByteDance für den globalen Markt außerhalb Chinas entwickelt, konnte TikTok vor allem nach der Verbindung mit der Plattform Musica.ly und der Übernahme von deren 200 Millionen Nutzer:innen seine Popularität immer weiter steigern. 2022 wurde die App weltweit 3,5 Milliarden Mal heruntergeladen (Briskman 2022). Ende 2023 hatte TikTok rund 1,7 Milliarden Nutzer:innen, von denen 1,1 Milliarden regelmäßig Videos anschauen (Berendsen/Schnabel 2024: 10). 10). 49,3 % der Nutzer:innen sind jünger als 24 Jahre alt, 28,2 % gehören der Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren an (Ebbrecht-Hartmann/Divon 2024: 18).
Nutzer:innen der App können im integrierten Videoeditor selbst kurze Videos zwischen 15 Sekunden und 10 Minuten produzieren. Die Formate sind dabei so unterschiedlich wie die gewählte Länge. Mit Musik unterlegte kurze Aufnahmen von Demonstrationen und Protesten wechseln sich mit satirischen Spielszenen, kürzeren oder längeren Kommentaren, Erklärvideos mit zahlreichen Quellen und Verweisen, Tanzeinlagen, bunten Effekten und Schnipseln aus anderen Medien ab.
Auf diese Weise ist TikTok auch zu einem aktivistischen Spielplatz für verschiedene soziale und politische Anliegen geworden. Dieser „serious turn“ der Plattform ist eng mit deren Aufstieg während der COVID-19-Pandemie 2020/21 verbunden (Cervi/Divon 2023; Ebbrecht-Hartmann/Divon 2022). Die zu dieser Zeit noch überwiegend jüngeren Nutzer von TikTok aus der sogenannten Generation Z begannen neben ihrem Alltag auch zunehmend ihre Wahrnehmung von politischen Ereignissen, wie beispielsweise den Black Lives Matter- oder Klimawandel-Protesten, zu teilen (Kaye/Zeng/Wikström 2022: 121). Im Anschluss an meine Typologie möchte ich als Ausblick einige Beispiele intersektionaler Solidarität und spielerischer Aufklärung vor und nach dem 7. Oktober vorstellen.
Antisemitismus ist auch auf sozialen Medienplattformen kein neues Phänomen (Mulhall 2021; Ebbrecht-Hartmann/Brenner 2023; Divon/Ebbrecht-Hartmann 2022). Auch wenn antisemitische Kommunikation auf Plattformen wie TikTok von der enormen Reichweite profitiert, die der Empfehlungsalgorithmus den Influencer:innen ermöglicht (Mulhall 2021: 62), handelt es sich doch in erster Linie um ein gesamtgesellschaftliches und globales Problem, das deshalb in sozialen Medien auftaucht, weil diese ein wesentlicher Bestandteil sozialer Lebenswelten geworden sind. Es handelt sich, wie Monika Schwarz-Friesel betont, um eine „kulturelle Konstante“, die mittlerweile auch zur digitalen Kommunikation dazugehört. Allerdings ist der Antisemitismus „keineswegs nur ein digitales Phänomen: Das Internet beflügelt und multipliziert ihn, aber es erzeugt ihn nicht. Der Hass sitzt bereits lange in den Köpfen der User, wenn diese ihn posten und verteilen“ (Schwarz-Friesel 2020: 10).
Im Zuge des wachsenden Erfolges, den TikTok vor allem bei jungen Nutzer:innen erzielte, wurde auch der Antisemitismus zum Thema. Im Juli 2020 entdeckte die BBC eine Reihe von Videos, die einen antisemitischen Song mit der Textzeile „We’re going on a trip to a place called Auschwitz, it’s shower time“ verwendeten (Tidy 2020). Kurz zuvor hatte James Spiro im CTech Magazin unter dem Titel „How the newest social media platform lets anti-Semitism run wild“ darauf hingewiesen:
Most of the content on the platform is innocent, showing people lip-syncing and dancing to popular songs or young people simply telling jokes to the camera. However, there has been rising concerns about accounts that promote violence and anti-Semitism on the platform and the company’s reluctance to commit to its own terms of service in monitoring the content online. (Spiro 2020)
Die Sorge über die Verbreitung von Antisemitismus mit kurzen Videos begleitet den Diskurs über die bei Jugendlichen beliebte Plattform also von Anfang an (Divon/Ebbrecht-Hartmann 2022). Tatsächlich lässt sich eine gewisse Affinität zwischen den auf TikTok populären Kurzvideo-Memes und früheren Formen der visuellen Kommunikation in antisemitischen Diskursen nicht abstreiten. Man könnte vielleicht von einer Memifizierung antisemitischer Inhalte sprechen. Kam in visuellen antisemitischen Diskursen traditionell vor allem „der Kombination von Text und Bild eine zentrale Bedeutung zu“, und wurden antisemitische Botschaften „mehr oder weniger offen durch die Verbindung mit Bildunterschriften und Kommentaren vermittelt“, wobei sich Text und Bild gegenseitig ergänzen und dabei „bestimmte (mentale und gesellschaftlich geteilte) Bilder von ‚den Juden‘ verfestigen“ (Ebbrecht-Hartmann 2021), ist der memifizierte Antisemitismus in kurzen Videos multimodal und transportiert seine Botschaften durch die Kombination von Bildern, Sounds, Texteinblendungen, Filtern und Spezialeffekten sowie Emojis, Liedern und Tänzen. Dabei können „klassische“ antisemitische Bilderwelten reaktiviert werden, wie das „Happy Merchant Meme“ (ADL o. J.), eines der populärsten antisemitischen Memes, das laut
einer Studie von 2018 besonders häufig auf bei rechtsextremen Akteuren populären Plattformen wie 4chan geteilt wurde (Zannettou et al. 2018). Antisemitische Botschaften können aber auch durch die Verbindung von für sich genommen unproblematischen Filtern und Trends verbreitet werden, wie zum Beispiel dem „Expressify“-Filter, der die menschlichen Gesichtszüge unnatürlich verzerrt, in Kombination mit dem populären Lied „If I Were a Rich Man“ aus dem Musical Fiddler on the Roof jedoch antisemitisch konnotiert (Smith 2021). Auch der populäre Filter „Versailles Run“ wurde für Video-Memes mit antisemitischen Botschaften adaptiert, dieses Mal zur Kommunikation von israelbezogenem Antisemitismus. Das Video einer deutschen TikTokerin nutzt eine Texteinblendung, um die animierte Comic-version von Marie Antoinette, die durch das Schloss Versailles rennt, als Zionistin zu markieren. Im dehate report #3 der Amadeu Antonio Stiftung heißt es:
Das Gesamtbild des Videos aus Mimik, Text und Filter lässt den Eindruck von Dreistigkeit und Willkür entstehen. Der Text setzt diese Darstellung in den Kontext des Nahost-Konfliktes. […] Durch die Verwendung von zum eigentlichen Filter gehörigen Hashtags wie #MuseumMoment wird diese antisemitische Selbstkarikierung anderen User:innen zugänglich gemacht, die dies nicht erwarten – in der Hoffnung, dass die Botschaft hängen bleibt. (AAS 2021: 20)
Unterstützt wird die Verbreitung solcher Inhalte, die gerade durch die Verwendung von vermeintlich unproblematischen und unpolitischen Symbolen und populären Filtern nicht vom automatisierten Moderationssystem als antisemitisch erkannt werden, durch den Plattformalgorithmus, der auch im Fall von TikTok ganz grundsätzlich die Verbreitung kontroverser Themen mit hohen Interaktionsraten (zum Beispiel durch Kommentare, Likes oder Shares) intensiviert. Daraus entsteht die paradoxe Situation, dass einige Nutzer:innen Trends auf der Plattform für die Verbreitung antisemitischer Memes nutzen können, während die kritischen Reaktionen auf solche antisemitischen Inhalte, beispielsweise von jüdischen oder israelischen TikToker:innen, durch den Algorithmus unterdrückt oder durch das Moderationssystem blockiert werden, da diese die verdeckte antisemitische Kommunikation in den Videos, beispielsweise durch Verweise auf den NS-Antisemitismus und althergebrachte antisemitische Stereotype, offenlegen (Divon/Ebbrecht-Hartmann 2022: 47).
Von der TikTok-Intifada zum TikTok-Krieg
Auch der Nahostkonflikt hat nicht erst seit dem 7. Oktober einen festen Platz auf TikTok (AAS 2021). Bereits bei der Eskalation 2021 – der bis dahin letzten kriegerischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der Hamas, in deren Zentrum der Status von Jerusalem stand, als deren „Schutzmacht“ sich die Hamas inszeniert – wurde von einigen Medien zugespitzt als „TikTok Intifada“ bezeichnet (Divon 2022: 88). Der Grund dafür war eine Reihe von Videos, die tätliche Angriffe junger Palästinenser auf zumeist ultraorthodoxe jüdische Männer dokumentierten. Die sogenannte „#HitandRunChallenge“ verband auf diese Weise realweltliche Gewalt mit virtueller Demütigung und Hass. Rückblickend hält der Journalist Jonathan Guggenberger über die damaligen Videos fest:
Von der Weltöffentlichkeit kaum beachtet, wirkte TikTok nicht nur als Brandbeschleuniger des Konflikts und dazugehöriger antisemitischer und rassistischer Verzerrungen. Als Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, trug die Plattform auch direkt zum Ausbruch des Krieges bei. (Guggenberger 2023a)
Die militärische Auseinandersetzung zwischen Hamas und Israel wurde bereits 2021 durch entsprechende Hashtags sowie für TikTok typische, eigentlich dialogische Features wie Stitch oder Duett (3) begleitet. Diese wurden nun zur Kontrastierung verwendet. So entstanden Formate, die eine vermeintlich palästinensische und eine israelische Perspektive im Rahmen der kompetitiven Logik von TikTok Challenges kontrastierten. Auch die Verwendung von Hashtags wie „#FreePalestine“ und „#StandWithIsrael“ dienten der Zuordnung und kontrastiven Einteilung von konträren Positionen im Konflikt. Dabei zeigte sich bereits 2021 ein deutliches Übergewicht von Videos mit pro-palästinensischer Ausrichtung. Der israelische Medien wissenschaftler Tom Divon hat dies als „playful publics“, für Online-Aktivismus typische spielerische Öffentlichkeiten, beschrieben, die durch Aktivismus, Dokumentation, kondensierte Inhalte, die Sichtbarmachung marginalisierter Stimmen, Gemeinschaftsstiftung und Solidarisierung charakterisiert sind. Im Kontext des Nahostkonflikts auf TikTok werden die Konfliktparteien in Figurationen des vorherrschenden Meme-Regimes übersetzt (Divon 2022: 88).
Besonders ist, dass die Positionierungen in der für die App typischen Darstellungsart erfolgen. Nicht nur von Demos, sondern auch mit Liedern und den auf TikTok typischen Tänzen verbreiten Influencer:innen innenInfluencer:innenihre Ansichten zum Krieg und erreichen damit eine sehr junge Zielgruppe. (Hollandt 2023)
Der spielerische Aktivismus bietet dabei vor allem Anknüpfungspunkte für die Selbstversicherung von Zugehörigkeiten, die gerade auch für die palästinensische und muslimische Diaspora wichtig sind. Palästina dient dabei auch unabhängig von der aktuellen Konfliktlage als Referenzpunkt für die Aushandlung von Identität und Zugehörigkeit sowie als Katalysator einer Selbstaktivierung. TikTok bietet dafür einen Raum, der Zuspitzungen genauso wie symbolische Verdichtung und Vereinfachung zulässt.
2021 haben sich bereits erfolgversprechende Templates für Video-Memes herausgebildet, die 2023 als Vorlagen für aktivistische Interventionen und Solidaritätsbekundungen dienen konnten. Ein Beispiel dafür sind sogenannte „Make-Up Tutorials“, die – basierend auf dem für TikTok symptomatischen Transition-Effekt – zu Performances politischer Parteinahme werden. Dies passierte zum Beispiel in der „A’atuna Al Toufoule“ („Gib uns die Kindheit“)-Challenge, die auf einem Lied des palästinensisch-libanesischen Kinderstars Remi Bendali basierte. In diesen Videos zeigen sich Creators dabei, wie sie ihr Gesicht mit Hilfe von Schminke verändern. Sie tauchen es in die Farben der palästinensischen Flagge, fügen ihm Zeichen von Gewalteinwirkung hinzu, und machen es so zur Leinwand symbolischen Mitleidens und des Ausdrucks von Solidarität mit Palästinenser:innen.
Laura Cervi und Tom Divon zufolge wurden in diesen Videos die Gesichter der TikToker zu „physical templates for politically charged artistic creations, allowing the performance of Palestinian resistance“ (Cervi/Divon 2023: 6). Durch das gewählte Format des Make-Up Tutorials, das bereits für andere Formen des Online-Aktivismus adaptiert worden war, boten die Videos auch Anknüpfungspunkte für andere Aktivist:innen. Einige nutzten darüber hinaus bewusst Referenzen zu aktivistischen Bewegungen wie Black Lives Matter, um beispielsweise durch den Slogan „Palestinian Lives Matter“ symbolische Allianzen zu knüpfen.
Ein anderes Format palästinensischen TikTok-Aktivismus, das bereits 2021 zum Einsatz kam, waren musikalische Duetts, insbesondere der palästinensisch-israelische Disput über den Song „Stand Up“. Mit der Adaption dieses Songs in ein Lip sync-Video hatten israelische Soldatinnen versucht, sich den Impetus des Liedes als Hymne gegen die Sklaverei für die eigene Verteidigung nationaler Unabhängigkeit und Selbstbestimmung anzueignen. Der auf TikTok erfolgreiche palästinensisch-libanesische Sänger Moe Zein reagierte daraufhin mit einem Stitch, der 24,3 Millionen Mal aufgerufen wurde (gegenüber 7,3 Millionen Views des israelischen Videos). In seinem Reaktionsvideo änderte Zein den Text des Liedes zu „Yes please stand up / Take your people with you“, gepaart mit einer Montage von Aufnahmen palästinensischer Kinder.
Der Fokus liegt auf der „Tragödie“, dem der Sänger die Forderung nach „Menschlichkeit“ entgegensetzt. Trotz des Rekurses auf ein selbst bereits stereotypes Motiv – die Personifizierung von Palästinenser:innen im Bild des unschuldigen Kindes – lässt sich das Video als kreativ-aktivistische Intervention gegen die israelische Besatzung der Westbank interpretieren, die das im ursprünglichen Video angebotene Narrativ israelischer Unabhängigkeit wiederum überschreibt.
Diese an die Sprache und Logiken der Plattform angepassten Video-Memes konnten nach dem 7. Oktober schnell und erfolgreich aufgerufen und für die Mobilisierung von pro-palästinensischer Solidarität genutzt werden. Die bereits 2021 erreichte Professionalität einiger palästinensischer TikToker:innen traf auf ein potentiell zahlenmäßig großes Publikum, das mit der Bevölkerung in Gaza sympathisierte. Schließlich waren sowohl individuelle als auch institutionalisierte Accounts in Israel sowie jüdische TikToker:innen weltweit nach dem Schock des 7. Oktobers kaum in der Lage, Videos für TikTok zu produzieren. All das schlägt sich in der daher kaum verwunderlichen Dominanz von pro-palästinensischen Hashtags auf TikTok (und anderen Plattformen) nieder. Es entfaltete sich ein regelrechter Hashtag-Krieg, in dem sich schließlich der bereits 2021 durchgesetzte Hashtag „#freepalestine“ mit 770 Millionen Views gegenüber „#standwithpalestine“ (29,4 Millionen) und „#standwithisrael“ (46,3 Millionen) behaupten konnte. Auffällig ist lediglich die Altersstruktur. 87 % der Videos mit dem Hashtag „#standwithpalestine“ wurden von Nutzer:innen unter 35 Jahren gepostet. 59% der Views von Videos mit Hashtags „#standwithpalestine“ und „#freepalestine“ stammen von 18–24-Jährigen, während Videos mit dem Hashtag „#standwithisrael“ nur von 42% der 18–24-Jährigen angeschaut wurden.
Bereits wenige Tage nach dem 7. Oktober verlagerte sich damit aber nicht nur die ohnehin kurzlebige Aufmerksamkeit auf der Plattform von den Verbrechen des 7. Oktobers zu einem dominanten Diskurs über die israelische Kriegsführung. Zwischen aktivistische Videos mischten sich zunehmend Desinformation, Verzerrungen und Amplifikationen von unbewiesenen Tatsachenbehauptungen, die Israel in rascher Folge zunächst Kriegsverbrechen und dann Völkermord unterstellten und schnell auch über TikTok hinaus zusätzliche Aufmerksamkeit generierten. Angesichts dieser Entwicklung urteilte der Journalist Sebastian Leber im Tagesspiegel: „Seit der Terrorwelle der Hamas vor einer Woche lässt sich auf der Plattform in Echtzeit verfolgen, wie Hass auf Juden und den jüdischen Staat in die Köpfe von Kindern und Jugendlichen gepflanzt wird.“ (Leber 2023)
TikTok als Konfliktzone
Welche Inhalte finden sich nun zum Gaza-Krieg auf TikTok und wie lassen sich diese im Hinblick auf die Abgrenzung zwischen Aktivismus und Antisemitismus bewerten? Zahlreiche Videos adaptieren eine bereits seit langem im Kontext des Nahostkonflikts verwendete Symbolsprache, die neue Elemente integriert und teilweise auf Mehrdeutigkeiten basiert. Dabei kommen auch zunehmend KI-generierte Inhalte zum Einsatz. Ein Video-Meme mit dem Hashtag „#freepalestine“ von Anfang November 2023 zeigt einen Jungen auf einer Wassermelone mit Blick auf eine Moschee, die soeben von einem israelischen Kampfflugzeug angegriffen wurde. Die stereotype Personifizierung von Palästinenser:innen im Symbol des unschuldigen Kindes, eine implizite Variation des antisemitisch konnotierten Vorwurfs des „Kindermordes“, wird hier durch den Einsatz des Motivs der Wassermelone verstärkt, die sinnbildlich für die palästinensische Identität stehen soll. Die israelische Seite ist in dieser Visualisierung anonym, gesichts- und geschichtslos, ausschließlich verkörpert in einer Kampfmaschine. Besonders ist die religiöse Konnotation durch die angegriffene Moschee, die das Bild damit in einen Kontext setzt, der durchaus der von der Hamas vorgesehenen Rahmung des Konflikts entspricht.
Viele Videos enthalten Interpretationen und Aussagen zum Krieg und zum Nahostkonflikt. In den seltensten Fällen handelt es sich dabei um Erklärvideos im eigentlichen Sinne. Die zumeist direkt in die Kamera gesprochenen Texte haben eher den Charakter von Statements und sollen Zugehörigkeit bekunden. Oft sind es nicht-palästinensische TikToker:innen, nicht selten weiße Europäer:innen oder Amerikaner:innen, die auf diese Weise ihre Parteinahme auf Seiten der Palästinenser:innen bekunden. Dabei kommen auch kulturelle und politische Symboliken zum Einsatz, beispielsweise die Keffiah oder die Wassermelone, aber auch arabische Ausdrücke und Schriftzeichen. In den meisten Fällen handelt es sich jedoch um memetisch intensivierte Solidaritätsbekundungen, die neben der typischen Verwendung von Symbolen und Stickern auch TikTok-übliche Formate wie das Duett und das Multi-Chain-Duett anwenden (4), um die eigene Position mit Hilfe der für TikTok typischen „Point-of-View“-Perspektive virtuell mit der palästinensischen Perspektive zu verschalten.
Wie auf sozialen Medienplattformen üblich, spielen visuelle Codes und Symbole sowie Emojis eine wichtige Rolle bei der Verknappung und Kondensierung von Informationen. Diese Codes müssen nicht immer einen antisemitischen Bezug haben. Die Wassermelone ist gerade durch das leicht einsetzbare Emoji, das sich als Bild oder Hashtag unter vielen Videos findet, zu einem aktivistischen Code und einem politischen Symbol geworden. Die Verwendung orientiert sich an der farblichen Ähnlichkeit zur palästinensischen Fahne und geht auf die Zeit nach dem Sechs-Tage-Krieg zurück, als im von Israel besetzten Westjordanland und in Gaza das Zeigen der Flagge untersagt war (Kampeas 2024). Seit dem 7. Oktober dient die Wassermelone nicht nur als Symbol des Protests auf Demonstrationen und als Erkennungszeichen in Social Media Posts, sondern führte auf TikTok auch zur Einführung eines neuen Filters. Der von einem individuellen TikToker produzierte Effekt – durch das Bild fliegende Wassermelonenstücke – diente explizit als politisches Tool. Die Gewinne aus der Verwendung des Filters sollten palästinensischen Organisationen zugutekommen. Mittlerweile ist die Wassermelone zu einem ikonischen, aber auch vielfach parodierten Zeichen geworden, das Gegenstand spielerischer Aneignung und Subversion ist.
Beim spielerischen Protest mit memetischen Formen kommt der ohnehin kontrovers diskutierten Frage der „Aneignung“ besondere Bedeutung zu. Im Kontext der Auseinandersetzungen über den Gaza-Krieg auf TikTok lassen sich dabei zwei Formen der Aneignung unterscheiden. Während die Aneignung von (spielerischen) Protestformen durch israelische (und jüdische) TikToker zurückgewiesen wird, ist die Aneignung vermeintlich palästinensischer Narrative und Positionen durch weiße europäische und amerikanische Nutzer:innen durchaus erwünscht. Für ersteres, die Zurückweisung israelischer „Aneignung“, steht ein Stitch von Moe Zein, mit dem er auf das Video israelischer Soldat:innen reagiert, die einen auf TikTok populären arabisch-palästinensischen Protestsong adaptierten und pro-israelisch umdeuten.5() In seiner Neuinterpretation erklärt Zein, das Lied sei nicht „for you“ (Israelis) gemacht worden. Eigentlich ein Paradox im Kontext der für Video-Memes und TikTok charakteristischen Mash-Up-Kultur, in der jeder Sound und jedes Bild zum Element neuer Kreationen durch spielerische Aneignung werden kann. Dann fügt er hinzu: „you wanna steal this too“, eine Anspielung auf die palästinensische Deutung, ihr Land sei von Israel (bzw. Zionist:innen) „gestohlen“ worden. Dabei bleibt hier uneindeutig, ob sich Zein mit diesem Vorwurf auf die Besatzung der Westbank oder auf die israelische Staatsgründung von 1948 bezieht, eine feine Linie, die das Video zwischen spielerischem Protest und antisemitischer Projektion changieren lässt. Solche Ambiguität aber ist typisch für die memetische Kommunikaton in sozialen Medien.
Die zweite Variante der Aneignung zeigt sich beispielsweise im Duett einer jungen Frau mit betroffen-traurigem Gesichtsausdruck, die sich parallel zum Video eines TikTokers filmt, der einen vermeintlich pro-palästinensischen Song performt.(6) Die Solidaritätsbekundung wird noch durch eine über das Bild geblendete Wassermelone verstärkt. Die Aneignung der palästinensischen Perspektive findet durch das TikTok-typische Verfahren des Lip sync, der getreu des Liedtextes nachgeahmten Lippenbewegung der TikTokerin statt. Sie übernimmt damit aber auch in dem Lied verwendete Motive, die aus dem Arsenal des Antisemitismus stammen, so z. B. der Vorwurf eines durch Israel begangenen Genozids (Täter-Opfer-Umkehr), das Stereotyp des Kindermörders, die Unterstellung einer israelischen Verschwörung und die Dämonisierung von Israelis als Tyrannen.
Israelbezogener Antisemitismus, Gewaltverherrlichung und Verschwörungserzählungen auf TikTok
Das Oszillieren zwischen Meme und Propaganda, die Adaptierung von popkulturellen Elementen und die Popkulturalisierung antisemitischer Symbole lässt sich besonders deutlich an der Verwendung eines der umstrittensten Symbole aus dem Kontext des Gaza-Krieges illustrieren, dem roten Dreieck. Dieses Zeichen wurde, wie in einem Propagandavideo zu sehen ist, von der Hamas am 7. Oktober zur Feindmarkierung eingeführt. Es bezeichnet aus Sicht der Hamas legitime Ziele von Gewaltakten gegen Israelis. Als Code und Gegenstand von Memefizierungsprozessen wurde das rote Dreieck zu einer Metapher für die Auslöschung Israels und, kaum versteckt, aller Juden. Dafür steht sinnbildlich die Animation in einem anderen Video, in der ein rotes Dreieck einen blauen Davidstern (nicht die israelische Fahne) eliminiert und dann (wieder) zum Teil der palästinensischen Flagge wird. In dieser Visualisierung zeigt sich eine markante Doppeladressierung. Zum einen suggeriert das Video, der Ursprung des Symbols sei in der palästinensischen Fahne zu finden (und leugnet damit seine Verbindung zur Vernichtungslogik der Hamas), zum anderen lässt sich die Animation aber auch so interpretieren, dass das rote Dreieck die Hamas symbolisiert und nach der Vernichtung Israels in die Einheit der palästinensischen Fahne zurückkehrt.
Im Zuge der Memetisierungsprozesse löst sich das Zeichen zunehmend aus seinem Bedeutungskontext ab und wird zum scheinbar unpolitischen Symbol pro-palästinensischer Solidarität. In einer Adaption der Make-Up Tutorials wird das Dreieck als Haarband zur Devotionalie. Die ursprüngliche Bedeutung wird dabei jedoch durch die visuelle Analogie, die sich gerade durch die algorithmische Logik der Plattformen verstärkt, weiter mitgeführt. Darauf machen wiederum kritische Erklärvideos aufmerksam, die das Symbol und seine Bedeutung als antisemitische Feindmarkierung auch in einem historischen Kontext verorten.(7)
In solchen memetischen Adaptionen antisemitischer Motive schlägt spielerischer Protest in antisemitische Projektionen um. Ein Beispiel dafür sind Videos, die zum Boykott vermeintlich israelischer Waren aufrufen, indem sie das Format des Tutorials adaptieren und gleichzeitig den für aktivistische Social Media-Postings üblichen „Call to Action“ implementieren. Die Kürze der Videos intensiviert dabei noch die dekontextualisierte Bezugnahme auf Boykotte als aktivistische Praxis, die nicht nur in Deutschland durch die historischen Referenzen zum Boykott jüdischer Geschäfte und dem darauffolgenden Raub jüdischen Eigentums in der NS-Zeit eine problematische Konnotation haben. In die verkürzende Verdichtung audiovisueller Memes mischen sich oft auch Elemente des klassischen Antisemitismus. Eine solche Zuschreibung ist der Vorwurf des Kindsmords, der bereits seit dem Mittelalter antijüdische Projektionen begleitet und in unterschiedlichen Variationen in Kurzvideo-Memes aufgerufen und mit anderen Motiven verknüpft wird. Gerade im deutschen Kontext finden sich aber auch zahlreiche Verschwörungsmythen und Desinformationen, die deutlich machen, dass der Krieg in Gaza in erster Linie als Projektionsfläche dient. So erklärt eine TikTokerin, die sich bis zum 7. Oktober fast ausschließlich mit esoterischen Themen beschäftigt hatte, in einem ihrer Videos über den „wahren“ Grund des Krieges auf: Ölvorkommen unter dem Gazastreifen (Ebbrecht-Hartmann 2023).
Der nicht erst seit der COVID-19-Pandemie auf sozialen Medien sichtbare Hang zu Verschwörungserzählungen ist eine Erklärung dafür, warum auf TikTok schon kurz nach dem 7. Oktober Videos verbreitet wurden, die unter dem Mantel der Solidarität mit Gaza den Hass auf Israel schüren. Der Wunsch nach einem Ende der Auseinandersetzung mit Holocaust und NS-Verbrechen ist ein weiterer. Dabei sind es viele weiße Deutsche, die den Gaza-Krieg zur Projektionsfläche ihrer Schuldabwehr machen. Das zeigt sich beispielsweise in einem Video, das den Wutausbruch eines Mannes zeigt, der sich über die Aktion des israelischen UN-Botschafters aufregt, sich aus Protest gegen die einseitige Verurteilung Israels bei den Vereinten Nationen einen gelben Stern mit dem Text „Nie Wieder“ ans Revers zu heften. Man kann von Gilad Erdans Inszenierung halten, was man will, dem TikToker geht es in seinem Video nicht um eine problematische Analogie. Sein wütendes Geschrei in die Kamera mündet in der Forderung nach einem Schlussstrich: „NIEMAND ist euch etwas schuldig!!!!!!“, und fast schon obligatorischen Unterstellung, Israel betreibe einen „Völkermord“ in Gaza, die selbst bereits eine Relativierung der genozidalen Gewalt vom 7. Oktober impliziert.
Ausblick: Zwischen spielerischer Aufklärung und Empathielosigkeit
Bisher finden sich auf TikTok oder Instagram nur wenige Accounts, die solchen Desinformationen und den Verschwörungserzählungen etwas entgegensetzen und aktiv über die israelische Perspektive auf den 7. Oktober und den Krieg in Gaza informieren. Trotz entsprechender Vorbilder wie beispielsweise den JewToks aus den USA (Divon/Ebbrecht-Hartmann 2022) gelingt es nur wenigen TikTokern, die aktuellen Ereignisse in die spielerische Form von TikTok Videos zu übersetzen. Dazu zählt beispielsweise der mittlerweile von TikTok zu Instagram gewechselte israelische Account @ask_dani. In seinen Videos spielt Influencer Dani Buller auf unterhaltsame und durchaus satirische Weise aktuelle Konflikte durch, mal einen Hamas-Terroristen, der sich mit Israel und den Vereinten Nationen auseinandersetzt, mal einen studentischen Aktivisten in Harvard im Zwiegespräch mit der Hamas.(8)
Auffallend sind aber auch Bekundungen intersektionaler Solidarität, die seit dem 7. Oktober dominierende Narrative unterlaufen. So finden sich unter anderem Videos jezidischer Frauen, die ihr Mitgefühl für die Opfer der Hamas-Gewalt zum Ausdruck bringen. Der Comedian und LGTBQ-Aktivist Daniel Ryan Spaulding interveniert mit Erklärvideos auf Instagram und spielerischen Performances aus queerer Sicht in die Debatte und bemüht sich dabei auch um die Sichtbarmachung von israelischen Betroffenenperspektiven (Spiro 2024).(9)
Gängiger aber sind Videos wie jene, die sich über die Präsentation eines Wandkalenders lustig machten, den die israelische Armee im Keller des Shifa Krankenhauses in Gaza gefunden hat, wo höchstwahrscheinlich Geiseln festgehalten wurden. Wie der Pressesprecher der Armee in einem Video erklärte, ginge man davon aus, dass Hamas-Mitglieder ihre Schichten bei der Bewachung der Geiseln in diesem Kalender markierten. In TikTok Videos wird der Ton des Armee-Videos nun in andere Kontexte transportiert. Nutzer:innen zeigen dazu Kalender in ihren Wohnungen und trivialisieren die Situation. Welche Wirkung dies auf Angehörige von Entführten, eigentlich auf alle Jüdinnen und Juden in und außerhalb Israels hat, die sich um den Zustand der Geiseln sorgen, spielt auf TikTok keine Rolle. Solche Videos verstoßen nicht gegen die Community-Richtlinien, aber sie fördern dennoch Ausschluss, weil sie für manche Nutzer:innen in ihrer Empathielosigkeit schlicht unerträglich sind.
Anfang November 2023 hatten jüdische TikToker diese Atmosphäre in einem offenen Brief gegenüber den Plattformverantwortlichen beklagt (Ghermezian 2023). Zunehmender Antisemitismus mache es ihnen beinahe unmöglich, weiterhin über jüdische Geschichte, Kultur und Traditionen aufzuklären. TikTok betont unerlässlich, alles dafür zu tun, die Plattform zu einem sicheren Ort für alle zu machen und die Ausbreitung von hasserfülltem Verhalten zu verhindern. Dennoch haben der Holocaustüberlebende Gidon Lev und seine Partnerin Julie Gray nach drei Jahren Aufklärung über die Geschichte des Holocaust und Antisemitismus die Plattform verlassen. Nachdem sie in Reaktion auf die Massaker vom 7. Oktober darauf hingewiesen hatten, dass sie in Israel lebten, verlor ihr Account tausende Follower. TikTok sei einfach zu „toxisch“ geworden, erklärten sie ihren Entschluss (Ebbrecht-Hartmann 2023; Guggenberger 2023b).
Der Beitrag erschien in: Stephan Grigat / Karin Stögner (Hg.): Projektiver Antizionismus. Antisemitismus gegen Israel vor und nach dem 7. Oktober, Nomos Verlag 2025, Lizensiert unter BY-NC-ND 4.0. Alle Literaturangaben finden sich dort.
Anmerkungen:
(1) Alle hier beschriebenen Bilder und Memes finden sich online in der CARS-Working Paper-Fassung dieses Beitrags: https://kidoks.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/5058/file/CARS_WorkingPaper_021.pdf.
(2) Siehe: https://www.instagram.com/israelwarstory
(3) Ein Stitch ermöglicht es, auf TikTok das eigene Video mit dem eines anderen Creators zu verbinden und dieses auf solche Weise zu kommentieren oder weiterzuentwickeln. In einem Duett wird das eigene Video wie in einem Splitscreen neben dem Video eines anderen Creators gezeigt. Auf diese Weise ist es möglich, mit dem früheren Video zu interagieren. Dies geht jedoch nur über Gesten und Texteinblendungen, da der Ton dem Originalvideo entstammt.
(4) In einem Multi-Chain-Duett duetten TikToker:innen bereits bestehende Duetts. So entsteht eine Kette von Duetts, in der sich eine virtuelle Solidaritätsgemeinschaft konstituiert.
(5) Siehe: https://www.tiktok.com/@moezeindtb/video/6968566719581293826.
(6) https://www.tiktok.com/@christinanoelleda/video/7299941406892674347
(7) Vgl. beispielsweise entsprechende Videos auf den Accounts @keine.erinnerungskultur und @sachsenhausenmemorial.
(8) siehe: https://www.tiktok.com/@ask__dani?lang=en.
(9) https://www.instagram.com/danielryanspaulding/?hl=en.