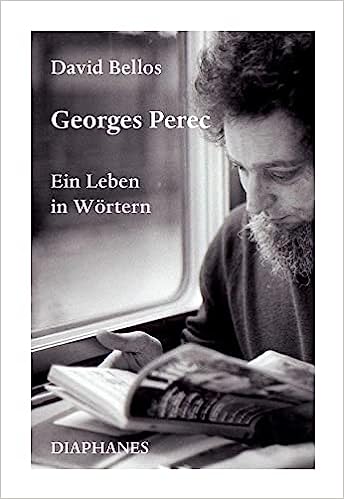Der französische Schriftsteller Georges Perec musste als Kind lernen, seine jüdische Identität zu verbergen. Sein literarisches Werk ist voller Rätsel. Die meisten kann sein Biograph David Bellos auflösen.
Von Olaf Kistenmacher
Zuerst erschienen in: Jungle World v. 25.05.2023
Auf den ersten Blick scheint es zwischen den Sprachexperimenten des Autorenkreises Ouvroir de littérature potentielle (Oulipo, Werkstatt für potentielle Literatur) und den autobiographischen Romanen von Annie Ernaux oder Didier Eribon kaum Gemeinsamkeiten zu geben. Oulipo wurde 1960 bezeichnenderweise von dem Wissenschaftsjournalisten und Mathematiker François Le Lionnais sowie dem Schriftsteller Raymond Queneau gegründet. Zu den bekanntesten Mitgliedern gehörten neben Queneau vor allem Georges Perec, Italo Calvino, Harry Mathews, Oskar Pastior und Marcel Duchamp.
Die Oulipo-Autor:innen folgen beim Schreiben selbsterfundenen, mitunter absurden Regeln, um so zu völlig neuen Formen der Literatur zu gelangen. Die eigene Biographie ist dabei an sich ohne Bedeutung. Für die Lektüre von Perecs kleinem Buch »Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen« (»Tentative d’épuisement d’un lieu parisien«, 1975) muss man über dessen Leben gar nichts wissen. Es bildet den Nullpunkt der Literatur: ohne Handlung, ohne Hauptfiguren, ohne Entwicklung. Perec zählt darin lediglich auf, was er Anfang der siebziger Jahre an drei Tagen von drei Cafés aus beobachtete. Er wollte herausfinden, »was passiert, wenn nichts passiert«.
Dieses Experiment gehörte zu einem umfassenden, unabgeschlossenen autobiographischen Projekt des Autors, das er 1969 seinem Lektor Maurice Nadeau, der auch die Zeitschrift Les Lettres nouvelles herausgab, so erklärte: Über zwölf Jahre werde er zwölf Orte aufsuchen, die mit »wichtigen Augenblicken meiner Existenz verbunden« sind, und diese Orte jeweils zweimal beschreiben: einmal in Anwesenheit, einmal aus der Erinnerung.
Perec nähert sich seiner eigenen Biographie also wie von außen, mit den Augen eines Soziologen, und das verbindet ihn mit den Selbsterkundungen von Ernaux und Eribon. Der soziologische Blick auf sich und das eigene Milieu war nicht nur dem Zeitgeist von 1968 geschuldet, er kennzeichnet schon Perecs Debütroman »Die Dinge. Eine Geschichte der sechziger Jahre« (»Les Choses. Une histoire des années soixante«, 1965). Er ist auch die Folge einer traumatischen Kindheitserfahrung, die dazu beitrug, dass Perec sich zeitlebens selbst ein Rätsel blieb.
1936 geboren, hatte Perec früh seine aus Polen stammenden jüdischen Eltern verloren. Sein Vater war im Kampf gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg gefallen, seine Mutter war 1943 nach Auschwitz deportiert worden und nie zurückgekehrt. Georges, der einzige Sohn, überlebte bei Verwandten auf dem Land unter falscher Identität.
David Bellos schildert in seiner ausführlichen Biographie »Georges Perec. Ein Leben in Wörtern«, wie schwierig es für Perec war, ein Verhältnis »zu seiner verlorenen Vergangenheit zu finden«. Die Originalausgabe der Biographie erschien bereits 1993, seitdem hat Bellos sie für Übersetzungen immer wieder aktualisiert. Die nun auf Deutsch vorliegende Fassung dokumentiert den neuesten Kenntnisstand.
Als Perec Anfang der siebziger Jahre seine trivialen Beobachtungen aus Pariser Cafés notierte, arbeitete er zugleich an einer großen Familienchronik, einer »Art Sage oder Chronik« mit dem Arbeitstitel »Der Baum«, zu der auch der autofiktionale Roman »W oder die Kindheitserinnerung« (»W ou le Souvenir d’enfance«, 1975) gehört. 1973 gab Perec das Projekt auf. Was blieb, waren außer »W oder die Kindheitserinnerung« nur Einzelteile, Fragmente.
Perecs Leben spiegelt sich nicht nur in dem, was er schrieb, sondern auch darin, wie er darüber schrieb. Als Kind hatte er seine wahre Identität verbergen und sich eine andere aneignen müssen, und so ist sein Werk, von dem erst posthum veröffentlichten frühen Werk »Der Condottiere« (»Le Condottière«, 2012) an bis zu »Das Leben Gebrauchsanweisung« (»La Vie mode d’emploi«, 1978), voller Kopisten und Fälscher, und stets geht es, wie Bellos schreibt, um »den feinen Unterschied zwischen faking und making, zwischen Machen und Nachmachen« in der Kunst. Zugleich war das Kopieren Perecs Methode. Für »Die Dinge« hatte er sich nach eigener Aussage bei Gustave Flauberts »L’Éducation sentimentale« bedient. Sein zweiter Roman, »Ein Mann der schläft« (»Un Homme qui dort«, 1967), ist voller abgewandelter Zitate von Franz Kafka, Herman Melville und Marcel Proust.
Der über 800 Seiten starke Roman »Das Leben Gebrauchsanweisung« gilt Bellos als das Hauptwerk. Endlich sei Perec ein Roman gelungen, wie er ihn immer schreiben wollte: voller »Geschichten und Peripetien«, ein Buch, das man, »flach auf dem Bauch liegend, im Bett verschlingt«. Mit diesem Roman hat Perec das eigene Leben in Literatur verwandelt. Vielen Andeutungen auf Perecs eigene Geschichte spürt Bellos nach. Die zentrale Erzählung – von Percival Bartlebooth, der in 20 Jahren 500 Aquarelle malt, um daraus Puzzles fertigen zu lassen, die, nachdem er sie zusammengesetzt hat, mit einem besonderen technischen Verfahren in nichts aufgelöst werden – bildet in Bellos’ Biographie zugleich das Grundmotiv. Bevor Bartlebooth das letzte Puzzle zusammensetzen kann, stirbt er. Die auszufüllende Lücke hat die Form eines X. In der Hand hält er jedoch ein Puzzleteil, das wie ein W geformt ist. Für Bellos ein Symbol, das er psychoanalytisch deutet: W hieß die Insel, von der Perec als Kind in Alpträumen heimgesucht wurde, X steht für ein ungelöstes Rätsel, aber auch für ein gelöschtes Zeichen.
Die Biographie ist wie das fehlende Puzzleteil zu Perecs Werk. Allerdings kann auch Bellos nicht alle Anspielungen aufklären. Denn Perec, der als Archivar arbeitete und Kreuzworträtsel für verschiedene Zeitschriften erstellte, liebte Rätsel. So ist aus Perecs Notizen zu seinem Familienstammbaum, für den er seine Tante interviewte, »ersichtlich, dass er viel mehr über seine Familie wusste, als er in ›W oder die Kindheitserinnerung‹ einfließen ließ«. In »W oder die Kindheitserinnerung« offenbart Perec selbst, er sei wie ein Kind, das Verstecken spielt und »nicht weiß, was es am meisten fürchtet oder wünscht: versteckt bleiben« oder entdeckt werden.
Immer wieder kreisen Perecs Texte um das Verschwinden, das Nichts, das weiße Blatt. In der Mitte von »W oder die Kindheitserinnerung« ist eine leere Seite; in seinem berüchtigsten oulipotischen Werk, dem Roman »Anton Voyls Fortgang« (»La Disparition«, 1969, also wörtlich »das Verschwinden«), fehlt der Buchstabe E und die Farbe Weiß spielt eine zentrale Rolle, und »Versuch, einen Platz in Paris zu erfassen« handelt ebenfalls davon, was aus Literatur wird, wenn nichts passiert. Zwar erfüllte sich Perec mit dem großen Roman »Das Leben Gebrauchsanweisung« einen Lebenstraum, weil ihm endlich gelungen war, was er bei Thomas Mann oder Marcel Proust bewunderte. Doch man muss in diesem Roman nicht wie Bellos das Hauptwerk sehen. Wie Perec selbst ausführte, besteht sein literarisches Werk aus vier Strängen. Die soziologischen Betrachtungen über die Frage, was ihn oder sein Umfeld geprägt hat, oder die oulipotischen Sprachspiele sind für dieses Werk nicht weniger wichtig als der große Roman.
Wie all diese Texte mit Perecs Leben zusammenhängen, lässt sich endlich in David Bellos’ großer Biographie nachlesen. Sie vermittelt eine Ahnung, woher Perecs Beschäftigung mit dem Nichts, der Leere, dem Verschwinden kommt.
David Bellos: Georges Perec. Ein Leben in Wörtern. Aus dem Englischen von Sabine Schulz. Diaphanes, Berlin/Zürich 2023, 704 Seiten, 45 Euro, Bestellen?