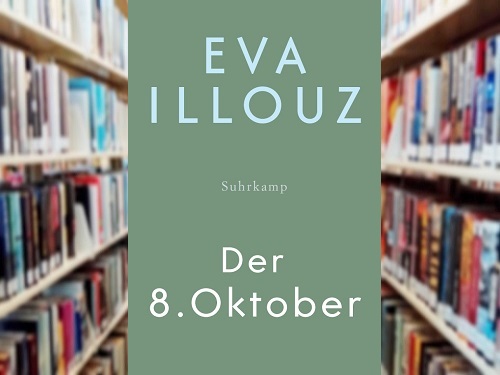Die linke israelische Soziologin Eva Illouz über den „8. Oktober“
Von Roland Kaufhold
Ja, alles wurde schon unendlich oft beschrieben – und doch hilft es scheinbar nichts. Zum barbarischen Hamas-Pogrom liegen zahlreiche unbestreitbare Dokumente vor – und doch wird es schlicht verleugnet und ideologisch umgedeutet.
Nach den Essays der linken israelischen Politikwissenschaftlerin Fania Oz Salzberger (2024) sowie Moshe Zimmermann (2024) hat nun auch die linke israelisch-französische Soziologin Eva Illouz eine knappe, eindrückliche, schon beinahe verzweifelte Analyse zum 7. Oktober vorgelegt.
Die 1961 geborene Eva Illouz ist innerhalb des israelischen politischen Spektrums dem linken politischen Lager zuzurechnen. An Kritik, etwa an dem Siedlungsbau Israels, hat es bei ihr nie gemangelt. Illouz ist abgrundtief entsetzt über die Empathielosigkeit, mit der insbesondere die weltweite Linke auf das barbarische Pogrom der Hamas reagierte. Gerade von den internationalen Linken, für die die Shoah vorgeblich einen „Tabubruch“ darstellte, hatte sie Angemesseneres erwartet.
„Ich habe mich geirrt. Ein beträchtlicher Teil der globalen Linken – unter wechselnden Namen wie identitäre, wache bzw. aufgeweckte, dekoloniale oder progressive Linke – hat die Existenz dieser Gräueltaten geleugnet oder sie als Akt des „antikolonialen Widerstandes gefeiert“ (S. 7), schreibt sie in ihrer schmalen, vor allem auf französische, amerikanische und israelische Literatur verweisenden Schrift.
„Euphorie und Schadenfreude“
Diese Linke habe „schockierte und leidtragende Juden“ im Stich gelassen und Israel hierüber hinaus, in grotesker historischer und politischer Unkenntnis, sogar noch des Kolonialismus bezichtigt.
Der Besuch einer einzigen vorgeblich hiesigen „pro palästinensischen“ Querfront-Kundgebung liefert niederdrückende Bestätigungen ihrer Beobachtungen. Als linke israelische Soziologin versucht sie zu erklären, wie es zu dieser erschütternden, infantilen politischen und moralischen kollektiven Regression gekommen ist. Illouz liefert hierbei keine grundlegend „neuen“ Erkenntnisse. Dennoch liefert sie eine bestürzende dichte Zusammenschau.
In „ein moralisches Rätsel“ erinnert die Autorin knapp an das erschütternde Ausmaß der systematischen, vorsätzlichen Gewalt, der bewusst auch sexuellen Barbarei gegenüber Juden am 7. Oktober. Die Hamas-Terroristen zeigten ihre Übergriffe bewusst öffentlich, um Juden zusätzlich zu entmenschlichen, zu traumatisieren. Verstörend für Eva Illouz ist vor allem die erstaunliche Zahl von „progressiven“ Beobachtern, die „in den fröhlichen Chor der Menschenansammlungen aus Gaza einstimmten“. (S. 10) Bei nahezu jeder solcher Demonstrationen in westdeutschen und europäischen Millionenstädten, aber auch in New York, ist diese ausgeprägte, enthemmte, schuldfreie Freude zu beobachten. Es gab fast nur „Euphorie und Schadenfreude“ (S. 11). Illouz, die auch in Frankreich aufgewachsen ist, beschreibt die Erklärungen gerade von dezidiert linksradikalen Parteien wie der Nouveau Parti anticapitaliste (NPA), die sich in ihrer offiziellen Stellungnahme zum 7.10. mit der terroristischen Gewalt der Hamas-Mörder identifizierte, diese in wahnhaft-bösartiger Weise als „heldenhaften Akt des Widerstandes“ feierte (S. 12).
Zahlreiche namhafte Universitätslehrer – J. Butler wurde oft genug genannt – empfanden angesichts der öffentlich zelebrierten sexuellen Vergewaltigungen, der Kopfschüsse, der systematischen Morde insbesondere in den linken Kibbuzim „nichts als Jubel über die Terroristen auf dem Weg zu ihrem Pogrom.“ (S. 13)
Bei empathiegestörten Figuren wie Butler löste das kaltblütig geplanten Pogrom nur Achselzucken aus: Ob es wirklich Beweise für die Vergewaltigungen am 7.10. gebe, sei ungewiss. Derartige Beweise müsse man erst mal vorlegen. Ja, dann werde man das beklagen, sagte sie im März 2024 bei einem Treffen besagter linksradikaler französischer Partei. Es fällt schwer, da nicht an die Shoahleugnungen der rechtsradikalen deutschen Leugnerszene zu denken. Bei Eva Illouz löst solche ostentative linke „Leugnung und Freude“ (S. 15) ein Gefühl der Sprachlosigkeit, des Rätsels aus, „das mich nicht loslässt.“ (S. 15)
Illouz fühle sich weiterhin einer Linken zugehörig, die Kolonialismus und Barbarei nicht hinnehme. Im Buch legt sie in überzeugender Weise dar, wie sich die beeindruckende historische Kenntnislosigkeit über die antikoloniale Gründung des demokratischen Staates Israel in der Linken habe verbreiten können. Nur vor diesem Hintergrund vermöge man zu verstehen, weshalb die Linke und sogenannte „Queere“ nicht nur ihren postulierten Universalismus aufgegeben, sondern sich zu emotionalen Gefolgsleuten der Hamasmörder verwandelt haben. Die Hamasmörder kennen ihre westlichen Gefolgsleute. Diese, so beklagt die scharfsinnige Soziologin Eva Illouz, gleiche heute einer „quasireligiösen Weltsicht“, die eine echatologische Weltmission betreibe und „das radikale Böse mit Israel“ identifiziere (S. 17).
Ich frage mich, was Hanna Arendt heute darüber schreiben würde.
Der Zynismus Netanjahus
Die Autorin erwähnt die Überheblichkeit und den Zynismus von Netanjahu, dem die Geiseln offenkundig absolut gleichgültig sind, sowie auch die nicht in Abrede zu stellende Instrumentalisierung der Shoah durch einige sehr rechte Kreise in Israel. Diese habe gewiss auch zu der Distanzierung großer Teile auch der westlichen Weltbevölkerung von Israel beigetragen. Aber die Wahrnehmung der barbarischen Realitäten etwa durch Putin und Assad, in Äthiopien, Sudan oder in Kongo sei eindeutig sehr viel schlimmer und anlassloser als die entschiedenen Reaktionen der rechten Regierung Israels auf das Pogrom: „So grausam die israelische Besatzung auch ist, ist sie doch nicht grundsätzlich grausamer als andere Formen von Konflikten und Verstößen gegen die Menschenrechte.“ (S. 24)
Verschärft werde dieser Prozess noch dadurch, dass die westliche Herrschaft zunehmend von ehemals kolonisierten Ländern ersetzt werde. So begaben sich im Juli 2024 14 palästinensische Organisationen darunter auch die Hamas, nach China, um sich dort, unter dem Vorsitz Chinas, wieder zu vereinigen.
Der Verrat durch Black Lives Matter
In einem weiteren Kapitel beschreibt Illouz die Konkurrenz der verschiedenen Minderheiten in den USA. Dass 2020 600 jüdische Organisationen in einem gemeinsamen Brief die Bewegung Black Lives Matter unterstützen änderte absolut nichts an dem Prozess der Ausstoßung von Juden und von Israel. Selbst nach dem Hamaspogrom gab es nur Schweigen von dieser Bewegung und Solidarität mit den Mördern der Hamas. Dies sei für sie, konstatiert Eva Illouz, „zweifellos die schmerzhafteste Reaktion von allen.“ (S. 49) Auch diesen Prozess der Opferkonkurrenz und der Identifizierung vorgeblich linker und migrantischer Szenen mit den Hamasmörder ist auf nahezu jeder größeren Kundgebung in hiesigen Millionenstädten zu beobachten.
Die Autorin beschreibt die Wurzeln des von zwei südamerikanischen Akademikern (Mignolo und Quijano) geprägten Postkolonialismus und des Antiimperialismus. Heute diene dieser dazu, selbst schlichteste historische Phasen des Nahostkonfliktes und in Israel akademisch zu verleugnen – etwa indem die Besetzung der 1967 nach einem Angriffskrieg eroberten Gebiete auf die israelische Staatsgründung 1948 projiziert werde. Als Folge davon werde die außerordentliche Verletzlichkeit der Juden „zunehmend geleugnet“ (S. 59), werde die Erinnerung an die Vernichtung der Juden mit Macht assoziiert und „ihre Vernichtung durch die Nazis bizarrerweise in eine Quelle des Ressentiments verwandelt.“ (ebd.)
Illouz hebt den Begriff der „Superkritik“ hervor, der heute alle historischen Prozesse in Nahost schlicht negiere. Etwa dass Juden in Palästina „so einheimisch waren wie die Araber, ja zweifellos mehr noch, da Juden seit 3000 Jahren in Palästina leben.“ (S. 60) Diese Superkritik verwandele sogar den Shoahgedenktag in Israel in eine Form der Machtausübung. Der heute dominierende Antisemitismus habe mit den Taten und der Politik des Staates Israel schlicht nichts mehr zu tun. Ein solches Antizionismus könne heute „auch ohne Israel bestehen, ohne Zion und selbst ohne Zionismus“ (S. 61). Heute erscheine sogar der Begriff Zionist als etwas Ehrenrühriges.
Ein glühender Verehrer Hitlers
In einem weiteren Kapitel analysiert die Autorin die Entwicklung, wie der Begriff des Antisemitismus zuerst aus dem linken Vokabular gestrichen und wie sich – Eva Illouz bezieht sich hierbei ausdrücklich auf die Entwicklung in Frankreich – die Beziehung zwischen der jüdischen und der arabisch-muslimischen Minderheit in den vergangenen Jahrzehnten insbesondere in Frankreich verändert habe. Der offene Antisemitismus habe sich nach der Nazizeit in Frankreich „nicht mehr blicken lassen“ (S. 65). Heute hingegen dominiere ein „Islamo-Gauchisme“, ein islamischer Linksradikalismus – auch dies ist in Deutschland inzwischen auf hiesigen Demos die dominierende Inszenierung der historisch und politisch Kenntnislosen.
Die Wurzeln reichen aber schon bis zum Begründer (1928) der Muslimbruderschaft, Hasan al-Banna, zurück, ein glühender Verehrer Hitlers, für den er Mein Kampf mit Mein Dschihad übersetzte. Es folgte die antizionistische Sowjetpropaganda kurz nach der Anerkennung der israelischen Staatsgründung auch durch die Sowjetunion. Nun wurde Zionismus gemäß Stalins Ideologie mit Rassismus gleichgesetzt. Die heutige Hamas sei „die direkte Erbin dieser religiösen, nazistischen, nationalistischen und antiimperialistischen Vernebelung“ (S. 69), hebt Eva Illouz hervor. Die Figur des Proletariats wurde nun durch die des Muslims ersetzt. Islamismus gilt nun als Klassenkampf – solche reaktionäre Ideologie kommt in den unterprivilegierten arabischen Stadtteilen Europas gut an.
Auch der Iran mischte nun mit, etwa im Jahr 1991 durch eine internationale Konferenz zur Unterstützung einer islamischen Revolution in Palästina. Auch solche Flugblätter fanden sich übrigens auf dem sog. „Rheinmetall-Zeltlager“ in Köln Ende August. Auch für diesen Entwicklungsprozess benennt die Autorin die Protagonisten und deren Literatur. Es entstand auch eine Achse zwischen dem Iran und Venezuela: Nun inszenierte sich Chavez, der sein Volk ausbeutete wie lange vor ihm niemand, ausgerechnet als antiimperialistischer Kämpfer. Heute folgt ihm der Brasilianer Lula, indem dieser „den Krieg Israels in Gaza als neue Schoah charakterisiert“ (S. 73).
Komplementiert wurde dies durch Humanökologen wie Andreas Malm, einem schwedischen Journalisten und radikalen Aktivisten, der nun auch noch die Ökologie mit der Ideologie des Islam liierte – in dem Sinne, dass ausgerechnet Israel, das Land mit der modernsten, ökologischen Wassernutzung, Teil einer „größeren Struktur“ sei, die den Planeten zerstöre: „In der Nachfolge der „Protokolle der Weisen von Zion“ hat Malm Juden durch Zionisten ersetzt und eine Zerstörung der Welt durch die Juden in der Form des Klimawandels konkreter und greifbarer gemacht.“ (S. 76)
Eine radikal semantische Transformation
In einem weiteren Kapitel schreibt Eva Illouz über die 2010 gegründete französische Parti des Indigènes de la République“ (PIR) der französisch-algerischen Politaktivistin Houria Bouteldja, die sich als akademische Kämpferin gegen „Islamophobie“ und Neokolonialismus verkaufe, um antisemitischen Antizionismus und konservativen Islam zu legieren. In dem Buch „Die Weißen, die Juden und wir“ schreibt diese, man erkenne einen Juden nicht an seiner Selbstbezeichnung als Jude sondern an „seinem Durst, sich mit der Weiße verschmelzen zu wollen, seinen Unterdrücker mit großer Mehrheit zu billigen und die Kanons der Moderne verkörpern zu wollen.“ (S. 79) Auch solcherlei kopftuchbewährter, ideologisch und taktisch geschickt lancierender Maskerade begegnet man fortgesetzt auf den hiesigen „Pali-Demos“ seit dem Pogrom der Hamas.
Angela Davis und Butler traten als Ehrengäste bei deren islamistischen Parteievents auf. Der protegierte Dekolonialismus stütze sich, so Eva Illouz, auf „die hochgradig globalisierten Netze der akademischen Welt – zweifellos die am stärksten globalisierten der Welt.“ (S. 80) Auch die Muslimbruderschaft sei inzwischen ein fester Bestandteil solcher dichter Netze an amerikanischen Universitäten. Die allgegenwärtige, kollektive Verdammung Israels und von Juden in Folge des Hamas-Pogroms sei also die Folge einer „radikal semantischen Transformation“ und ein „Zusammenfluss von verschiedenartigen politischen und soziologischen Prozessen auf nationaler wie globaler Ebene“, so die israelisch-französische Soziologin (S. 83).
Der Antizionismus als die intellektuell respektable Version des Antisemitismus
Der heutige Antisemitismus liefere seinen Anhängern einen „kognitiven Trost“ (S. 85f). Affektiv aufgeladene Wörter, in denen das schwer attackierte Israel entgegen aller Realität dämonisiert wird, ordnen scheinbar das Chaos der Geschichte und unsere eigene Unwissenheit. Nun erscheine, auch dies ist täglich bei den Hamas-Demos zu beobachten, die palästinensische Sache, trotz oder wegen des Pogroms, als „von Haus aus gut: Israel, selbst wenn es auf einen Angriff reagiert, verkörpert schlechthin das Böse.“ (S. 88)
Der Antizionismus als „die intellektuell respektable Version des Antisemitismus“ (S. 91) gebe sich als eine tugendhafte Ideologie aus, die kollektiv kognitiven und identitären Trost spende.
Die heutige Linke müsse deshalb zuerst einmal „ihre Gewissheiten in Frage stellen (S. 91) und sich auf die akademischen Tugenden der Komplexität und der Wahrheit einlassen. Nur so vermöge man übrigens, wenn dies denn wirklich intendiert sei, die Rechte der Palästinenser zu vertreten. „Der Hass beschädigt und macht unglaubwürdig.“ (S. 92) Es bedürfe heute einer analytischen Einstellung „die gerecht und von umfassender Brüderlichkeit ist“ (S. 92). Mit diesen Worten endet Eva Illouz im August 2024 zuerst auf französisch vorgelegter schmaler, großartiger Essay.
Nicht nur einmal habe ich bei der Lektüre an den 2019 viel zu früh verstorbenen israelischen Psychoanalytiker Carlo Strenger denken müssen.
Eva Illouz: Der 8. Oktober, Suhrkamp Verlag 2025, 102 S., 12 Euro, Bestellen?