Hans-Peter Heekerens, geboren 1947, war bis zu seiner Pensionierung Hochschullehrer für Soziale Arbeit in München. Er hatte eigentlich vor, kein Buch mehr zu schreiben, sondern den Ruhestand zu genießen. Der anlasslose Angriffskrieg von Putins Russland gegen die demokratische Ukraine brachte ihn innerlich so sehr auf, dass er doch noch einmal an die jüdischen Wurzeln des untergegangenen Galiziens erinnern wollte.
Von Roland Kaufhold
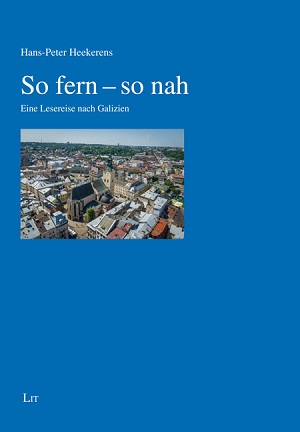 Erinnern nicht in eng fachwissenschaftlichem Sinne sondern durch eine gut lesbare Rekonstruktion von neun jüdischen Biografien, die in Galizien und der Bukowina ihren Anfang und ihre Prägungen gefunden haben. Ausgewählt hat er seinem Fachgebiet entsprechend, vor allem jüdische Psychoanalytiker – Helene Deutsch, Otto Rank, Sándor Ferenczi, Wilhelm Reich und den Amerikaner Abraham Brill – sowie u.a. Martin Buber, Hersch Lauterpacht, Raphael Lemkin sowie Manès Sperper.
Erinnern nicht in eng fachwissenschaftlichem Sinne sondern durch eine gut lesbare Rekonstruktion von neun jüdischen Biografien, die in Galizien und der Bukowina ihren Anfang und ihre Prägungen gefunden haben. Ausgewählt hat er seinem Fachgebiet entsprechend, vor allem jüdische Psychoanalytiker – Helene Deutsch, Otto Rank, Sándor Ferenczi, Wilhelm Reich und den Amerikaner Abraham Brill – sowie u.a. Martin Buber, Hersch Lauterpacht, Raphael Lemkin sowie Manès Sperper.
Heraus gekommen ist eine gut lesbare Mischung, die zum biografischen Weiterlesen anregt.
Einleitend zeichnet der Autor nach, wo heute das ehemalige Galizien und die Bukowina liegen. Sie wurde aufgeteilt und erstreckt sich vom südlichen Polen über die südliche Ukraine bis nach Rumänien.
Bertha Pappenheims Name genießt als ehemalige Patientin Freuds, deren Krankengeschichte bis heute in der Fachliteratur gelegentlich rezipiert wird, bis heute in psychoanalytischen Fachkreisen eine gewisse Berühmtheit. 1903 unternahm sie zusammen mit Sara Rabinowitsch im Auftrag des Frankfurter Israelitischen Hilfsvereins eine Studienreise nach Galizien, aus der der Autor großzügig zitiert. Die weitgehend untergegangene jüdische Geschichte wird hierdurch wieder lebendig.
Der Zionismus als Idee, so schrieben sie 1903, sei in seinem „befreienden und belebenden Element“ (S. 39) eine wegweisende Größe. „Wohl wäre es schön, dem jüdischen Volk ein Land zu gebe. Aber so wie das Volk heute beschaffen ist, kann es noch nicht als Nation leben.“ (S. 39) Erschwerend komme hinzu: Die Zionisten seien „schlechte Bauleute. Ihre Luftschlösser sind Hochbauten ohne Tiefbau. Jeder von ihnen hält sich als Theoretiker auf irgend einem geistigen Gebiete für bedeutend und wertvoll.“ (ebd.) Er halte sich jedoch für so bedeutend und wertvoll dass ihm die erforderliche Arbeitsleistung eher nicht möglich sei. Man hätte den zionistischen Autoren einen Blick in das Tel Aviv des Jahres 2025 gewünscht.
1898 kam Martin Buber nach der Lektüre von Birnbaums „Die jüdische Moderne“ zum Zionismus. Diesen vertrat und betrieb er jedoch vorrangig nicht als ein politisches Projekt, wie Herzl, sondern als ein kulturelles Projekt und als eine Form der Selbstbefreiung: „Ich bekannte mich zum Judentum, ehe ich es recht eigentlich kannte.“ (S. 62)
Der Völkerrechtler Raphael Lemkin wurde mir durch meinen Freund Dogan Akhanli (1957 – 2021) vertraut – den der Autor nicht erwähnt. Immer wieder verwies Dogan Akhanli auf Lemkins Schriften zum Völkerrecht. Angeregt wurde Lemkins lebenslange, durch den Schock der Shoah verstärkte Suche als praktizierender Staatsanwalt nach einem internationalen Strafrecht zur Verhütung von Völkermorden. Eine weitere frühe Quelle seines völkerrechtlichen Engagements bildete seine Beschäftigung mit dem auch heute noch in der Türkei – nach über 100 Jahre – weitestgehend geleugneten Völkermord der Türken an den Armeniern. (Kaufhold 2015)
Aber schon als Kind, im Jahr 1906, hatte der 1900 Geborene vom Pogrom in Bialystok erfahren; das Wissen hiervon erreichte ihn auf „unserem Bauernhof. Die Meute hatte die Mägen ihrer Opfer aufgeschlitzt.“ (S. 77) Als Zeitzeuge war die Verleugnung des deutschen Massenmordprogramms für viele Juden ab 1939 eine innere Notwendigkeit. Lemkin war hierdurch innerlich erschüttert: „Selbst viele europäische Jüdinnen und Juden konnten und wollten sich das ganze Grauen erst vorstellen, als sie schon mittendrin waren.“ (S. 81)
Lemkin, dessen Bedeutung bis heute kaum verstanden wird, versuchte nach der Shoah den Genozid als Straftatbestand in die alliierten Anklageschriften gegen die bedeutendsten deutschen Kriegsverbrecher einzuflechten. Kurz vor seinem frühen Tod im Jahr 1959 arbeitete er an seinen Memoiren. Sein Werk fand keinerlei publizistisches Interesse und erschien erst 2020 auf Deutsch als Buch.
Die Psychoanalytikerin Helene Deutsch, die über Studien zur Psychologie der Frau in Fachkreisen bekannt wurde, wurde 1900 im galizischen Przemysl, heute eine polnische Grenzstadt zur Ukraine, geboren. Zeitlebens blieb Helene Deutsch, die zum Studium nach Wien gegangen war, dort in das Umfeld Freuds hineinwuchs und ein Jahr lang beim „Meister“ eine Therapie machte, ihrem jüdisch-polnischen Erbe verbunden: „Mein ganzes Leben lang sollte Przemysl für mich das wahre Symbol meiner wahren Identität bleiben“, notierte sie in ihrer Autobiografie „Selbstkonfrontation“ (S. 87). 1934 emigrierte sie in die USA und setzte dort ihre psychoanalytische Karriere fort.
„Ohne Sympathie keine Heilung“
Der ungarische Psychoanalytiker Sándor Ferenczi war lange ein Geheimtipp. Ferenczi hatte 1914 bei Freud seine Lehranalyse gemacht, die beiden verbrachten sogar gemeinsame Urlaube.
1932 erschien sein klinisches Tagebuch. Dieses blieb über Jahrzehnte nahezu unbekannt und bis zu seinem Tode im Jahr 1969 unveröffentlicht – vor allem, weil es 1932 zu einem Bruch zwischen Freud und Ferenczi gekommen war. „Ohne Sympathie keine Heilung“, das war Ferenczis patientenzugewandtes einfühlungsreiches Programm. Seine Schrift bildete auch einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Kinderanalyse als eigenständige psychotherapeutische Disziplin wie auch zur Entwicklung der psychoanalytischen Pädagogik (Anna Freud, Bruno Bettelheim, Rudolf Ekstein etc.) (vgl. Kaufhold 1993, 2001).
Heekerens zeichnet dieses tragische Beziehungsgeflecht zwischen diesen beiden Psychoanalytikern nach und bezieht sich hierbei vor allem auf die Schriften des linken Psychoanalytikers Johannes Cremerius.
„Einer gegen alle“ – Wilhelm Reich
Der ungestüme, kreative, tragische Wilhelm Reich wurde 1897 als Kind von säkularen jüdischen Eltern geboren. In einer seiner autobiografischen Schriften schrieb Reich im Rückblick: „Meine Muttersprache war von Anfang an Deutsch, ebenso meine Schulung. Meine Eltern legten großen Wert darauf, dass ich das Jüdisch der umgebenden Bevölkerung nicht sprach. Es galt als „unfein“. Die Äußerung eines jüdischen Ausdrucks brachte schwere Strafe ein.“ (S. 120)
Betitelt hat der Autor seine gut lesbare Erinnerung an Wilhelm Reich mit dem vom Rezensenten mit Quellenangabe entliehenen Titel „Einer gegen alle“.
Auch die Beziehung zwischen Freud und dem anfangs marxistischen psychoanalytischen Theoretiker Wilhelm Reich (Freud über den jungen Reich: „Er ist wirklich gut“, S. 126) verlief tragisch – sie endete mit Reichs Tod in einem amerikanischen Gefängnis, die sein amerikanischer Biograf Sharaf kongenial nachgezeichnet hat (Kaufhold 2025).
Spannend zu lesen ist die Lebensgeschichte des „dissidenten“, anfangs kommunistischen Theoretikers und Alfred Adler-Schülers Manès Sperber. 1905 im ostgalizischen Schtetl Zablotow aufgewachsen wird dieses von Sperber im autobiografischen Rückblick als eines der „ärmsten und rückständigsten Galiziens“ erinnert, „das ich nie geliebt hatte.“ (S. 132) 1916 verließ Sperber es Richtung Wien.
Den ersten Weltkrieg, den er als Kind erlebt und mit dem seine Kindheit „ihr abruptes Ende“ (ebd.) gefunden habe, habe ihn zeitlebens geprägt. Dieser abrupte Bruch in seiner Biografie sei zeitlebens in ihm wirkend geblieben. Zugleich verabschiedete er sich in dieser frühen Lebensphase vom Chassidismus seiner galizischen Kindheit.
In Wien las er als dauerhafter Besucher der Bibliothek in der Leopoldstadt inständig. 1933 dann, da ist er 28, erlebt er die rassistische Verfolgung und die „Schutzhaft“. Parallel hierzu engagiert er sich beim linkszionistischen Haschomer, dessen Programm eine Übersiedelung nach Palästina und der Aufbau eines Kibbuz vorsieht. Eine weitere Bestimmungsgröße bildet für Sperber anfangs der Wiener Individualpsychologe Alfred Adler, welcher sich früh von Freud abgewendet hatte. 1926 da ist er erst 21, schreibt er über Adler. Nach einer langen Phase der Trennung folgt 1983 ein weiteres Buch über „Alfred Adler oder Das Elend der Psychologie.“ Dann in Berlin seine Hinwendung zum Kommunismus und zur KPD, die besagte Gefängnishaft zur Folge hatte. Stalins brutale Säuberungen im Jahr 1937 führten zu Sperbers radikaler Trennung von der KPD. Seine lebenslange Auseinandersetzung mit der Verführung des Totalitarismus arbeitete er mehrere Jahrzehnte in seinen literarischen Werken auf. Davon erzählt Heekerens in seinem kurzweiligen Buch jedoch nicht mehr.
Hans-Peter Heekerens (2024): So fern – so nah. Eine Lesereise nach Galizien. Berlin: Lit Verlag, 172 S. , 24,90 Euro, Bestellen?
Literatur
Roland Kaufhold (Hg., 1993): Pioniere der psychoanalytischen Pädagogik: Bruno Bettelheim, Rudolf Ekstein, Ernst Federn und Siegfried Bernfeld. psychosozial 53, Psychosozial-Verlag, Gießen 1993.
Roland Kaufhold (2001): Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen: Psychosozial-Verlag.
Roland Kaufhold (2025): Rezension von: Myron Sharaf (2022). Wilhelm Reich – Erforscher des Lebendigen, in: psychosozial Heft 1/2025, S. 108-111




