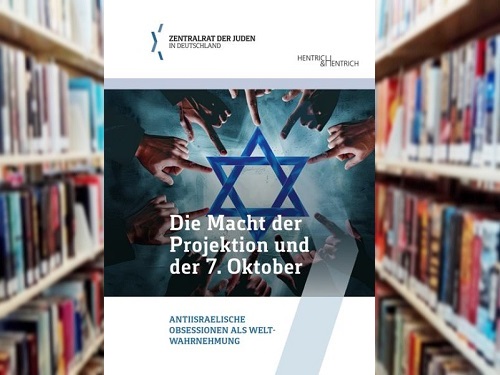Zu den Folgen und Hintergründen des antisemitischen Massakers am 7. Oktober 2023 erschien jetzt ein Sammelband – vom Zentralrat der Juden in Deutschland herausgegeben. Er enthält ganz unterschiedliche Aufsätze, welche die persönliche Deutung von fehlender Solidarität thematisieren, aber auch die ideologischen Hintergründe von israelfeindlichen Zerrbildern hinterfragen.
Von Armin Pfahl-Traughber
Über die Folgen des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 liegen mittlerweile einige Veröffentlichungen vor, was angesichts der Dimensionen dieser Massenverbrechen mehr als nur verständlich ist. Es gibt aber viele Detailaspekte, die immer noch kein größeres Interesse gefunden haben. Daher lohnt sich auch der Blick in einen neuen Sammelband, der vom Zentralrat der Juden in Deutschland herausgegeben wurde: „Die Macht der Projektion und der 7. Oktober. Antiisraelische Obsessionen als Weltwahrnehmung“. Er enthält 18 Aufsätze in unterschiedlicher Form und mit verschiedenen Schwerpunkten. Dass es dabei an einer gewissen Einheitlichkeit fehlt, ist indessen für Sammelbände typisch. Allgemein ging es der aus Doron Kiesel bestehenden Redaktion zusammen mit Christian Staffa darum, ganz unterschiedliche Bezüge auf die mörderischen Ereignisse zu thematisieren. Es sollten auch die Folgewirkungen für jüdisches Leben wie die für das Massaker relevanten ideengeschichtlichen wie realpolitischen Zusammenhänge wichtig werden.
Dazu wurden vier große Kapitel gebildet: Zunächst geht es um „Jüdisches Leben nach dem 7. Oktober 2023 in Deutschland und Israel“, wozu man dann persönliche Betrachtungen wie sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse finden kann. So gibt es etwa eine subjektive Bestandsaufnahme von Esther Schapira, aber auch von Julia Bernstein sozialwissenschaftliche Forschungsergebnisse. Bei alldem lässt sich auch eine große Enttäuschung spüren, welche mit fehlender Solidarität zusammenhing. „Eine breite Solidarisierung mit der jüdischen Community gab es nach dem 7. Oktober nicht“ (S. 44), heißt es etwa bei Susanne Urban, und weiter: „Antisemitismus ist historisiert und in die Geschichte der Shoah eingekapselt worden“(S. 46). Und Alexandra Krioukov konstatiert: „Wenn wir auf die Zeit nach dem 7. Oktober schauen, blicken wir auf eine Landschaft voller zerbrochener Brücken“ (S. 71), die er gerade als Student an Universitäten vielfach wahrnahm. Es geht hier um bedenkliche Beobachtungen, nicht um individuelles Wehklagen.
Im zweiten Kapitel stehen die Täter im Zentrum: Die Hamas ist etwa bei Peter Neumann, dem bekannten Terrorismusforscher, das Thema. Gut in der Differenzierung nachvollziehbar und auf engem Raum macht er auf die Spezifika aufmerksam, die in drei Faktoren gesehen werden: „der tiefen Verankerung in der eigenen Gesellschaft … der finanziellen und militärischen Unterstützung durch externe Sponsoren“ und „dem strategischen Einsatz terroristischer Mittel“ (S. 163). Die folgenden beiden Aufsätze von Julie Grimmeisen und Carolin Heymann-Serota gehen darauf ein, dass besonders brutale Formen sexualisierter Gewalt vorkamen. Man traut sich kaum hier eine auch nur allgemeine Beschreibung zu. Kritische Aufmerksamkeit verdient dabei noch ein anderer Gesichtspunkt: Aus der feministischen Frauenbewegung heraus wurden diese Verbrechen keineswegs deutlich und einheitlich verurteilt. Es gab sogar vereinzelt Leugnungen und Relativierungen, wozu einem angesichts der eindeutig belegbaren Ereignisse auch schlicht die Worte fehlen.
Das dritte Kapitel ist mit „Entwicklungen des Antisemitismus und christliche Ambivalenzen“ überschrieben, eben auch kritisch auf solche Ambivalenzen in kirchlichen Deutungen zum Massaker bezogen. Und schließlich sind im vierten Kapitel „Schuldprojektionen auf Israel: Genozid, Rassismus, Kolonialismus“ ein Thema. Dabei wird insbesondere auf die Auffassungen aus dem Postkolonialismus eingegangen, wozu Ingo Elbe eine ausführliche Monographie vorgelegt hat, wovon hier eine Zusammenfassung geliefert wird. Blickt man gerade auf die von ihm und Johannes Becke wie Katharina von Kellenbach vorgebrachten Zitate, werden auch die geistigen Hintergründe mancher Konstellationen von Protestbewegungen an Universitäten verständlich. Man darf dankbar für die Entscheidung der Herausgeber sein, auch dazu Aufsätze in den Sammelband aufgenommen zu haben. Denn die Auswüchse der behandelten Diskurse dürften noch zukünftige Kontroversen wie Proteste prägen. Eine ideologiekritische Auseinandersetzung damit ist von großer Wichtigkeit.
Zentralrat der Juden in Deutschland (Hrsg.), Die Macht der Projektion und der 7. Oktober. Antiisraelische Obsessionen als Weltwahrnehmung, Leipzig 2025 (Hentrich & Hentrich-Verlag), 344 S., Bestellen?