Das Jahrbuch nurinst 2022 ist erschienen. Historikerinnen und Historiker aus Deutschland, Israel und Österreich beleuchten in seinem Themenschwerpunkt jüdische kulturelle Aktivitäten in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Damit greift das Institut erneut wichtige, aber bislang wenig beachtete Themen auf. Der Band besteht aus zwei Teilen: den Beiträgen zum Schwerpunktthema, drei weiteren Texten zum Thema Erinnerungskultur und der Vorstellung einer wissenschaftlichen Institution.
Von Rotraud Ries
Zum Einstieg befasst sich Alexander Schmidt mit der Konstruktion einer NS-deutschen Kultur ohne Juden in Nürnberg. Ihr erster Schritt war die Ausschaltung von Jüdinnen und Juden im Kulturleben der Stadt. Dem folgten zunächst Veranstaltungen in einer Mischung aus Politik und Kultur und schließlich die monumentalen Bauvorhaben für die Reichsparteitage. Diese sollten als Gesamtkunstwerk in einer architektonisch und landschaftlich neu gestalteten Umgebung in Szene gesetzt werden. Der Abriss der Synagoge im August 1938 war Teil der komplementären Pläne zur Umgestaltung der Stadt. Zu ihrem Glück konnte nur ein Teil der Gesamtplanungen realisiert werden.
Der Kulturbund war die jüdische Antwort auf solche Prozesse, was bislang wenig untersucht ist. Dem geht Jim G. Tobias anhand der lokalen jüdischen Gemeindezeitungen für Nürnberg nach. Schon vor dem Ausschluss der Juden aus der Reichskulturkammer im Herbst 1933 gründete sich der Jüdische Kulturbund in Berlin für exklusiv-jüdische Veranstaltungen. Weitere lokale und regionale Verbände folgten bald und schlossen sich 1935 zum Reichsverband zusammen. Auch in Nürnberg starteten die Aktivitäten bereits Ende 1933. Genehmigte Veranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen und Vorträge durften nur in Räumen jüdischer Besitzer wie z.B. der Synagoge oder der Turnhalle der Israelitischen Volksschule stattfinden. Nach und nach wurden Aufführungen „deutscher“ Künstler und Werke eingeschränkt. Im November 1938 wurden Kulturveranstaltungen wie auch jüdische Zeitungen verboten und die Kulturbünde aufgelöst.
Aus dem KZ Bergen-Belsen sind 37 Häftlingstagebücher erhalten. Thomas Rahe stellt diesen eindrucksvollen Quellenbestand vor und analysiert ihn. Geschichte und Funktion des Lagers, das nur zwei Jahre existierte, erklären deren vergleichsweise große Zahl. Sein Ursprung und Kern war ein rein jüdisches Austauschlager für Familien mit vergleichsweise besseren Lebensbedingungen. 2.650 der 14.600 Häftlinge gelangten tatsächlich im Tausch gegen deutsche Gefangene in Freiheit. Ab 1944 erweitert, mutierte das KZ durch Hunger und Seuchen am Ende faktisch zum Sterbelager. Die Mehrzahl der Tagebuch-Schreiber:innen war jung und jüdisch, viele männlich, die meisten Autor:innen im Austauschlager interniert. Da Papier kaum zu bekommen und kostbar war, behelfen sich die Schreiber:innen mit ungewöhnlichen Schreibmaterialien. Ihr Schreiben bedeutete Gefährdung und Anstrengung, denn sie waren nie allein, fürchteten immer den Verlust des Tagebuchs. Zugleich stellte das Schreiben den Versuch dar, sich die menschliche Würde zu erhalten, Distanz zu gewinnen. Dokumentationsabsichten und ethische Verpflichtung, historisches Bewusstsein lassen sich ausmachen.
Mehrere der folgenden Beiträge widmen sich Ausstellungen, organisiert von Überlebenden. Die erste Ausstellung, die Katja Seybold vorstellt, greift dabei weit über eine übliche Schau hinaus. Die „befreiten Juden in der britischen Zone“ organisierten sich kurz nach der Befreiung und gründeten u.a. eine Historische Kommission, die die Shoa dokumentieren sollte. Diese fasste im April 1947 den Beschluss, zu einem Kongress im Juli eine Ausstellung zu zeigen. Gemeinden und Organisationen wurden aufgefordert, Materialien über Verfolgung und Leben nach der Befreiung zu schicken. Trotz der extrem kurzen Vorbereitungszeit entstand eine gigantische Ausstellung unter der Leitung von Rafael Olewski und Zvi Horowitz. In 22 Abschnitten wurden gut 3.000 Exponaten auf 1.000 qm im ehemaligen Offizierskasino der Wehrmacht in Bergen-Belsen präsentiert. Der Ansatz war historisch, reichte bis ins Mittelalter zurück, doch es ging zugleich um Gedenken, das aktuelle jüdische Leben und das Ringen um die Auswanderung nach Palästina. Kunstwerke fehlten ebenfalls nicht. Ursprünglich nur für 11 Tage ab dem 20. Juli 1947 geplant, wurde die Ausstellung bis Ende November gezeigt. Weitere Standorte scheiterten vor allem am Umfang, die Exponate wurden letztlich auf verschiedene Archive internationaler jüdischer Organisationen verteilt.
Die DP-Ausstellung in München, über die Jutta Fleckenstein berichtet, zeigt sich demgegenüber als reine Kunstausstellung. Bildende Künstler aus den Selbstvertretungsorganen schlugen sie vor, und zwar nach professionellen Kriterien. Ein Künstlerrat verhandelte direkt mit dem Leiter der Städtischen Galerie im Lenbachhaus. Das Misstrauen gegenüber den DP’s ist in der Kommunikation mit Händen zu greifen. Im November 1948 wurden im Lenbachhaus 165 Arbeiten von einer Künstlerin und vier Künstlern gezeigt. Die Ausstellung ist in einer kleinen Broschüre ohne Abbildungen dokumentiert. Der älteste und erfahrenste Künstler Maximilian Feuerring (1896-1985) steuerte allein 74 Arbeiten bei. Die übrigen Künstler waren jünger als er, geboren zwischen 1909 und 1917. Ewa Brzezinska (1911-1985) stellte Nachkriegswerke (Aquarelle) aus, Hirsch Szylis (1909-1987) Alltagszeichnungen aus dem Ghetto Lodz. Der Avangardist Pinkus Schwarz (1917-1996) präsentierte Werke, die nach der Shoa entstanden waren, darunter Bühnenmodelle. Leon Kraicer (geb. 1913) beteiligte sich mit Skulpturen. Doch wer besuchte – außer DP’s – diese Ausstellung? Diese Frage wird nicht gestellt.
Curt Courant, Willy Goldberger und Eugen Schüftan dienen als Beispiele für die Schwierigkeiten, die emigrierte Filmschaffende v.a. in den USA hatten, um ihre hoch qualifizierte künstlerische Arbeit fortzusetzen. Die Gewerkschaft in den USA verlangte, dass sie ganz unten wieder anfingen. Imme Klages fragt in ihrem Beitrag nach ihrer Rückkehr nach Deutschland. Die Kameramänner arbeiteten nach 1945 in vielen Ländern, auch in Deutschland: um Geld zu verdienen. Für eine dauerhafte Rückkehr und die Fortsetzung ihrer künstlerischen Arbeit war die Zeit abgelaufen.
Der Beitrag von Andrea und Aviv Livnat über drei exemplarische Künstler in der Künstlerkolonie im israelischen Safed setzt den von Jutta Fleckenstein über die DP-Künstler in München fort. Die Entstehungsgeschichte der Künstlerkolonie 1948 in den Häusern der während der harten Kämpfe des Unabhängigkeitskrieges geflohenen und vertriebenen Palästinenser und der Niedergang infolge von Kommerzialisierung, Kriminalität und ultra-orthodoxer Überformung rahmen die drei Beispielbiographien. Viele Maler ließen sich von dem besonderen Licht in den galiläischen Bergen inspirieren oder stellten die malerischen Häuser und verwinkelten Straßen der Stadt dar; sie ließen die Vergangenheit hinter sich. Doch im Werk der drei vorgestellten Künstler lassen sich sehr unterschiedliche Spuren der Shoa aufzeigen. Der Maler Zvi Hirsch Shilis/Szylis, einer der DP-Künstler aus München, lebte von 1960 bis zu seinem Tod 1987 in Safed. Neben Porträts, Stillleben und Landschaften malte er aus der Erinnerung Szenen aus dem Ghetto und den Lagern. Sein Kollege Alexander Bogen aus Estland/Litauen überlebte bei den Partisanen in den Wäldern im Raum Wilna. Dort dokumentierte er zeichnerisch das Erlebte. In Safed malte er zunächst noch aus der Erinnerung, wandte sich dann aber den jüdischen und arabischen Menschen des Nahen Ostens und schließlich der Natur- und Landschaftsmalerei zu. Eine gewisse Leere kennzeichnet seine Gemälde, die mehr und mehr abstrakte Formen annahmen. Arie Merzer gehörte in Warschau zu einer Künstlergruppe, die die alte jüdische Tradition der Kupfer- und Silberreliefs wiederbelebte. In seinen Kupfer-Bildern spiegeln sich seine Lebensstationen wider, immer vor dem Kontext seiner religiösen und kulturellen Herkunft. Die meisten seiner Werke erinnern an das zerstörte jüdische Leben vor der Shoa. Safed wurde so zum Spiegelbild des Schtetls.
Die Dokumentation der Shoa durch jüdische Historiker begann bereits vor Ende des Krieges, denn der Auftrag zu erinnern (Zachor) ist Teil der jüdischen Kultur. In diesem Zusammenhang erinnert Alexander Carstiuc mit Leon Poliakov an einen ihrer prominentesten Vertreter: 1951 publizierte er (als Autodidakt) die erste analytische Arbeit über den Holocaust „Bréviaire de la Haine“ (Brevier des Hasses). Darin arbeitete er das Wesen der Shoa heraus: den zentralen Vernichtungswillen der NS, getrieben vom Hass auf die Juden. In weiteren Büchern zeigt sich Poliakov erstaunlich hellsichtig und aktuell in seiner Einschätzung des Antisemitismus, kritisiert den Antizionismus der Linken und die antisemitische Grundhaltung der UNO.
Die deutsche Wehrmacht war zuständig für ca. 10 Millionen Kriegsgefangene. Rolf Keller zeigt, dass jüdische Gefangene gemäß der Genfer Kriegsgefangenenkonvention in der Regel wie andere Gefangene des jeweiligen Landes behandelt wurden, so dass die meisten überlebten. Die Sowjetunion hatte die Konvention allerdings nicht unterschrieben. Und der Krieg gegen die Sowjetunion wurde aus ideologischen Gründen mit besonderer Brutalität geführt, ebenso gegen die Zivilbevölkerung und gegen jüdische Soldaten. Sie wurden häufig bereits hinter der Front ermordet. Die Ungleichbehandlung setzte sich im Reichsgebiet fort. Die „Russenlager“ wurden ab Sommer 1941 auf „untragbare“ Personen überprüft: politische und wirtschaftliche Funktionäre, Angehörige der Intelligenz, kommunistische „Aufwiegler“ und Juden. Brutal verhörte die Gestapo die Verdächtigen. Sie wurden formal von der Wehrmacht aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und außerhalb der Lager exekutiert, v.a. in den KZ‘s Sachsenhausen und Buchenwald (ca. 33.000 Personen insgesamt). Auf Juden hatte es die Gestapo besonders abgesehen, sie machten mindestens die Hälfte der Exekutierten aus. Nur sehr wenige überlebten.
In Deutschland gibt es, so Gerhard Jochem, kaum Gedenken an Emigranten im Dienste der Alliierten. In allen Armeen der Zufluchtsländer dienten ehemalige deutsche Juden, besonders in den USA und in Großbritannien (incl. Palästina). Sie hatten einen überproportionalen Anteil in den Armeen (insges. ca. 9.500 Personen) und wurden von einer hohen Motivation getrieben. Für Mittelfranken waren es z.B. mindestens 222 Personen. Die Armeen erkannten allerdings erst mit Verzug ihre Kompetenzen. Im Sommer 1942 startete eine besondere Ausbildung von Emigranten für ihren Einsatz in Deutschland in Camp Ritchie (USA). Sie wurden zur Befragung von Gefangenen eingesetzt, erhoben in Europa 60% des nachrichtendienstlichen Materials und waren an der Strafverfolgung und dem demokratischen Wiederaufbau beteiligt. Trotz dieser Verdienste tun sich deutsche Politik und Gesellschaft jedoch schwer, im Einsatz gegen NS-Deutschland gefallene Soldaten in die Erinnerungskultur aufzunehmen. Alte Denkmuster, die sie als Vertreter der Besatzer sehen, wirken nach. Der Jude, der sich als Soldat wehrt, passt nicht ins gängige Opferklischee.
Martha Keil stellt abschließend das „Institut für jüdische Geschichte Österreichs“ in St. Pölten vor. 1988 in der prachtvollen, restaurierten Synagoge von 1913 eröffnet, widmet sich das Institut seitdem der jüdischen Geschichte und Kultur in bemerkenswerter Breite vom Mittelalter bis heute. Aktuell steht eine grundlegende Renovierung der Synagoge an, das bewährte Nutzungskonzept wird fortgesetzt.
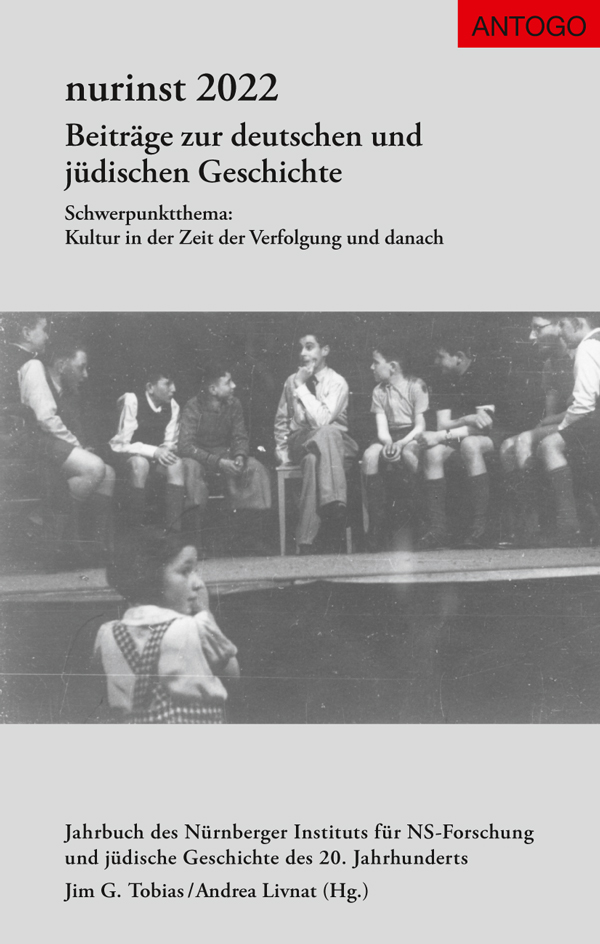 Ein gut strukturiertes Editorial, Informationen zu den Autorinnen und Autoren sowie Bildnachweise runden den innovativen Band ab – eine lohnende Lektüre!
Ein gut strukturiertes Editorial, Informationen zu den Autorinnen und Autoren sowie Bildnachweise runden den innovativen Band ab – eine lohnende Lektüre!
nurinst 2022. Beiträge zur deutschen und jüdischen Geschichte – Jahrbuch des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, Bd. 11. Schwerpunktthema: Kultur in der Zeit der Verfolgung und danach, hg. v. Jim G. Tobias und Andrea Livnat, Nürnberg: ANTOGO-Verlag 2022, 187 S. [m.] 22 Abb., BESTELLEN?
Autoren und Herausgeber stellen den Band am 22. Januar 2023, um 15.00 Uhr im Jüdischen Museum Franken, Königstr. 89 vor
Eintritt frei – Anmeldung
Bild oben: Jiddischsprachiges Plakat „Ausstellung der Jüdischen Künstler“ im Müncher Lenbachhaus (1948)
Foto: aus dem besprochenen Band (YIVO Archives New York)





