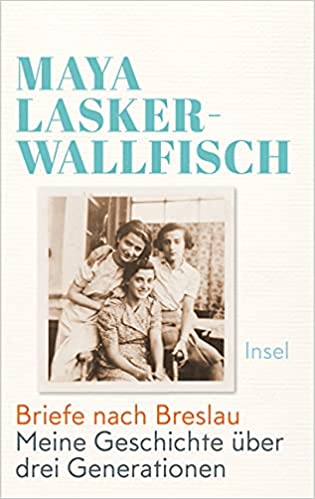Die Traumatherapeutin Maya Lasker-Wallfisch über ein schwieriges familiäres Erbe
Von Roland Kaufhold
„In meinem Elternhaus wurden zwei Sprachen gesprochen: Musik und Deutsch. Ich beherrschte keine der beiden. Damit fing das Problem an.“ (S. 9) Mit diesen Worten eröffnet Maya Lasker-Wallfisch, Tochter der heute 96-jährige Shoah-Überlebenden und Zeitzeugin Anita Lasker-Wallfisch, ihr aufrührendes Werk „Briefe nach Breslau“. Das Buch hat sie mit Unterstützung des Historikers Taylor Downing erstellt.
Die 1958 geborene Psychoanalytikerin und Traumaexpertin wählt einen doppelten Weg, um die Traumatisierungen, denen ihre Mutter Anita Lasker-Wallfisch in Auschwitz und Bergen-Belsen ausgesetzt war und die sie selbst – das ist das Hauptanliegen ihres eindrucksvollen Buches – von ihrer Mutter seelisch geerbt habe, zu veranschaulichen: Sie erzählt in ungeschminkter, persönlicher, einige Leser vielleicht verstörender Weise über ihren eigene, sehr schwierigen, anfangs selbstzerstörerisch anmutenden Sonderweg innerhalb einer hochmusikalischen, zugleich von der Shoah existentiell gezeichneten Familie.
Parallel hierzu versucht sie, aus der Perspektive der ausgebildeten Traumaexpertin und vor dem Hintergrund ihrer früheren massiven Traumatisierungen, einen Brückenschlag zu ihren Großeltern Alfons und Edith Lasker, den Eltern von Anita, Renate und Marianne Lasker-Wallfisch, zu schlagen. Ihr eigenes Leiden, ihre bereits früh einsetzende seelische Entwurzelung und massive Drogensucht liest sie zuvörderst als Erbe der Traumaisierungen, die ihre Großeltern und ihre Mutter durchleben mussten. Ihre Großeltern wurden 1942 im polnischen, südlich von Lubin liegenden Transit-Ghetto Izbica als Juden ermordet. Maya wurde 16 Jahre nach der Ermordung ihrer Großeltern geboren.
Maya schreibt 11 fiktive, sehr persönliche Briefe an ihre Großeltern Alfons und Edith. In diesen erzählt sie dem Leser den Lebensweg ihrer Großeltern und den Überlebenskampf von deren Kindern Anita, Renate und Marianne. Die 1921 geborene Marianne, die Älteste der drei Schwestern, war dank der Umsicht ihrer Eltern 1939 alleine mit den „Kindertransporten“ nach England und 1945 als überzeugte Zionistin nach Palästina eingewandert. Sie war am Aufbau einer Kibbuz beteiligt, vermochte sich im jungen Staat Israel zu etablieren und verstarb 1952 bei der Geburt ihres zweiten Kindes. Die sechs Jahre später geborene Autorin Maya Lasker-Wallfisch wurde nach Marianne benannt, sollte also für ihre Eltern auch eine seelische Leerstelle ausfüllen.
In ihrem zweiten fiktiven Brief an ihre Großeltern berichtet sie diesen: „Marianne war die Familienarchivarin.“ (S. 26) Marianne bewahrte alle Familiendokumente in einer Kiste, übergab diese 1950 ihrer Schwester Anita, die diese 35 Jahre lang ungeöffnet ließ. Zu schmerzhaft war das Erbe der Zerstörung und des Überlebens. Der Jurist Alfons und die Musikerin Edith, hätten ihre Kindern, so versichert Maya, „dazu ermuntert, ein eigenes Instrument zu lernen.“ (S. 27) 1938, als Anita Lasker 13 war, ging sie alleine nach Berlin, um dort beim jüdischen Musiker Leo Rostal Cello zu studieren.
„Wir wissen nicht genau, wie ihr zu Tode kommt“
Alfons, der Rechtsanwalt und Notar, spürte die Gefahr und versuchte, mit zunehmender Verzweiflung, mit der Familie nach Palästina zu emigrieren. Die letzten erhalten gebliebenen Briefe dieses Optimisten aus dem Durchgangslager Izbica an seine noch in Breslau befindlichen Töchter sind von Resignation geprägt: „Mutti kann nicht ranschreiben, es geht ihr nicht gut, sie ist krank“ (S. 63), schreibt er. Der letzte Satz: „Schickt Nahrungsmittel.“ Der letzte Brief enthält einen Psalm. Tausende Juden mussten ihr eigenes Grab schaufeln. „Wir wissen nicht genau, wie ihr zu Tode kommt. Und es ist kaum auszuhalten, daran zu denken, wie furchtbar eure letzten Tage gewesen sein müssen. Ich kann nicht weiterschreiben. In Liebe“ (S. 64) schreibt Maya in ihrem fiktiven Brief.
Dann schreibt sie über den Überlebenskampf ihrer Mutter und deren Schwester Renate. Beide müssen in einer Papierfabrik arbeiten, planen die Flucht und werden auf dem Bahnsteig von der Gestapo verhaftet. Die Zeit im Gefängnis vermögen sie zu ertragen. Anita wird im Juni 1943 zu 18 Monaten Haft verurteilt, es folgt eine Trennung von ihrer Schwester, der weitere Trennungen folgen. Ihre Mutter Anita habe „wahnsinnige Angst“ (S. 108) gehabt, vermochte jedoch weiter zu kämpfen und sich einen seelischen Schutzpanzer zuzulegen. Maya, die als Kind unter der scheinbaren Gefühllosigkeit ihrer Mutter litt, vermag nun im Rückblick zu schreiben, sie sei überzeugt davon, daß ihr dieser Panzer geholfen habe, „sich selbst in größter Gefahr nicht kleinkriegen zu lassen. Es verlieh ihr eine Rüstung, die sie bis heute schützt.“ (S. 108)
Dann berichtet sie ihren Großeltern vom Wunder des Wieder-Zusammentreffens von Anita und Renate in Auschwitz: Renate erkennt nach ihrer organisierten Entmenschlichung – ihr wurde der Schädel rasiert und die KZ-Nummer auf den Arm tätowiert – die Schuhe ihrer Schwester wieder: „Die Schuhe mit den knallroten Schnürsenkeln wurden zu einem Symbol der Hoffnung“, schreibt sie (S. 112). Die Gemeinsamkeit stärkte ihren Überlebenswillen, „wenigstens hatten sie einander, gegenseitig spendeten sie sich Liebe und Trost.“ (S. 113) In der Buchmitte sieht der Leser eine Vielzahl gemeinsamer Kinderfotos der Geschwister mit ihren Eltern. Diese sind wie durch ein Wunder erhalten geblieben.
Es folgt in den fiktiven Briefen die Überlebensgeschichte Mariannes, sie hat es in das rettende Großbritannien geschafft. Unmittelbar nach der Befreiung von Auschwitz ein weiteres Wunder: Eine Nachbarin erzählt Marianne von einem BBC-Interview mit einer Überlebenden namens Anita Lasker. Sie schreibt spontan einen Brief, adressiert schlicht mit „Anita Lasker, Bergen Belsen“ (S. 132) und schickt diesen über das britische Militär los. Kurz danach geht sie mit ihrem Mann nach Palästina, beteiligt sich am Aufbau des Kibbuz HaMa´apil: „Ich bin schon oft da gewesen“ (S. 133), fügt die Autorin hinzu. Der brüchige Brückenschlag der ehemaligen Drogenabhängigen zur eigenen Familiengeschichte gelingt, wenn auch von Rückschlägen begleitet. Als ihre Tochter Michal 1947 geboren wird verstirbt die 31-jährige Marianne. Für ihre Mutter Anita wird ihre Schwester zum Idol – und benennt ihre eigene Tochter nach ihr. Erneut muss sie eine phantasierte Lücke schließen, ihre bloße Existenz ist an das Trauma gebunden.
Maya Lasker-Wallfisch erzählt die Überlebensgeschichte ihrer Mutter als Mitglied des Lagerorchesters von Auschwitz nach. Sie wurde von der österreichischen Violinistin Alma Rosé ausgewählt, die das das KZ-Orchester, das täglich mehrfach im KZ spielen musste, mit harter Disziplin leitete. Rosé wurde im April 1944 in Auschwitz ermordet.
Nach der Befreiung hätten die beiden etwa 20-jährigen Geschwister, „wahnsinnig gerne“ über Auschwitz erzählt, aber, so konstatiert die Autorin, „niemand fragte sie danach.“ (S. 159) Die Befreier, die britischen Soldaten, waren fassungslos, entsetzt über die Verbrechen, die sie bei der Befreiung der Lager vorfanden.
Nun begann für die Schwestern Anita und Renate der Kampf um den biografischen Neuanfang, die traumatischen Wunden mussten verdrängt werden, um weiterleben zu können. Sie, die niemand nach ihren Erfahrungen fragte, schwiegen, auch innerfamiliär, für Jahrzehnte – aber aus sehr anderen Gründen als die Deutschen. Anita wurde am 15.4.1945, fünf Tage nach der Befreiung von Bergen-Belsen, von Patrick Gordon Walker inmitten der Leichenberge über die Verbrechen befragt; Anita hielt anschließend für die BBC auch die bereits erwähnte Radioansprache. Ihre Rede gilt als das erste auf Band aufgezeichnete Zeugnis einer Überlebenden.
„Jetzt habe ich das Gefühl, Großeltern zu haben“ (S. 250), konstatiert die Autorin in ihrem letzten fiktiven Brief. Sie zitiert aus dem Brief ihrer Mutter vom Frühjahr 1945, noch in Bergen-Belsen verfasst: „Wir müssen stets so leben, als würden unsere Eltern auf uns schauen.“ (S. 250)
Drogenkarriere und Verwahrlosung
Parallel hierzu erzählt die Autorin in sehr direkter Weise ihre über ein Jahrzehnt anhaltende Entwicklung als Jugendliche und junge Erwachsene, die vor allem durch Nichtanpassung, selbstverletzendem Agieren und langjährigem Drogenmissbrauch gekennzeichnet war. Sie interpretiert dies als unbewusste Reinszenierungen traumatischer Erfahrungen ihrer Mutter, die diese habe abspalten müssen. Sie selbst sei in einem Zustand „permanenter Verwirrung“ (S. 10) aufgewachsen: Sie wuchs in einer Welt der Musik auf, zu der sie keinerlei Zugang fand. So habe sie sich nie Willkommen gefühlt. Ihre Mutter Anita, die ihre eigene Mutter im Alter von 16 Jahren in der Shoah verlor, habe „auf eine normale Gefühlswelt“ (S. 12) verzichten müssen. Über die Konzentrationslager wurde zu Hause nie gesprochen, diese Gewalterfahrung wollte Anita vor ihren beiden Kindern verbergen. Maya beginnt als Kind mit harmlosen kleinen Diebstählen. Dann durchsucht sie, da ist sie 13, elterliche Fächer und entdeckt eine Mappe mit aufgetürmten Leichen. Sie stellt sich schuldbeladene Fragen, das Schweigen hält an. Die KZ-Nummer ihrer Mutter sieht sie, gesprochen wird hierüber nie. Sie wird Schulschwänzerin, dann beginnt sie, Drogen zu nehmen, gerät bald in eine absolute Abhängigkeit, die familiäre Atmosphäre verdüstert sich. Mit 19 zieht sie aus, legt sich erst einmal ein schwarzes Badezimmer zu. Über ihre jüdische Identität weiß sie nichts. Als Mittzwanzigerin verwahrlost sie zunehmend, lebt nur noch in der Drogenwelt und in einer dazugehörigen Kriminalität, gerät in eine zerstörerische Abhängigkeit zu einem Freund. Entgiftungsversuche scheitern. Ihr vier Jahre älterer Bruder Raphael, gleichfalls ein erfolgreicher Cellist, ist entsetzt als er sie erlebt, versucht sie aus der Drogen- und Verwahrlosungshölle zu befreien. Sie beschreibt ihren lebensbedrohlichen Verwahrlosungsprozess in ungeschminkter, einige Leser vielleicht verstörender Weise. Ihr eigenes Leid stellt sie als Traumatherapeutin in den Kontext des abgewehrten, durchlebten unermesslichen Leids ihrer Mutter Anita und deren Schwester, das diese in Auschwitz und Bergen-Belsen durchleben mussten.
Anfänge der eigenen drogentherapeutischen Ausbildung
Sie beschreibt aus eigener Erfahrung die Arbeitsweise der therapeutischen Einrichtung „Cloud House“, die einigen Patienten zu helfen vermochte; auch sie selbst erlitt mehrfach schwere Rückschläge. Wenig später darf sie mit einer eigenen drogentherapeutischen Ausbildung beginnen, was sie als Rettung erinnert: „Man bot mir den Job tatsächlich an. Ein echter Wendepunkt in meinem Leben.“ (S. 99) Schrittweise gelingt es ihr, immer wieder begleitet durch Rückschläge, sich von ihren Beziehungen, die weiterhin mit der Drogenwelt verbunden sind, zu verabschieden.
Parallel hierzu versucht die Autorin, ihre jüdische Identität, die familiär nahezu keine Bedeutung gehabt hatte, wiederzuentdecken. Sie heiratet 1990 den Sohn eines prominenten Rabbiners, bekommt einen Sohn, führt ihre sucht- und traumatherapeutische Arbeit weiter.
Ihre Mutter Anita versuchte Anfang der 1980er Jahren erstmals, das 40 Jahre zurückliegende durchlebte Grauen aufzuschreiben. Weihnachten 1988, da ist Maya 30 und Anita 63, schenkt sie ihren Kindern ihr mit „Meine Geschichte“ betiteltes, ihren Kindern gewidmetes Manuskript. Hierin schreibt sie ihren Kindern: „Wir haben nie viel über jene dunklen Tage gesprochen und darüber, wieso ihr keine Großeltern habt. (…) Ich habe so viel aufgeschrieben, wie ich konnte, damit ihr das alles „erben“ könnt, sozusagen, und die Erinnerung an jene schreckliche Zeit am Leben erhaltet.“ (S. 161) 40 Jahre nach der Shoah war es ein Versuch, den durchlebten Terror innerlich und innerfamiliär zu erinnern.
Schwur, nie wieder deutschen Boden zu betreten
Nun erinnert sie sich der tiefen Antipathie Anitas gegen die Deutschen, ihrem Schwur nach ihrer Befreiung, nie wieder deutschen Boden zu betreten. 1989, bei einer Reise ihres Orchesters, dann doch ein erster, von tiefen Ängsten begleiteter Besuch Anita Lasker-Wallfischs in Celle und Soltau. Orchestermitglieder, die nichts von ihrer Gefangenschaft in den deutschen Konzentrationslagern wussten, begleiten sie bei ihrem Besuch in dem nahegelegenen Bergen-Belsen.
Es folgen gemeinsame Filmaufnahmen von Anita und Maya Lasker-Wallfisch auch in Bergen-Belsen und Auschwitz, die seelisch anstrengend und mit Enttäuschungen verbunden waren. Für die Autorin, die sich anfangs als Außenstehend empfindet, ist es eine Chance, sich das familiäre Erbe schrittweise auch als eigene Familiengeschichte anzueignen, trotz der immer wieder aufbrechenden Gefühle von Panik und Depressionen: „Ich geriet erst in eine Krise, nachdem wir wieder zu Hause waren“, erinnert sie sich an einen solchen Besuch. „ Meine Mutter ist glücklicherweise robuster als ich. Sie hat nach unserer Rückkehr nach Auschwitz ganz normal weitergemacht. So wie in den vergangenen fünfzig Jahren auch.“ (S. 179) Sie lernt zu verstehen, dass ihre Mutter ihre Erinnerungen an Auschwitz vor allem als Privatheit betrachtet, die nur sie selbst etwas angehen. Nach der Shoah vermochte sie „gewöhnliches Leid“, das für Kinder eine große Bedeutung hat, nicht mehr zu verstehen. Stark sein, Resilienz entwickeln, die zerstörerischen Erinnerungen von sich fern halten, mit der vielfältig beschriebenen Überlebensschuld fertig zu werden – sie benötigte viele Jahre, um diese Kompetenz vieler Überlebender innerlich zu würdigen.
Die Geschichte setzte sich fort: Auch Maya Laskers Sohn Abraham wurde ein sehr talentierte Cellospieler, studierte das Instrument und brach das Studium 2002 von einem auf den anderen Tag unvermittelt ab. Das Cello fasste er danach nicht mehr an.
Die Autorin beschreibt in leicht lesbarer Weise ihre psychoanalytische Ausbildung, die nun ihre neue Identität wird. Die Werke der Kinderanalytikers Donald Winnicotts sprechen sie besonders an. Eine Ausbildungsarbeit betitelt sie mit „Zuhause ist, wo das Herz ist“. Aber selbst ihre eigene Therapeutin vermochte ihr Sprechen über die Shoah nicht anzunehmen: Das sei doch schon so lange her. Das Wissen über transgenerationelle Traumata blieb für die Mehrzahl der Therapeuten ein nicht akzeptierter, seelisch abgewehrter Zugang – nicht nur in Deutschland. Als sie 2014 zu einer Konferenz zum Thema transgenerationelles Trauma eingeladen wird nimmt sie dies als eine große Chance wahr. Es folgen gemeinsame Reisen mit ihrer Mutter zur Shoah Foundation, sogar Konferenzen mit Kindern von Tätern wie auch, nach Erscheinen ihres Buches, gemeinsame Buchvorstellungen. Es gelang ihr, in ihren Worten, „eine eigene Sichtbarkeit“ herauszubilden (S. 241). Mit ziemlichem Pathos bezeichnet sie diese eigene Entwicklung hin zur Autonomie als „so etwas wie eine Erleuchtung“ (S. 242).
Anita Lasker-Wallfisch trat mehrfach mit Niklas Frank, Sohn des Nazi-Generalgouverneurs in Polen, Hans Frank – dieser wurde 1946 nach Schuldspruch hingerichtet – , auf und betonte immer wieder, dass es keine Kollektivschuld gäbe. Verzeihen befördere einen Frieden mit der Vergangenheit. In diesem Sinne sprach sie im Januar 2018 als Zeitzeugin am Holocaust-Gedenktag vor dem Deutschen Bundestag.
Ihr Cousine Michal reiste sogar aus Israel an, um die Briefe ihrer früh verstorbenen Mutter Marianne vorzulesen; ihr Sohn Raphael las die Briefe seines Großvaters. Sogar in Berlin vermochte sie sich nun wohlzufühlen.
Maya Lasker-Wallfisch mit Taylor Downing: Briefe nach Breslau. Meine Geschichte über drei Generationen. Aus dem Englischen von Marieke Heimburger. Suhrkamp / Insel Verlag, 254 S., 24 Euro, Bestellen?