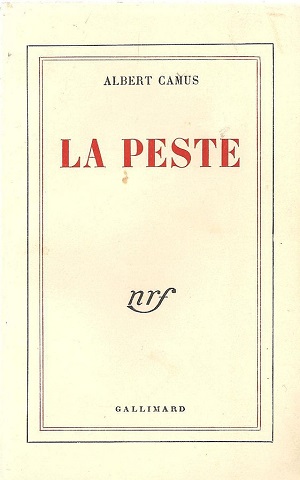Nach einer besonders schwierigen Zeit möchte ich aus einem besonders schwierigen Roman ausgewählte Zitate aufführen (erkennbar an den Anführungszeichen in meinem Text), der im Jahre 1947 erschien – Albert Camus Die Pest. Ich habe ihn immer wieder vermieden. Die Krisenzeit der vergangenen Monate war eine gute Gelegenheit, sich darin zu vertiefen…
Rabbiner Dr. Tom Kučera
Die Parallelen überraschen, möglicherweise treffen sie uns auch. Darum konnte ich nur einige Seiten auf einmal lesen. Ob Albert Camus seinen Roman als eine wirkliche Pandemie oder eher eine symbolische Verseuchung meinte, ist eine ähnliche Diskussion, ob die Hohen Lieder, Schir haSchirim, eine physische Beziehung zwischen zwei Liebenden oder eine symbolische Beziehung zwischen Gott und seinem Volk darstellen. Wie in jedem Konflikt ist die talmudische Weisheit zu zitieren, ele we´elu, sowohl als auch.
Im Roman wird wegen einer Seuche die ganze Stadt gezwungenermaßen abgeriegelt. Wir müssten „nur“ zu Hausebleiben: „Frage: Was tun, um seine Zeit nicht zu verlieren? Antwort: Sie in ihrer ganzen Länge empfinden. Mittel: … den Sonntagnachmittag auf seinem Balkon verleben; sich Vorträge in einer Sprache anhören, die man nicht versteht.“ Ich weiß, es war nicht ganz so lustig. Aber hat man nicht vieles getan, wofür man normalerweise keine Zeit hat? „Das einzige Mittel, um dieser unerträglichen Leere zu entrinnen, war schließlich, die Züge in der Phantasie wieder fahren zu lassen und die Stunden mit dem wiederholten Läuten einer Türklingel auszufüllen, die doch beharrlich stumm blieb. Es war zwar das Exil. Aber das Exil bei sich zu Hause.“ Es stimmt, „dass zu jener Zeit das Getrenntsein das größte Leid war, das allgemeinste und tiefste.“ Wenn uns irgendjemand Ende Dezember 2019 gesagt hätte, was auf uns zukommt, hätten wir es als Wahnsinn verworfen. „… sie dachten, alles sei für sie noch möglich, was voraussetzt, dass Plagen unmöglich sind. Sie machten weiter Geschäfte, sie bereiteten Reisen vor, und sie hatten Meinungen. Wie hätten sie an die Pest denken sollen, die Zukunft, Ortsveränderungen und Diskussionen aufhebt? Sie hielten sich für frei, und niemand wird je frei sein, solange es Plagen gibt.“ Die Viren sind Teil der Schöpfung. Sie bleiben es. Die eingeschränkte Freiheit rief in vielen von uns panische Reaktionen hervor. So sahen wir leere Regale von … Sie wissen schon. „… dass die Pfefferminzpastillen aus den Apotheken verschwunden waren, weil viele Leute sie lutschten, um sich vor einer möglichen Ansteckung zu schützen.“ Half nicht viel. Wie Hydroxychloroquin, das sogar schädlich sein mag. Wir haben vieles eingesehen. „Vom höheren Standpunkt der Pest aus waren der Direktor bis zum letzten Sträfling verurteilt … So musste jeder sich damit abfinden, von einem Tag auf den andern und allein im Angesicht des Himmels zu leben. Diese allgemeine Verlassenheit, die die Charaktere auf die Dauer stählen konnte, machte sie jedoch zunächst einmal oberflächlich. Manche unserer Mitbürger wurden damals zum Beispiel Opfer einer anderen Versklavung, die sie in den Dienst der Sonne und des Regens stellte.“
Dr. Rieux ist eine der Hauptfiguren des Romans. Er war mit einer Immunisierung einigermaßen geschützt. Dies konnten unsere heldenhaften Ärzte/innen, Pfleger/innen und Krankenschwester von sich nicht sagen. „Welche Vorkehrungen man auch traf, irgendwann wurden sie doch angesteckt. Aber wenn man es genau bedenkt, war das Erstaunlichste, dass es während der gesamten Epidemie nie an Männern fehlte, die diese Arbeit taten.“ Darum hat man oft gegen 21.00 Uhr aus den Fenstern geklatscht. „Die Ärzte und Hilfskräfte, die bis zur Erschöpfung arbeiteten, mussten sich nicht noch anstrengendere Leistungen ausdenken. Sie mussten nur weiter regelmäßig, wenn man so sagen darf, diese übermenschliche Arbeit leisten. Die schon aufgetretenen Fälle der Lungenpest nahmen jetzt an allen Enden der Stadt zu, als entzünde und schnüre der Wind Brände in den Brustkörben.“
„Um gegen die Abstraktion zu kämpfen, muss man ihr ein wenig ähneln. … Doch was für die einen Abstraktion war, war für andere die Wahrheit.“ Die Todesrate in Deutschland war im Vergleich mit den anderen Ländern niedriger, dennoch ist jedes verlorene Leben eine Tragödie. Auch die Todeszahlen aus dem Ausland brachen unser Herz jeden Tag. „Ach, wenn es doch ein Erdbeben wäre! Ein ordentlicher Stoß, und damit hat es sich … Man zählt die Toten, die Lebenden, und dann ist die Sache erledigt. Aber diese Saukrankheit! Selbst die, die sie nicht haben, tragen sie im Herzen.“ Kann man überhaupt in einer Krisensituation solche Vergleiche anstellen? „Es gibt immer einen, der noch mehr Gefangener ist als ich – war der Satz, der damals die einzige mögliche Hoffnung zusammenfasste.“ Selbst in Beth Shalom haben wir einige Mal erfahren, was man früher für eine unvorstellbare Romanfiktion erklären würde: „Alle Formalitäten waren vereinfacht und die Totenfeier ganz allgemein abgeschafft worden. Die Kranken starben fern von ihrer Familie, die Totenfeiern waren ganz allgemein abgeschafft worden und die rituellen Totenwachen waren verboten worden. … die Präfektur (zwang) die Angehörigen, von der Zeremonie fernzuhalten. … es fehlte … an Platz auf dem Friedhof. Man musste sich etwas einfallen lassen“. Die Fotos von New York sehen wir noch vor uns.
Dennoch musste sich die Kraft von jedem von uns immer neu erfinden, wie bei Tarrou, der zweitwichtigsten Romanfigur, die sich mit Dr. Rieux befreundet und ihn wesentlich in seiner Arbeit unterstützt: „Es war ein beständiges Wunder. Aber Tarrou blieb trotz der schweren Arbeit, die er leistete, immer wohlwollend und aufmerksam. Sogar wenn er an manchen Abenden vor Müdigkeit eingeschlafen war, fand er am nächsten Tag wieder neue Energie.“ Paneloux, der Geistliche im Roman, benutzte bald nach dem Ausbruch der Pest in seiner Predigt den Text über den Auszug aus Ägypten: „Pharao widersetzt sich den Plänen des Ewigen, und darauf zwingt die Pest ihn auf die Knie. Seit allem Anbeginn der Geschichte wirft die Geißel Gottes die Hoffärtigen und die Verblendeten zu seinen Füßen nieder. Bedenket das und fallt auf die Knie. … Jetzt endlich wisst ihr, dass man zum Wesentlichen kommen muss.“
Auf der einen Seite gab es auch im Judentum Stimmen, die in der Krisensituation die traditionellen Texte für ihre abgefahrenen Moralpredigten missbraucht haben. Auf der anderen Seite: Wollen wir wirklich die Gedanken über das neue Gleichgewicht zwischen dem Menschen und der Natur als Moralpredigten abtun, obwohl sich die Natur so weit vom Menschen erholt hat, dass Schakale in Tel Aviv aufgetaucht sind? Wollen wir als Moralpredigten die ökonomischen Überlegungen abtun, dass wir in der bevorstehenden Zukunft weniger und teurer als viel und billig kaufen werden? „Selbst diese Geißel, die euch quält, erhebt euch und weist euch den Weg.“, sagte Paneloux, der zum Mitarbeiter von Rieux wurde, der dazu bemerkte: „Es freut mich zu erfahren, dass er besser ist als seine Predigt.“ Paneloux änderte sich. Besonders den schmerzvollen Todeskampf eines unschuldigen Kindes hat ihn aus seinen Moralpredigten hinausgeworfen und in seinem Denken kühner gemacht. „Wer konnte denn behaupten, dass eine ewige Wonne einen Augenblick menschlichen Schmerzes ausgleichen kann? … Er ahne wohl, dass man das erschreckende Wort Fatalismus aussprechen werde. Nun, er schrecke nicht vor dem Ausdruck zurück, wenn man ihm erlaubte, das Adjektiv tätig hinzuzufügen.“
Aber die Pest ging eines Tages vorbei, die Tore der Stadt wurden geöffnet, die Menschen jubelten und feierten, „In das schöne, zarte Licht, das auf die Stadt fiel, stiegen die alten Gerüche von gegrilltem Fleisch und Anislikör auf.“ Der für uns schönste Satz, der im Roman schon in der ersten Hälfte vorkommt und dessen Verwirklichung wir noch erhoffen, ist: „Einen Tag später traf der Impfstoff mit dem Flugzeug an.“
Unseren Ausflug in die Welt des Camus Roman „Die Pest“ können wir mit den Worten von Tarrou beenden, die uns zum anfänglichen Fragezeichen nach dem Verhältnis zwischen dem Wirklichen und dem Symbolischen bringen: „ … dass jeder sie in sich trägt, die Pest, weil kein Mensch, nein, kein Mensch auf der Welt von ihr unberührt ist. Und dass man sich ständig überwachen muss, um in einem Moment der Zerstreutheit nicht dazu zu kommen, einem anderen ins Gesicht zu atmen und ihn anzustecken: Die Mikroben sind naturgegeben. Das Übrige, die Gesundheit, die Unversehrtheit, die Reinheit, wenn Sie so wollen, ist eine Frage des Willens, der nie nachlassen darf. … Es ist sehr anstrengend, verpestet zu sein. Aber es ist noch anstrengender, es nicht sein zu wollen. … man (muss) sich weigern, auf Seiten der Plage zu sein.“
Darum sollen wir uns auf die Ferien freuen, auch wenn sie um die Ecke von unserer Wohnung verbracht werden sollten, dann auf unsere Hohen Feiertage Mitte September, auch wenn sie womöglich an einem alternativen Ort verbracht werden sollten. Die Wellen jeder Art kommen und gehen, aber wir bleiben. Ich wünsche uns viel Menuchat haNefesch, Gelassenheit (equanimity, ataraxia), soweit es geht, und bald einen schönen Sommer.
Dr. Tom Kučera ist Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde Beth Shalom in München.