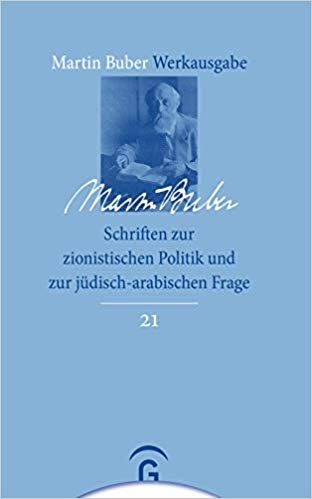Mit Band 21 konnte die im Auftrag der Philosophischen Fakultät der Heinrich Heine Universität Düsseldorf und der Israel Academy of Sciences and Humanities von Paul Mendes-Flohr und Bernd Witte herausgegebene „Martin Buber-Werkausgabe“ (MBW) zum gelungenen Abschluss gebracht werden. Versammelt sind hier in zwei Hauptteilen Bubers umfängliche Schriften zur zionistischen Politik in der Zeit von 1917 (Balfour-Deklaration) bis zu seinem Tode 1965 – seine früheren Artikel sind in MBW Band 3 (2007) nachzulesen – sowie zur Lösung des jüdisch-arabischen Konfliktes…
„Erweckung eines jüdisch-arabischen Solidaritätsbewusstseins und Erschaffung eines Gemeinwesens“[1]
Von Siegbert Wolf
Als libertär-kommunitärer Sozialist verknüpfte Martin Buber seine (sozial-)philosophischen, religiösen, pädagogischen und zeitkritischen Betrachtungen mit einem öffentlich-politischen Engagement. Zugleich gründete sein nonkonformistisches Religionsverständnis auf der festen Überzeugung, dass nicht institutionalisierter Religiösität eine gemeinschafts- und freiheitsbildende Kraft innewohnt.
Politik galt Buber „als die notwendige Gussform, die religiöse Lehren und Empfindungen auf die Probe stellt und ihnen existentielle konkrete Wirklichkeit verleiht. Nur in Bezug gesetzt zur Politik könne das geistige Leben sein Ziel erreichen, nämlich die Überwindung des tückischen Dualismus von Wahrheit und Wirklichkeit, von Ideen und Tatsachen, ja sogar von Moral und Politik“ (Einleitung, S. 15). Allerdings verstand er unter Politik keine an Machtinteressen ausgerichtete, staatsbezogene Realpolitik, sondern eine humanistische „Antipolitik“, also das öffentliche Engagement zur freiheitlichen Restrukturierung der Gesellschaft in der ersten Person. „Antipolitik“, ein Begriff, den Buber von seinem engen Freund, dem Kulturphilosophen, Schriftsteller und Initiator zahlreicher libertärer Projekte Gustav Landauer übernommen hatte, strebt nicht nach politischer Macht, sondern meint soziale Gegenmacht und ist damit ausgeübte Macht der Gesellschaft. Überdies ist Bubers Politikverständnis mit Gemeinschaftsbildung verbunden.
Bezogen auf seinen Kulturzionismus bedeutet dies die Verkündung eines neuen hebräischen Humanismus mit dem Ziel einer geistigen Regeneration und eines grundlegend neuen Gefüges des Zusammenlebens des Judentums, insbesondere in den Kibbuzim in Palästina. Dort, wo Menschen in unmittelbaren Beziehungen zueinander stehen und mit der basisdemokratischen Restrukturierung der Gesellschaft beginnen, „dort ist Gemeinschaft: Menschenverbindungen, Freundschaft, Gemeinde“ (S. 358). Dass der Weg dorthin ein dorniger sein würde, war Buber durchaus bewusst: „In der Wirklichkeit der Geschichte, geht es nicht so zu, dass man sich ein gerechtes Ziel setzt, einen Weg dazu wählt, wie ihn etwa die Gunst der Stunde darbietet, und auf diesem Weg das gesetzte Ziel auch erreicht. Damit das erreichte Ziel dem gesetzten gleiche, muss diesem der Weg in seinem Wesen gleichen. Ein falscher, das heißt: zielwidriger Weg führt zu einem falschen Ziel.“ (S. 140). Indem er die Übereinstimmung von Mittel und Ziel postulierte, konnten für ihn nicht jedes Mittel erlaubt sein, Zion zu errichten. Als oberstes Prinzip gelte, gemäß Jesaja 1,27, Erlösung durch Gerechtigkeit.
Zeit seines Lebens blieb Buber ein eminent öffentlicher Denker, der sich einmischte und dabei auf das Zwischenmenschliche und die dialogische Unmittelbarkeit fokussierte. Generiert werden sollte eine grundlegende innere Erneuerung des Menschen sowie völlig neue soziale, frei vereinbarte Arrangements im Verhältnis der Menschen zueinander. Auch der Zionismus solle „den jüdischen Menschen aufrichten“ (S. 205), zugleich aber über die Renaissance des Judentums hinaus zur globalen Erneuerung der menschlichen Gemeinschaft führen. 1898 hatte sich Buber der im Jahr zuvor gegründeten Zionistischen Weltorganisation angeschlossen und gehörte dort schon bald zur Demokratischen Fraktion, einem Zusammenschluss von Kulturzionisten, der gegen die dominante Richtung Theodor Herzls opponierte. Ihre Ablehnung jeglichen Herrschaftsnationalismus zielte darauf ab, mittels einer „intranationalen Basierung der jüdischen Siedlung in Palästina“ (S. 262) zugleich die „konkreten Beziehungen benachbarter, lebensmäßig aufeinander angewiesener“ Bevölkerungen zu berücksichtigen (ebd.).
Vor allem die Bewältigung der jüdisch-arabischen Frage war für Buber ein zutiefst ethisch-moralisches Anliegen. Dabei stellte er die besondere Beziehung der Juden und Jüdinnen zu Eretz Israel heraus, ohne sich die Forderung nach einem eigenen jüdischen Nationalstaat zu eigen zu machen (S. 125ff.). Überdies nahm er die Ängste vieler AraberInnen, dass ihre nationalen Rechte und ihr Land infolge der Alija verloren gehen könnten, in seine Überlegungen mit auf. Sowohl im 1925 begründeten „Brit Schalom“ („Friedensbund“), in der 1939 konstituierten „Liga für Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Arabern und Juden“ als auch im 1942 errichteten „Ichud“ („Einheit“) engagierte sich Buber für die jüdisch-arabische Verständigung im Rahmen eines binational-föderativen Gemeinwesens sowie einer Konföderation mit den arabischen Nachbarn. Weder ein jüdischer Staat noch ein arabischer Staat seien notwendig, sondern allein ein auf Vertrauen beruhender Vertrag beider Bevölkerungen auf föderativer Grundlage.
Geschaffen werden sollte ein jüdisch-arabisches Palästina mit politischer und bürgerrechtlicher Parität. Die freie Entfaltung der Juden und Araber in Palästina „kann in einem binationalen Gemeinwesen gewährleistet werden, in dem jedes Volk seine spezifischen Angelegenheiten verwaltet und beide miteinander ihre gemeinsamen“ (S. 258). Grundlage sei es, Vertrauen zu generieren, „Vertrauen im Herzen … zu erwecken, politisch und wirtschaftlich“ (S. 313). Dadurch könne Frieden geschaffen werden, „der auf gemeinsames Handeln für das Wohlergehen des Landes“ (S. 148) und seiner BewohnerInnen gegründet ist und auf ein dauerhaftes Bündnis mit den arabischen Menschen in Palästina und in den Nachbarländern abzielt. Nur auf diesem Wege – von dieser Grundüberzeugung wich Buber nicht ab – könne die jüdische Community in Palästina dauerhaft überleben: „Wer Frieden stiftet, so haben unsere Weisen gelehrt, ist ein Werkgenosse Gottes. Aber man stiftet Frieden nicht mit versöhnlichen Worten an die andern und nicht mit menschenfreundlichen Projekten; man stiftet ihn, man hilft, den Weltfrieden zu verwirklichen, indem man selber den Frieden da verwirklicht, wo man dazu berufen und aufgerufen ist: in der Aktivität der eigenen Gemeinschaft, da, wo sie selber ihr Verhältnis zu einer anderen Gemeinschaft aktiv mitzubestimmen vermag. Die Friedensbotschaft der Prophetie an Israel gilt nicht erst für messianische Zeiten; sie gilt für den Tag, wo das Volk neu berufen wird, an der Gestaltung des Schicksals seiner Urheimat teilzunehmen; – sie gilt für heute. Wenn nicht jetzt, wann denn? Die Erfüllung im Dann ist an die Erfüllung im Jetzt … gebunden.“ (S. 140f.).
Nach der Gründung des jüdischen Staates 1948 setzte sich Buber, auch gegen Widerstände, für eine nachhaltige Lösung des arabischen Flüchtlingsproblems und die völlige gesellschaftliche Gleichberechtigung von Juden und Arabern in Israel ein und bewies damit Zivilcourage und einen ,langen Atem‘. Bis an sein Lebensende blieb er davon überzeugt, dass Frieden und Gerechtigkeit im Nahen Osten Einzug halten können. Um eine auf der Unmittelbarkeit menschlicher Beziehungen gestellte friedliche und gerechte Gemeinschaft von Juden und Arabern zu erreichen, bedürfe es der „Zusammenarbeit all jener, die über die Fähigkeit verfügen, Gewohnheiten zu brechen“ (S. 415) und die bereit sind, an diesem Ziel aktiv mitzuwirken: „Wir haben die Wahl, der bestehenden Gesellschaft zu dienen, der Gesellschaft wie sie ist, oder aber der zukünftigen Gesellschaft wie sie sein soll: und noch genauer: Wir haben die Wahl, die Gesellschaft zu bestätigen oder sie auf eine höhere Stufe zu heben“ (S. 400). Wenngleich er Verfehlungen von Entscheidungsträgern auf jüdischer Seite heftiger kritisierte, so forderte er wiederholt auch von der arabischen Community mehr Entgegenkommen und Kooperationsbereitschaft ein: „Die vitale Frage einer planvollen Kooperation in der Erschließung des Landes wurde von keiner der beiden Seiten mit hinreichender Klarheit erörtert oder gar mit der erwünschten Intensität in Angriff genommen“ (S. 256). Dabei vergaß er nie, konkrete Lösungsvorschläge zum gemeinsamen Wohle der jüdischen und arabischen Bevölkerung zu unterbreiten, die er verband „mit der Forderung nach Einführung einer moralischen Spannung oder … einer Richtung, die er für unerlässlich hielt, um die Einsichten herbeizuführen, aus denen jene vernünftigere Politik hervorgehen sollte“ (Einleitung, S. 28).
Wiederholt sah sich Martin Buber, ebenso wie seine kulturzionistisch-binationalen MitstreiterInnen (Henrietta Szold, Gershom Scholem, Hugo S. Bergmann, Robert Weltsch, Ernst Simon und Rabbi Benjamin), dem Vorwurf ausgesetzt, politisch naiven Zielsetzungen und einem übereifrigen Humanismus anzuhängen. Für Buber dagegen hing allein die Gegenseite ideologisch-illusionärer Politik an, die sich nicht an der tatsächlichen Lage und deren Bewältigung orientiere: „Mit den Selbsttäuschungen ein Ende machen! Den Tatsachen ins Auge sehen! Das vorbereiten, was allein die drohende Gefahr zu bannen vermag… Zukunft unseres Volkes bereiten, aber nicht im ,Wolkenkuckucksheimʾ der ,reinenʾ Parolen, sondern auf dieser Erde, mit ihren Widersprüchen, die aber bewältigt werden können“ (S. 186f.).
Noch in seinem zu Anfang des Jahres 1965 erschienenen Artikel „The Time to Try“ (S. 352f.) – zugleich Bubers letzter vor seinem Tode am 13. Juni 1965 publizierter Artikel – wird spürbar, welche nachhaltige Bedeutung er der Lösung des jüdisch-arabischen Konfliktes beimaß. Seine vielfachen Mahnungen an die Konfliktparteien im Nahen Osten endlich zu einer nachhaltigen Kooperation zwischen den arabischen Nationen und Israel im Rahmen einer föderativen bzw. konföderativen Union bei gleichzeitiger nationaler Autonomie zu gelangen, wiederholte er damals ein letztes Mal. Nur ein offen geführter, aufrichtiger Dialog und gegenseitige Anerkennung führe schließlich zu einer dauerhaften Entspannung. Diesen Dialog sollten unabhängige geistige Repräsentanten eröffnen, „die keine Rücksichtnahme daran hindert, vorbehaltlos der richtigen Sache zu dienen. Wenn jetzt und hier ein Dialog zwischen diesem Personenkreis zustande kommt, wird sich seine Wirkung weit über das Gebiet des Nahen Ostens ausbreiten. Damit kann gezeigt werden, ob in der späten Stunde der Geschichte der Geist des Menschen sein Schicksal beeinflussen kann“ (S. 353 – Aus dem Engl., S.W.). Als richtungsweisend erwies sich für Buber dabei das Motto seines libertären Freundes Gustav Landauer: „Frieden ist möglich, weil er notwendig ist.“
Martin Buber Werkausgabe (MBW), Band 21: Schriften zur zionistischen Politik und zur jüdisch-arabischen Frage. Hrsg. u. kommentiert von Samuel Hayim Brody und Paul Mendes-Flohr. Eingeleitet von Paul Mendes-Flohr. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2019, 832 S., 249.- €., ISBN 978-3-579-02697-8.
[1] Martin Buber, Der Weg Israels (Zur Klärung) (1958), MBW 21, S. 341.