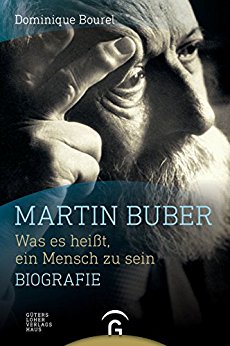Eine neue Martin Buber-Biografie, die Maßstäbe setzt…
Von Siegbert Wolf
Die große Biographie des an der Pariser Sorbonne lehrenden Philosophen und Religionshistorikers Dominique Bourel, der 2004 bereits eine als Standardwerk anerkannte Lebensbeschreibung des deutsch-jüdischen Aufklärungsphilosophen Moses Mendelssohn vorgelegt hat, setzt Maßstäbe in der Buber-Forschung. Mit der zuerst 2015 unter dem Originaltitel „Martin Buber. Sentinelle de l‘humanité“ im Pariser Verlag Albin Michel anlässlich des 50. Todestages Bubers erschienenen, jetzt auch in Deutsch verfügbaren Studie gelingt es dem Autor, die zahlreichen Facetten des vielseitig engagierten, interdisziplinär wirkenden Sozial-, Religions- und Dialogphilosophen Martin Buber (1878 Wien -1965 Jerusalem) vorbildlich zusammenzuführen. Dabei nimmt er auch dessen persönliches und familiäres Umfeld in den Blick: seine zum Judentum konvertierte Ehefrau, die Schriftstellerin Paula Winkler, und die gemeinsamen Kindern Rafael und Eva.
Als einer der „wichtigsten Denker des zwanzigsten Jahrhunderts“ (S. 20) und – etwa neben Sigmund Freud und Albert Einstein – als „einer der bekanntesten Juden“ (S. 14) deutet Bourel Buber als diejenige Persönlichkeit, die, ausgehend von der jüdischen Haskala und von Moses Mendelssohn, dem die „Entstehung der deutsch-jüdischen Passion“ (S. 17) im 18. Jahrhundert zu verdanken ist, „die Vollendung ebenso wie das Ende dieser Passion und vielleicht einen neuen Anfang“ verkörperte (ebd.). Mit großem Respekt würdigte ihn sein Schüler und enger Freund Hugo S. Bergmann als einen „Hüter der Menschlichkeit“ (S. 22).
II.
Martin Bubers Vita umfasst die ausgehenden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts und reicht bis in die Mitte des siebten Jahrzehnts des vorigen Jahrhunderts: geboren in Wien, bei den Großeltern aufgewachsen im galizischen, damals zu Österreich gehörenden Lemberg, Studium der Geisteswissenschaften u.a. in Wien und Berlin, wo er, befreundet mit dem libertären Sozialphilosophen und Schriftsteller Gustav Landauer, bis 1916 lebte. Vor allem Bubers Sozialphilosophie, seine Dialogik und sein Gemeinschaftsdenken verdanken dem gedanklichen Einfluss Landauers viel. Danach zog er in das hessische Heppenheim, bis er und seine Familie aufgrund des Nationalsozialismus 1938 zur Emigration nach Palästina gezwungen wurden. In Jerusalem fand Buber seine letzte Ruhestätte.
Sein lebenslanges Engagement für eine geistige Erneuerung des von grundlegenden Widersprüchen gekennzeichneten, vielfältigen Judentums führte ihn in die von Theodor Herzl begründete Bewegung des modernen Zionismus, den er freilich primär als eine Kulturbewegung bewertete und nicht als politische, auf Eretz Israel ausgerichtete Territorialidee. Bubers Kulturzionismus zielte auf eine Umkehr der damals anwachsenden Distanz zwischen ost- und westeuropäischem Judentum; mittels eines kulturellen Renaissance-Zionismus sollte das Zusammengehörigkeitsgefühl unter Jüdinnen und Juden gestärkt werden. Erst eine selbstbewusste jüdische Gemeinschaft könne ihrer eigentlichen Mission nachkommen und den Prozess einer Erneuerung der gesamten Menschheit vorantreiben. Hierzu widmete sich Buber eingehend der jüdischen Überlieferung, vor allem dem Chassidismus, dessen Botschaften er neu entdeckte und in zahlreichen Nachdichtungen verbreitete: „Die Geschichten des Rabbi Nachman“ (1906), „Die Legende des Baalschem“ (1908) usw. Für Bourel überragt „seine Interpretation des chassidischen Phänomens letztlich alle anderen bei Weitem“ (S. 694). Hiermit und mit seinen „Reden über das Judentum“ (1911), dem „Manifest einer Generation“ (S. 169), geriet Buber bereits vor dem Ersten Weltkrieg „zum Leitstern des deutschen Judentums“ (S. 21).
Noch während des Ersten Weltkrieges gründete Buber die von 1916 bis 1928 erscheinende und bis 1924 von ihm geleitete angesehene Monatsschrift „Der Jude“, ein „Laboratorium des neuen jüdischen Bewusstseins“ (S. 222) und zugleich „ein ausgezeichnetes Röntgenbild des deutschen Judentums“ (S. 229) der damaligen Zeit. Vor allem die Erwachsenenbildung nahm – im Rahmen einer Reformierung des gesamten Bildungs- und Erziehungswesens – einen Großteil in Bubers Denken und öffentlichem Wirken ein. Davon zeugen seine Lehrtätigkeiten am Freien Jüdischen Lehrhaus, an der Universität Frankfurt am Main und an der Hebräischen Universität in Jerusalem.
Die 1920er Jahre gestalteten sich für Martin Buber zu einem überaus produktiven Lebensabschnitt: Neben seinen zahlreichen Lehrverpflichtungen, Buchveröffentlichungen – vor allem sein dialogphilosophisches Hauptwerk „Ich und Du“ (1923) – Übersetzungstätigkeiten sowie die Gründung der dem interkonfessionellen Religionsgespräch verpflichteten Zeitschrift „Die Kreatur“ (1926-1930) begann er 1925 gemeinsam mit dem Philosophen und jüdischen Theologen Franz Rosenzweig mit der „Verdeutschung“ (Buber) der hebräischen Bibel, die Bourel als „einzigartig im ursprünglichen Sinne des Wortes“ (S. 694) würdigt. Damit sollte das deutsche Judentum wieder an den hebräischen Originaltext herangeführt werden, um es auf eine kulturelle Renaissance hin vorzubereiten. 1961, im Alter von dreiundachtzig Jahren, konnte Buber die als „Buber-Rosenzweig-Bibel“ bekannte Neuübersetzung schließlich vollenden.
Infolge der NS-Machtübernahme 1933 verlor Buber seine Honorarprofessur an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Dennoch hielt er bis zur Emigration unbeirrt an seinem Anliegen einer geistige Erneuerung des Judentums fest: So stand er ab Herbst 1933 in Frankfurt am Main dem wiedereröffneten „Freien Jüdischen Lehrhaus“ vor und gehörte zu den Initiatoren des „Kulturbundes Deutscher Juden für Frankfurt am Main und den Rhein-Main-Bezirk“ und der „Mittelstelle für jüdische Erwachsenenbildung“ bei der Reichsvertretung der deutschen Juden, dem damaligen Dachverband des deutschen Judentums.
III.
Die Emigration nach Eretz Israel 1938 ging einher mit einer dauerhaften Trennung vom deutschen Kulturraum. An der Hebräischen Universität in Jerusalem konzentrierte sich Buber sogleich auf seine akademische Lehrtätigkeit als Ordinarius für Sozialphilosophie und Soziologie. Neben seinen wissenschaftlich-publizistischen und pädagogischen Aktivitäten widmete er dem jüdisch-arabischen Konflikt im Nahen Osten wachsende Aufmerksamkeit. Als politisch denkender und handelnder Mensch stellte Buber seine kulturzionistisch-humanistischen Ansichten zu einer friedlichen Koexistenz beider Bevölkerungen heraus. Soziale Regeneration, Ausbau des Kibbuzwesens und Neuzusammensetzung der jüdischen Gemeinschaft ließen sich für ihn ohne einen Modus Vivendi mit den palästinensischen AraberInnen nicht verwirklichen. Im 1925 gegründeten „Friedensbund“ („Brit Schalom“), in der „Liga für jüdische-arabische Verständigung und Zusammenarbeit“ (1939) sowie im „Ichud“ („Vereinigung“) (1942) engagierte er sich anhaltend für ein friedliches, konstruktives Miteinander von PalästinenserInnen und Juden/Jüdinnen in einem binationalen, die Gleichwertigkeit nationaler und bürgerlicher Rechte betonenden Gemeinwesen auf föderativer Grundlage. Infolge der historischen Ereignisse der dreißiger und vierziger Jahre in Europa, vor allem des Machtantritts der Nationalsozialisten, der zur Shoah führte, nahm Buber schließlich die Realität des im Mai 1948 proklamierten Staates Israel hin. Anstelle eines binationalen Palästina favorisierte er seitdem die Idee einer Nahostföderation mit einem internationalisierten Jerusalem. Auch wenn Buber tief in der deutschen Kultur verwurzelt blieb und seine Auswanderung lange Zeit hinausschob, vermochte er nicht in der Diaspora, sondern nur in Palästina ein geistiges jüdisches Zentrum zu erkennen. Dabei galt sein besonderes Interesse den Kibbuzim als freiheitlichen Orten neuer Gemeinschaftsfindung. Palästina als kultureller Mittelpunkt des Judentums bedurfte für Buber nicht unbedingt eines jüdischen Staates. Notwendig hierfür sei es, den Zionismus von seinem europäisch geprägten nationalistischen Zubehör zu befreien. Für ihn betraf die Funktion des Nationalismus allein die Selbstbehauptung des Judentums, um, angesichts einer zweitausendjährigen judenfeindlichen Tradition, aus weitgehend isolierten Individuen eine soziale (und nationale) Einheit zu formen. In deutlicher Distanz zum europäischen Nationalismus und seinem zentralistischen Staatsgefüge setzte Buber auf einen begrenzten, nichtstaatlichen Nationalismus.
Die Zeit nach seiner Emeritierung (1951) nutzte Buber, um auf Kongressen, in Vorträgen und bei öffentlichen Ehrungen – etwa 1953 den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in Frankfurt am Main – für eine dauerhafte Entspannung nicht nur im Nahen Osten, sondern auch des Ost-West-Konfliktes sowie des infolge der Shoah zutiefst gestörten Verhältnisses zwischen Juden und nichtjüdischen Deutschen zu werben.
IV.
Martin Bubers Sozialphilosophie richtete sich stets auf einen freiheitlich-libertären Sozialismus aus. Sein hierin zentraler Gemeinschaftsbegriff umfasst ein Verständnis von Soziabilität, die, ohne äußeren Zwang, sich allein der Freiheit und Freiwilligkeit verbunden fühlt. Nur so sei die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit menschlichen Seins adäquat abzubilden. Die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit inmitten einer lebendigen, dialogischen Gemeinschaft – dies spiegelte Bubers Vision einer „Neuen Gemeinschaft“ wider. Im Zentrum seiner sozialphilosophischen Betrachtungen standen also stets sowohl der Einzelmensch als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen: „Der wahre Ort der Verwirklichung ist die Gemeinschaft…“ (Martin Buber, Der Heilige Weg. Ein Wort an die Juden und an die Völker. Dem Freunde Gustav Landauer aufs Grab [1919]).
Deutlich wird hier Martin Bubers tiefe Verbundenheit mit dem libertären Sozialismus Gustav Landauers. In seinem – neben „Ich und Du“ – zweiten Hauptwerk „Pfade in Utopia“ (dt. 1950) bemühte er sich um eine philosophische Annäherung an den Anarchismus. Diesen Begriff wandte er allerdings nicht direkt auf seine Sozialphilosophie an, weil der Anarchismus die Aufhebung des Zentralstaates und sämtlicher Herrschaftsverhältnisse anstrebt. Hieran aber konnte er aufgrund persönlicher Erfahrungen mit totalitären Ideologien und Bewegungen im 20. Jahrhundert nicht so recht glauben. Gleichwohl erstrebte auch Buber eine weitreichende Reduzierung nationalstaatlicher Kompetenzen und eine Aufhebung der Herrschaft von Menschen über Menschen. Einzig eine restrukturierte, föderative Gesellschaft könne das Erbe des (Zentral-)Staates antreten.
V.
Kernstück von Martin Bubers Sozialphilosophie ist seine Dialogik. Neben der jüdischen und christlichen Mystik maß er vor allem der hebräischen Bibel sowie dem Fundus der Sprachphilosophie als Quelle seiner Dialogik eine zentrale Bedeutung zu. Richtungsweisend für seine Dialogik, dessen erste Ansätze sich bereits in dem 1913 erschienenen Werk „Daniel. Gespräche von der Verwirklichung“ wiederfinden, blieb das „Zwischenmenschliche“, die vor allem durch Sprache vermittelte zwischenmenschliche Interaktion. Sein Interesse galt hierbei sowohl dem „Ich“ als auch dem „Ich“ in Beziehung zu anderen Personen. Erst lebendige und soziale, auf Gemeinschaftlichkeit angelegte Beziehungen ermöglichen ein freies und wechselseitiges Verhältnis zwischen „Ich“ und „Du“ – worunter er auch die Interaktion zwischen dem menschlichen „Ich“ und dem göttlichen „Du“ verstand.
Somit dechiffriert sich Bubers Dialogik auf der Grundlage der schrecklichen Erfahrungen mit Nationalsozialismus und Stalinismus als ein Plädoyer zur umfassenden Erneuerung der kommunikativen Unmittelbarkeit zwischen den Menschen. Sein Beharren auf dialogischen Beziehungen verdeutlichte er nochmals grundlegend in dem unmittelbar vor seinem Tod vorbereiteten Buch „Nachlese“ (1965): „Sodann aber verlangt es einen Mal um Mal, seinem Mitmenschen zu danken, selbst wenn er nichts Besonderes für einen getan hat. Wofür denn? Dafür, dass er mir, wenn er mir begegnete, wirklich begegnet ist; dass er die Augen auftat und mich mit keinem anderen verwechselte; dass er die Ohren auftat und zuverlässig vernahm, was ich ihm zu sagen hatte; ja, dass er das auftat, was ich recht eigentlich anredete, das wohlverschlossene Herz.“ (S. 254)
VI.
Martin Bubers Werk in seiner Gesamtheit zu erfassen erweist sich bis heute als eine Herausforderung. Zusammen hängt dies vor allem damit, dass er aus Überzeugung kein umfassendes philosophisches Gedankengebäude errichtet hat: „Ich habe keine Lehre. Ich zeige nur etwas. Ich zeige Wirklichkeit, ich zeige etwas an der Wirklichkeit, was nicht oder nur zu wenig gesehen worden ist… – ich habe keine Lehre, aber ich führe ein Gespräch.“ (Aus einer philosophischen Rechenschaft [1961]). Gleichwohl hat sich sein Denken keineswegs ohne vorhergehende präzise Fragestellungen entwickelt. Das beachtliche Spektrum seiner vielfältigen Unternehmungen – „Verdeutschung“ der Bibel, Bibelexegese, die intensive Beschäftigung mit Geschichte und Gegenwart des Judentums (Chassidismus, Assimilation, Zionismus), Betrachtungen über Philosophie und Pädagogik sowie als Romancier („Gog und Magog“, dt. 1949) – belegt vielmehr die Sorgfältigkeit seiner Themenauswahl. Das Besondere an der Person Martin Bubers liegt wohl darin, dass er seine philosophischen Überlegungen stets in einen engen Zusammenhang mit seinem öffentlichen Engagement stellte. Beide Bereiche, Denken und öffentliches, politisches Handeln, würdigte er als gleichwertige dialogische Grundelemente.
VII.
Dominique Bourels faszinierende Lebensbeschreibung eröffnet zugleich ein Panorama des 20. Jahrhunderts mit dem singulären Massenverbrechen der Shoah im Zentrum. Zugleich ist ihm, ohne die von Deutschen zu verantwortende Shoah zu vergessen, darin zuzustimmen, dass „uns die Persönlichkeit und das Werk Martin Bubers […] mehr denn je lehren, dass sich die Geschichte der Juden und des Judentums nicht auf die Geschichte des Antisemitismus beschränkt“ (S. 698). Diese mit annähernd 1.000 Seiten umfängliche, flüssig geschriebene und gut lesbare Biographie – hervorzuheben ist auch die gelungene Übersetzungsarbeit von Horst Brühmann – wird sicherlich für lange Zeit als das Standardwerk der Buber-Forschung gelten. Zu wünschen ist ihr eine breite Leserschaft und öffentliche Rezeption.
Dominique Bourel, Martin Buber. Was es heißt, ein Mensch zu sein. Biografie. Aus dem Französischen übersetzt von Horst Brühmann. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 2017. Geb. mit Schutzumschlag, 976 Seiten, € 49,99, Bestellen?