Agnes Kalina im Gespräch…
Agnes Kalina (geb. Farkašová) kam am 15. Juli 1924 in Košice zur Welt und wuchs in Prešov auf. Sie musste das Gymnasium nach der sechsten Klasse abbrechen, weil „Nichtariern“ der Besuch von Mittel- und Hochschule verboten wurde. Im Frühling 1942 floh sie vor den Deportationen nach Ungarn. Sie versteckte sich in Budapest im Kloster vom Guten Hirten. Ihre Eltern kamen im Konzentrationslager um.
Nach dem Krieg kehrte sie nach Prešov zurück, wo sie die Reifeprüfung ablegte. Danach zog sie nach Bratislava und schrieb sich an der Philosophischen Fakultät der Comenius-Universität ein. 1946 heiratete sie Ladislav Ján Kalina. Sie verfasste erste Filmkritiken, Reportagen und Übersetzungen aus dem Französischen, vor allem für das Radio. Das Studium schloss sie nicht ab, sondern arbeitete als Redakteurin bei der Wochenzeitung Nové slovo (Neues Wort) und danach für die Kulturzeitschrift Kultúrny život (Kulturleben). Als Kulturpublizistin spezialisierte sie sich auf den Film, außerdem übersetzte sie aus dem Ungarischen, Deutschen und Französischen. Anfang 1970 wurde sie aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen. Danach durfte sie nicht mehr publizieren und übersetzen.
1972 wurden sie und ihr Mann verhaftet und unter dem Verdacht der „Aufwiegelung“ in Untersuchungshaft genommen. Nach neun Wochen wurde sie aus Mangel an Beweisen freigelassen. Ihr Mann wurde zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Wegen des Drucks durch das politische Regime beantragte sie gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter Julia die Ausreise und zog mit ihrer Familie 1978 nach München. Bis 1995 arbeitete sie als Redakteurin für das tschechische und slowakische Programm bei Radio Free Europe. Sie verstarb am 18. September 2014 in München.
Jana Juráňová (1957) studierte Russisch und Englisch an der Comenius-Universität in Bratislava. Sie übersetzte mehrere Werke aus dem Russischen und Englischen, war Theaterdramaturgin, Redakteurin der Kulturzeitschrift Slovenské pohľady (Slowakische Ansichten) und Redakteurin bei Radio Free Europe. Sie ist Mitbegründerin der feministischen Organisation ASPEKT und verfasst publizistische Texte, Prosa für Erwachsene und Kinder sowie Theaterstücke.
Das Buch gibt das intensive und intime Gespräch der beiden Frauen wieder, die sich seit Anfang der 1990er Jahre kennen. Aufgezeichnet wurde es während mehrerer Besuche von Jana Juráňová im Sommer 2011 bei Agnes Kalina in München, die von Kindheit und Jugend, von Krieg, Deportation und Rückkehr, von ihrer Zeit in Bratislava, der Verhaftung, Emigration und dem Leben in München erzählte. Wer sich darauf einlässt und in Agnes Kalinas faszinierenden Lebenslauf eintaucht, wird „eine nachdrückliche und fesselnde „Nachhilfe“ in der Geschichte des 20. Jahrhunderts“ bekommen, wie Jana Juráňová es treffend formuliert.
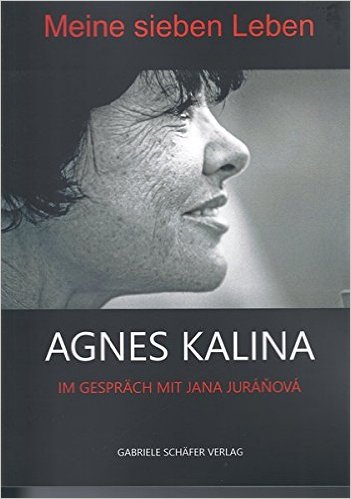 Meine sieben Leben. Agnes Kalina im Gespräch mit Jana Juránova. Aus dem Slowakischen übersetzt von Simon Gruber und Andrea Reynolds, Gabriele Schäfer Verlag 2016, 434 S., 56 s/w Fotos, Bestellen?
Meine sieben Leben. Agnes Kalina im Gespräch mit Jana Juránova. Aus dem Slowakischen übersetzt von Simon Gruber und Andrea Reynolds, Gabriele Schäfer Verlag 2016, 434 S., 56 s/w Fotos, Bestellen?
LESEPROBE
Aus dem Kapitel Normalisierung – Emiration: 1969-1978, S. 276,
nach der Verhaftung von Agnes Kalina
„Wie hast du dich gefühlt?
Am schlimmsten war es abends, wenn ich mich hinlegen musste und versuchte, einzuschlafen. Dann stürzte alles auf mich ein, die Verzweiflung und die Wut. Ich war überzeugt, dass man mich verurteilen würde und ich in ein Frauengefängnis außerhalb Bratislavas kommen würde. Das war eine schreckliche Vorstellung. Zugleich redete ich mir zu, dass ich doch nichts Gesetzwidriges getan hatte. Da packte mich der Zorn wegen der Erniedrigung und der Kränkungen.
Wie sah dein Tagesablauf aus, abgesehen von den Verhören?
Ich las dort sehr viel. Von Zeit zu Zeit zogen Häftlinge, die für diesen Hilfsdienst eingeteilt waren, ein Wägelchen durch den Gang, sammelten die gelesenen Bücher ein und warfen neue durch das Fensterchen. Wir baten um dicke Bücher, um lang mit dem Lesefutter auszukommen, bloß nicht Kinderbücher. Sie verteilten nämlich mit Vorliebe Märchen, das mochten die Häftlinge angeblich am liebsten. Damals las ich ein paar gute Bücher, an eines erinnere ich mich noch: Grande Sertão, eine Geschichte über brasilianische Räuber und Outlaws. Der Autor João Rosa gehörte, wie ich später herausfand, zu den Wegbereitern des fantastischen Realismus in der südamerikanischen Literatur. In diesem Buch wiederholt sich ein seltsamer Refrain: Es ist extrem gefährlich, wenn man lebt. Das passte gut zu meiner Situation. Wenn wir die Bücher untereinander ausgetauscht und durchgelesen hatten und keine neuen bekamen, zog sich die Zeit unerträglich in die Länge, trostlos.
Zuweilen führte man uns für einen Spaziergang in den Innenhof. Die Hände mussten wir hinter dem Rücken verschränkt halten. Ein Aufseher saß oben und schrie auf uns ein. Wir gingen zwischen den Mauern des zwei- oder drei-stöckigen Gebäudes im Kreis. Unsere Zelle lag in einem kurzen Gang, in dem es etwa sechs Frauenzellen gab. Wir gingen gemeinsam spazieren. Für diese Frauen handelte es sich um ein gesellschaftliches Ereignis. Sie tauschten Informationen aus: Wer hatte schon seinen Prozess hinter sich, wie lautete das Urteil, wer war freigekommen. Wegen mir mussten meine beiden Mitgefangenen auf dieses bescheidene Vergnügen verzichten, denn wir durften nur zu dritt auf den Hof. Außer mir bekamen die beiden keine Menschenseele zu Gesicht. Mit tat es leid, dass sie meinetwegen nicht mit den anderen auf den Hof durften, daher versuchte ich, sie dafür zu entschädigen. Ich unterhielt sie, indem ich ihnen erzählte, welchen Typen ich auf dem Weg zum Verhör begegnet war. Ich hatte schon gelernt, sie aus den Augenwinkeln wahrzunehmen, wenn ich mit dem Gesicht zur Wand stand. Laco erblickte ich kein einziges Mal. Sie gaben wohl Acht, wenn sie ihn durch die Gänge führten.
Aus Langeweile dachten wir uns Unsinn aus. Um das runde Guckloch in der Tür zeichnete ich mit Kreide ein Dreieck und schrieb darüber: „Auge Gottes“. Während wir den Spaziergang absolvierten, wischten es die Wärter weg, dann zeichnete ich es neu. Das waren Kindereien, aber ich fühlte mich besser, wenn ich mir so etwas erlaubte. Die Ältere, die „Schmarotzerin“, bat mich: „Tun Sie das nicht, die werden ungut zu uns sein.“ Sie hatte damals ihre Strafe schon abgesessen und wartete auf ihre Entlassung. Als es endlich so weit war, wurden ihr die Häftlingskleider abgenommen und ihre eigenen Sachen gebracht, aber nur die Unterwäsche — ein Höschen und ein dünnes Unterkleid, In der Zelle war es überhaupt nicht warm und die Frau musste dort den halben Tag in Strümpfen und Unterkleid dasitzen, einfach eine Erniedrigung. Die Kleider brachten sie ihr erst in letzter Minute. Es war abstoßend.
Warst du mit Julia in Kontakt?
Julia konnte mir, soweit ich mich erinnere, schreiben, und sie schickte mir auch Fotos. Aber ich brachte es nicht über mich, die Fotos dort aufzustellen. Manchmal ist es einem einfach zu viel, man kann nicht ständig diesen Verlust vor Augen haben.
Wann wurdest du entlassen ?
Eines Tages kamen die Wärter und führten mich statt zum Verhör in eine Art Lager. Sie brachten mir meine Kleider und erklärten, ich könne mich anziehen und heimgehen. Das war am Karfreitag. Ich besaß noch die Frechheit, und vor allem war ich so zornig, dass ich darauf bestand, mit dem Gefangnisdirek tor zu sprechen. Tatsächlich brachten sie mich zu ihm.
Ich hatte vier Punkte vorzubringen: Ich protestierte, dass man hier die eigenen Vorschriften nicht einhielt, denn ich hatte ein Recht auf die Zivilkleidung, wie aus der Gefängnisordnung hervorging, die in der Zelle aushing. Außerdem fragte ich, warum man die Gefangenen zwinge, auf dem Hof die Arme hinter dem Rücken zu verschränken, so konnte man ja weder die Körperhaltung verbessern noch normal die frische Luft einatmen. Aus dem Hof konnte man ja nicht entfliehen. Dann warf ich ihm vor, dass es eine Verhöhnung und Erniedrigung der Frauen sei, dass man die Wärter um die Damenbinden bitten musste und diese sich zierten und nur wenige brachten. Zu guter Letzt sagte ich ihm, es habe mich verärgert zu sehen, wie jene ältere Frau stundenlang im Unterkleid herumsitzen musste. Statt nach Hause zu eilen, um Julia zu sehen, machte ich meinem Arger Luft. Aber es tat mir gut.
Was sagte er dazu?
Nichts. Er hörte mich an, bewegte ein wenig den Kopf und starrte mich an. Alles in allem sagte er gar nichts, irgendetwas murmelte er über die Vorschriften. Aber ich musste das loswerden. Ich wollte diesen Ort erhobenen Hauptes verlassen.
Die Briefe, die mir Julia geschrieben hatte, wurden offensichtlich zensuriert, geschwärzt. Als ich entlassen wurde, drückten sie mir noch einen weiteren Brief von Julia in die Hand, sowie eine Postkarte von den Ličkos, die mir schrieben, dass sie zu Ostern an mich denken würden. Ansonsten gelang es keinem Außenstehenden, mir zu schreiben, daher verstand ich, dass Postkarten nicht auffielen und wohl auch nicht zensuriert wurden.
Als ich das große Gefängnistor durchschritt und auf den Hof des Justizpalasts trat, stand dort gerade ein Müllauto, aus dem die Müullmänner ausstiegen. Sie winkten mir lächelnd zu. Ich winkte zurück und lächelte sie glücklich an. Sie waren die ersten, die mich in Empfang nahmen. Sie waren so herzlich – wahrscheinlich dachten sie, da kommt gerade eine Schmarotzerin aus dem Knast. Das war unerwartet und lustig.“





