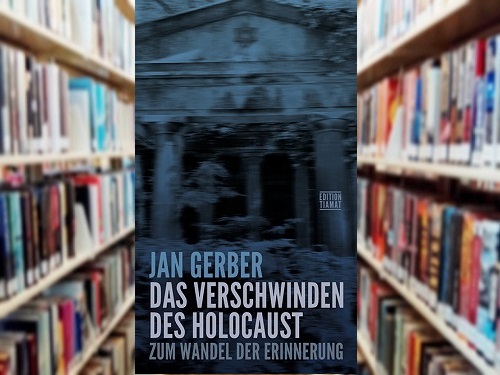Erst spät setzte eine öffentliche Erinnerung an den Holocaust ein, welche aber schon wieder im Verschwinden ist. Dieser Entwicklung geht in einem langen Essay Jan Gerber nach. Das Buch macht auf viele Bedingungsfaktoren und Kontexte aufmerksam.
Von Armin Pfahl-Traughber
Angesichts der Grausamkeit des Holocaust könnte man davon ausgehen, dass die Erinnerung daran kontinuierlich im öffentlichen Gedächtnis vorhanden war. Doch der historische Blick auf dieses Interesse bestätigt diese Vermutung nicht. Eher muss von einem späten Anstieg der Aufmerksamkeit gefolgt von einem jüngeren Rückgang ausgegangen werden. Dabei kam und kommt gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen große Relevanz zu. Diese Einsicht vermittelt Jan Gerber, Historiker und Politikwissenschaftler, in einer neuen Monographie: „Das Verschwinden des Holocaust. Zum Wandel der Erinnerung“. Damit will der Autor den Gründen für die gemeinten Tendenzen nachgehen. Gleich zu Beginn formuliert er folgendes Erkenntnisinteresse: „Warum wurde der Holocaust erst vergleichsweise spät, seit den Siebzigern als Kernereignis des Nationalsozialismus begriffen? Weshalb schwindet dieses Wissen seit einigen Jahren wieder? Was sind also die Bedingungen von Erkenntnis über den Holocaust? Darum kreist dieser Essay“ (S. 8).
Die Ankündigung, hier eben einen Essay liefern zu wollen, ist für die Kommentierung wichtig. Er habe diese „Gattung“ bewusst gewählt, schreibt Gerber, dem es eben nicht um eine historische Gesamtdarstellung geht. Es heißt diesbezüglich: „Ein Essay steht nicht für Vollständigkeit, eine makellose Bibliografie und endgültige Antworten, sondern für eine Suchbewegung“ (S. 9). Diese Ausführungen nehmen auch potentieller Kritik, die durchaus berechtigt hinsichtlich der genannten Ansprüche wäre, den Stoff und die Zuordnung. Denn man kann auch Breite und Kategorisierungen ebenso wie Systematisierungen und Zuspitzungen vermissen. Streicht man diesbezüglich Ansprüche in der Erwartungshaltung, dann hat man es gleichwohl in der Bilanz mit einem erkenntnisförderlichen Buch zu tun, das zu weiterführenden Forschungen und Reflexionen einlädt. Dabei liefert Gerber auch wichtige Kritik, selbst zu Gesichtspunkten außerhalb des eigentlichen Themenrahmens. Als Beispiel sei auf die Einwände gegen das „Orientalismus“-Konzepts von Edward Said verwiesen.
Doch zurück zum eigentlichen Ausgangspunkt und Kern seiner Reflexionen: Deutlich macht der Autor zu Beginn schon, dass es bereits früh über den Holocaust ein öffentliches Wissen gab. Er betont dessen Besonderheiten, etwa die „vollendete Sinn- und Zwecklosigkeit“ (S. 49). Solche Auffassungen können schnell missverstanden werden, Gerber meint dies aber nicht so. Er stellt auf die „Vernichtung um der Vernichtung“ (S. 59) willen ab. Dabei knüpft der Autor häufig an die Deutungen aus der Kritischen Theorie an, insbesondere Adorno und Horkheimer kommen als Referenzquellen häufiger vor. Darüber hinaus wird auf historisch-politische Zusammenhänge verwiesen. Angesichts des Kalten Krieges orientierte man sich in Ost und West thematisch anders. Eine breitere Erinnerung gab es noch nicht einmal in Israel, wo Fragen der Staatsetablierung entscheidender waren. Allein diese Besonderheiten und Kontexte verdienen besondere Wahrnehmung, bezüglich der Deutungen bedarf es aber auch breiter angelegter Forschung. Auch dazu erhält man viele Anregungen von Gerber.
Er macht für die spätere Aufmerksamkeit dann auf Faktoren wie den „Abschied von Helden“ und den Bedeutungswandel der Sozialfigur des Opfers“ (S. 201) aufmerksam. Der „erste Historikerstreit“ kommt indessen kaum vor, dafür aber der „zweite Historikerstreit“ intensiver. Bereits früh verweist der Autor auf die Holocaustrelativierungen, die mit dem Diskurs des „Postkolonialen“ einhergingen. So lassen sich bestimmte Entwicklungen, die in der Gegenwart nicht von rechts, sondern von links kommen, im ideengeschichtlichen Kontext viel besser verstehen. Nicht nur in dieser Aufarbeitung besteht bei Gerber eine besondere intellektuelle Leistung. Gleiches gilt für die Ambivalenzen der Erinnerung. So heißt es etwa: „Im Zuge der Universalisierung der Holocausterinnerung bildete sich kein allgemeines Bewusstsein von der Besonderheit der Tat und der jüdischen Erfahrung heraus. Im Gegenteil, die jüdischen Opfer des Holocaust wurden dem Allgemeinen geopfert, der Menschheit nämlich“ (S 248). Das Buch ist voll von solchen kritischen Erkenntnissen.
Jan Gerber, Das Verschwinden des Holocaust. Zum Wandel der Erinnerung, Berlin 2025 (Edition Tiamat), 331 S, 28 Euro, Bestellen?