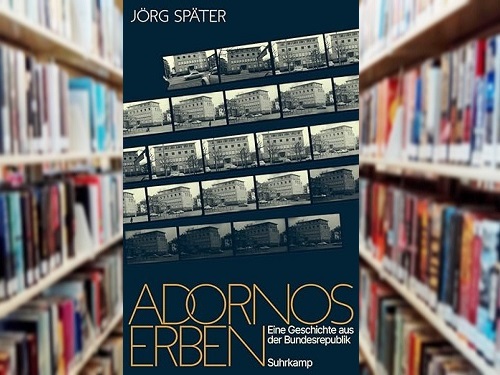Jörg Späters Buch „Adornos Erben. Eine Geschichte der Bundesrepublik“ erzählt von der Suche nach dem Besseren
Von Karl-Josef Müller
Zuerst erschienen bei: Literaturkritik.de
Theodor W. Adorno: Zum Klassizismus von Goethes Iphigenie
Wie hätte Theodor W. Adorno auf den sogenannten Historikerstreit 1986 reagiert? Aber wäre dieser überhaupt vorstellbar gewesen zu Lebzeiten eines Intellektuellen, für den die Zeit nicht länger in eine vor und nach Christi Geburt eingeteilt werden konnte? Seine Frage, „ob nach Auschwitz noch sich leben lasse“, erhebt diesen Ort, polnisch Oświęcim, zum neuen Golgatha.
Wenn ich an die Erfahrungen meines ersten Semesters denke, werden die politischen Selbstverständlichkeiten wieder lebendig, mit denen damals das intellektuelle Bedürfnis nach philosophischer Aufklärung gewissermaßen durchtränkt war: Es musste etwas besser werden, und es lag an uns, ob sich die Welt zum Besseren verändern würde.
So Jürgen Habermas im Gespräch mit Stefan Müller-Doohm und Roman Yos, veröffentlicht bei Suhrkamp unter dem Titel Es musste etwas besser werden…
Adorno hat dieses Vertrauen in die Wirkungsmächtigkeit „philosophischer Aufklärung“ nie geteilt, auch wenn sein Schreiben nichts anderes darstellt als den Versuch, der Vernunft gegen die Barbarei eine Chance zu geben.
1986 wäre Theodor W. Adorno dreiundachtzig Jahre alt gewesen; Habermas, 1929 geboren, gilt, wie einst Adorno, als eine der wichtigsten intellektuellen Stimmen unseres Landes. Mit Adornos Tod drohte das traumatische Erbe Auschwitz‘ innerhalb der Frankfurter Schule in Vergessenheit zu geraten.
Nicht so bei Jörg Später. Diese Geschichte aus der Bundesrepublik ist auch eine der Bundesrepublik, und eine Geschichte ist sie nicht so sehr im Sinne eines historischen Werkes, sondern eher in dem einer Erzählung. Einer Erzählung auch, der man gerne folgt, weil Später eher journalistisch denn wissenschaftlich schreibt. Und mit einer Prise Humor, so etwa, wenn er über die Rezeption von Alexander Kluges Film In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod aus dem Jahr 1974 Folgendes zu berichten weiß:
Außerhalb Frankfurts interessierte sich hingegen bloß „Das kleine Fernsehspiel“ des ZDF für das verkopfte Werk (…). In der Glotze lief der Film zu Uhrzeiten, zu denen nur noch Studenten und die Boheme wach waren.
In seiner Einleitung schildert Später die Beerdigung Adornos am 13. August 1969; und bevor das Schlusskapitel die Geschichte der Frankfurter Schule konzise zusammenfasst, führt der Autor unter der Überschrift „Die Rückkehr der NS-Geschichte“ nochmals die grundlegende Bedeutung der Shoa für die Gründerväter der Frankfurter Schule vor Augen. Lange Zeit war die alte wie die neue Linke der Ansicht, der Faschismus, und damit auch der Nationalsozialismus, seien ohne den Kapitalismus nicht denk- und erklärbar:
Denn das war der blinde Fleck der sich auf Marx stützenden Gesellschaftsanalyse: dass sie dem Faktum der Vernichtung der europäischen Juden nicht gerecht werden konnte.
Paradigmatisch für die Haltung vieler Linker ist die Einsicht des Politikwissenschaftlers Alfons Söllner, den Später aus einem Leserbrief zitiert. „[A]uf- und dann immer wieder abgedämmert“, so Söllner, sei ihm
der seltsame Widerspruch (…), daß ich mich seit gut einem Jahrzehnt mit den Schriften von politischen Emigranten herumschlage, ohne daß ich zur Kenntnis genommen hätte, daß es sich ausnahmslos um deutsche Juden handelt, die vor Hitler fliehen mussten.
Er habe an ihnen „nur die intellektuelle und politische Seite wahrgenommen“ und „offensichtlich ihre spezifisch jüdische Identität“ verdrängt.
Immer wieder scheint der eigentliche Nucleus der Frankfurter Schule auf, wenn auch häufig versteckt hinter all den Ereignissen, die Später schildert, um so ein möglichst exaktes Bild der Erben Adornos zu zeichnen. Im Kapitel „Der Erbschaftsstreit“ zitiert der Autor die Literaturwissenschaftlerin und Soziologin Elisabeth Lenk, die im November 1989 auf einer Tagung mit dem Titel „Das unerhört Moderne“ auf den Kurswechsel hinweist, der nach Adornos Tod die Frankfurter Schule in eine vernunftgläubige Richtung lenkt:
Adorno und Habermas repräsentierten für Lenk zwei verschiedene Welten – Habermas würde am liebsten alles auf vernünftig und widerspruchsfrei bügeln, sogar die Ästhetik. Dagegen sei Adorno ein Schriftsteller gewesen, der das Unwägbare geschätzt habe.
Dreizehn Namen, drei davon weiblich, sind auf der Rückseite des voluminösen Werkes verzeichnet. Dreizehn sehr unterschiedliche Karrieren deuten darauf hin, dass von einer Frankfurter Schule im eigentlichen Sinne nicht unbedingt gesprochen werden kann. Was sich aber feststellen lässt: Die Schülerinnen und Schüler dieses Frankfurter Kranzes – wie man, so Später in einer seiner zahlreichen ironischen Anspielungen, die Frankfurter Schule auch hätte nennen können – haben die intellektuelle Geschichte der Bundesrepublik deutlich mitgeprägt. Erinnert sei an die „Hessischen Rahmenrichtlinien für Gesellschaftslehre“ aus dem Jahr 1972, initiiert vom damaligen Kultusminister Ludwig von Friedeburg. Mit ihnen sollte die Schule zu einem Ort werden, von dem aus die Gesellschaft sich zum Besseren würde verändern lassen – und fraglos war dieses Bessere allein auf der linken Seite des politischen Spektrums verortet. Entsprechend heftig wurde um die Rahmenrichtlinien gestritten.
Doch bereits in den Zwanzigerjahren beschlich die führenden Köpfen des Instituts für Sozialforschung der Verdacht, es könne sich die Hoffnung auf eine wahrhaft freie Gesellschaft als bloßer Trug erweisen:
Am Institut erforschte man unter der Leitung von Erich Fromm und Hilde Weiss, warum sich das Proletariat nicht gegen die Klassenherrschaft erhebt, unter der es leidet, und warum der Kapitalismus sich immer wieder reproduzieren kann.
Es scheint nicht weit her zu sein mit dem Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit:
Die Ergebnisse der Forschungen über den autoritären Charakter der Arbeiter und Angestellten waren übrigens so erschütternd, dass Horkheimer und Pollack begannen, über eine Auswanderung in die Schweiz nachzudenken.
The Times They Are a-Changin‘ sang Bob Dylan 1964, und auch dieser Wandel sollte einer zum Besseren werden. Sechs Jahrzehnte später sind die Hoffnungen der Achtundsechziger verflogen; und auch der Wind of Change der Scorpions von 1989 hat sich gedreht, der Zeitgeist huldigt immer bedrohlicher einer so dumpfen wie reaktionären Stimmung. Dem Diktator und Kriegstreiber aus dem Osten wird der rote Teppich ausgerollt, in den USA regiert ein unberechenbarer Egomane, und spätestens seit dem 7. Oktober 2023 können Menschen jüdischer Herkunft sich an kaum einem Ort auf diesem Erdball sicher fühlen. Ja, es müsste etwas besser werden, doch die Verhältnisse sind leider nicht so.
So ist es kein Zufall, dass das vorletzte Kapitel dieses so lesenswerten wie gut lesbaren Buches den Titel trägt „Die Rückkehr der NS-Geschichte und die Neubelebung Kritischer Theorie“. Die Hoffnungen von Jürgen Habermas haben sich nicht erfüllt; die Befürchtungen von Theodor W. Adorno hingegen haben ihre Berechtigung nicht verloren.
Nein, Jörg Später zeichnet kein pessimistisches Bild unserer Gesellschaft. Es scheint eher realistisch, weil der Autor sich nicht blenden lässt vom Geist der Utopien. Wo aber, so fragen wir uns nach der Lektüre, wächst auch das Rettende in diesen Zeiten der Gefahr?
Jörg Später: Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik. Suhrkamp Verlag Berlin 2024, 760 S., 40,00 EUR, Bestellen?