Sollte ein Preis für eine künstlerische/kulturelle Leistung nicht vergeben werden, wenn der Anwärter in der Vergangenheit antisemitische Aussagen getätigt hat? Wo liegt die Grenze? Kommt dies einer „Gesinnungsprüfung“ gleich? Sollte diese „Gesinnungsprüfung“ nur in Bezug auf Antisemitismus angewendet werden? Oder ist sie auch in Bezug auf Rassismus etc. sinnvoll?
Aus der Reihe Antisemitismus ist (k)eine Meinung
Kommentar von Tom Uhlig
Im September 2019 wurde Kamila Shamsie die Verleihung des Nelly-Sachs Preises durch die Jury aberkannt, da die pakistanisch-britische Schriftstellerin BDS unterstütze. Der kulturelle Boykott stehe im Widerspruch zu den Satzungszielen der Vereinigung. Unter einem berichtenden Artikel der Süddeutschen Zeitung fragte ein Kommentator:
„Will er denn damit sagen, dass in Zukunft für die Verleihung von Kunstpreisen eine Gesinnungsprüfung Voraussetzung sein kann? Dann ginge es nicht mehr um den künstlerischen Rang – einen Preis erhält nur, wer die „richtige“ Gesinnung hat. Sollte das zur Haltung der Kunstkritik in der SZ werden?“
Tatsächlich scheint es im Kulturbetrieb selbst einige Schwierigkeiten zu geben, sich so eindeutig zu positionieren, wie die Jury des Nelly-Sachs-Preises. Kritik, die zumeist von außen angebracht wird, trifft hier bisweilen auf erbitterten Widerstand: 2018 wurde ungeachtet massiver Kritik der Echo an die Rapper Kollegah und Farid Bang verliehen, die sich in einem Song über Auschwitz-Häftlinge lustig machten. Die Auszeichnung zog einen Skandal nach sich, dem schließlich die Abschaffung des Preises folgte. Die Kabarettistin Lisa Fitz, die verschwörungsideologische Mythen über Rothschild, Rockefeller usw. kolportiert, wurde 2019 mit dem Bayerischen Vierdienstorden ausgezeichnet. Im selben Jahr erhielt der Karikaturist Dieter Hanitzsch, der sich kurz zuvor mit einer antisemitischen Zeichnung Netanjahus ins Gespräch brachte, von der Ernst-Hoferichter-Stiftung einen Preis für sein Lebenswerk. Die Intendantin der Ruhrtriennale, Stefanie Carp, beharrte nachdrücklich auf ihre Einladung des postkolonialen Philosophen Joseph-Achille Mbembe, selbst nachdem dessen Dämonisierungen Israels breit in der Öffentlichkeit besprochen wurden. Die jüngste Diskussion drehte sich um die österreichische Kabarettistin und Autorin Lisa Eckhart, der antisemitische und rassistische Witze vorgeworfen wurden. In einer Fernsehsendung witzelte Eckhart, die #metoo-Kritiker*innen würden sich in einer Art moralischem Dilemma befinden, wenn Juden wie Harvey Weinstein oder Roman Polanski Frauen sexuell nötigen. Das ganze kulminierte in der Pointe: „Am meisten enttäuscht es von den Juden, da haben wir immer gegen den Vorwurf gewettert, denen ginge es nur ums Geld, und jetzt plötzlich kommt raus, denen geht’s wirklich nicht ums Geld, denen geht’s um die Weiber, und deshalb brauchen sie das Geld.“ Einige Institutionen wie das American Jewish Committee Berlin, die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus oder die Deutsch-Israelische-Gesellschaft verurteilten den Auftritt und es erschienen eine handvoll kritischer Artikel in größeren Tages- und Wochenzeitungen. Die Stimmung änderte sich jedoch als Eckhart kürzlich von einem Literaturfestival wegen angeblich linksradikaler Drohungen – die allerdings vom Veranstalter frei erfunden waren – ausgeladen wurde. Eine Diskussion um antisemitische Flachwitze im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wurde zu einer über Kunstfreiheit. Der Verlauf dieser Debatte – von den ersten Vorwürfen bis zur ihrer teilweisen Rehabilitierung durchs Feuilleton – ist exemplarisch für einen gesellschaftlichen Umgang mit Antisemitismus in künstlerischen Produktionen, der sich mindestens bis zur Fassbinder-Debatte 1985 zurückverfolgen lässt. Im Folgenden sollen drei Elemente der Umgangsweisen mit Antisemitismus im Kulturbetrieb entlang des Falles Lisa Eckhart besprochen werden: erstens die Unterstellung einer Doppelbödigkeit, zweitens die Selbstimmunisierung durch Kunst sowie drittens der Tabubruch.
1. Antisemitismus scheint vielen kein hinreichender Grund zu sein, einem Künstler oder einer Künstlerin Anerkennung zu verwehren. Entgegen kommt diesen Stimmen der Doppelcharakter der Kunst, nicht nur subjektiver Ausdruck der Kunstschaffenden, sondern gleichzeitig der gesellschaftlichen Verhältnisse zu sein. Ein Autor kann ein antisemitisches Bühnenstück schreiben, eine Malerin antisemitische Bildelemente verwenden, und beide können sich darauf berufen, lediglich gesellschaftlich vorhandene Ressentiments dargestellt zu haben oder sich auf andere (bild-)sprachliche Ambivalenzen herausreden. Denn wo Zweideutigkeit unterstellt werden kann– und das kann sie bei Kunst immer –, schlägt sich die Öffentlichkeit gerne auf die Seite der Naivität, die keinen Antisemitismus erkennen möchte und springt er einem auch noch so deutlich ins Gesicht. Erschwert wird diese Interpretation durch das antisemitische Bild selbst, das überhaupt nicht zweideutig sein will. Antisemitische (Bild-)Sprache in der Kunst ist selten abstrakt und damit der Interpretation offen sein, weil sich das antisemitische Ressentiment selbst gegen die Abstraktion richtet und damit auch gegen die Bildsprache der Moderne. Es finden sich keine raffinierten antisemitischen Karikaturen oder Propagandamittel, der Hass wird so ausbuchstabiert, dass auch die Letzten verstehen, was und wer damit gemeint ist, gleichwohl sekundär antisemitische Bilder natürlich mit Chiffren arbeiten, die ein plausibles Abstreiten der Intention oder Wirkweise erlaubt. Der „Jude“ oder der „Zionist“ des antisemitischen Bildes ist böse, weil er blutüberströmt ist, weil er Waffen auf Schutzlose richtet, mit seinen Fangarmen sich alles einverleiben will, mit Insignien des Reichtums und der Macht ausgestattet ist, weil er monströse Gesichtszüge hat, er ist fett, er ist hässlich, er ist pervers. Hintersinn oder Doppelbödigkeit ist dem antisemitischen Bild fremd, weil diese Eigenschaften selbst dem „Juden“ zugeschrieben werden soll. Es klafft jedoch eine Lücke zwischen der Eindeutigkeit antisemitischer Bilder und dem mangelnden öffentlichen Verständnis für ihre Kritik. Als Rainer Werner Fassbinder etwa in seinem Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“ die Figur des „reichen Juden“, der zahlreiche antisemitische Klischees in sich vereint, aufführen wollte, debattierte die Öffentlichkeit ob es sich bei der Darstellung um ein „Fenster“ zur oder einen „Spiegel“ der Gesellschaft handelt. So auch im Falle Lisa Eckharts, deren Verteidiger*innen behaupten, die Kabarettistin habe mit ihrem Auftritt lediglich Antisemitismus demaskieren wollen, wobei in der Performance selbst wenig darauf hindeutet. Natürlich lässt sich Eckharts Bühnencharakter zur unsympathischen Kunstfigur erklären, in der sich die Niedertracht des Publikums spiegeln soll. Da das aber prinzipiell bei jeder Kunst möglich ist, müsste das Einvernehmen mit dem Publikum schon auf die eine oder andere Weise gebrochen werden, was in Eckharts Auftritten aber nicht der Fall ist.
2. Diskussionen um Antisemitismus in künstlerischen Produktionen werden schnell zu welchen über die Freiheit der Kunst, womit der antisemitische Gehalt in den Hintergrund rückt. Als Günter Grass das Gedicht „Was gesagt werden muss“ veröffentlichte, wurde nach einiger Zeit sogar darüber gestritten, ob es sich bei dem antiisraelischen und schuldabwehrantisemitischen Text tatsächlich um ein Gedicht handelt oder die Form das nicht hergibt – als würde sich dadurch der Inhalt verändern. Kunstschaffende oder andere Akteur*innen des Kulturbetriebs streben immer wieder danach, die eigene Arbeit mit dem Verweis auf die künstlerische Freiheit gegen Kritik zu immunisieren. Da vermeintliche oder wirkliche Einschränkungen der Freiheit des Ausdrucks mit dem Selbstverständnis liberaler Gesellschaften kollidieren und Antisemitismus weiterhin vielen als historisch erledigtes Problem gilt, gilt hier schnell die Sympathie den Kritisierten. Vergessen wird dabei, dass Kunst, nur weil sie eben Kunst ist, nicht jenseits der Kritik steht. Es wird geglaubt, Kunst nach rein technischen Aspekten beurteilen zu können, die jenseits des Inhalts stehen. Ein gutgeschriebenes Buch ist nach dieser weitverbreiteten Ansicht auch gutgeschrieben, wenn es antisemitische Ressentiments reproduziert, und verdient deshalb Anerkennung. Dabei sind Machart und Inhalt nicht voneinander zu trennen: Antisemitische Texte können stilistisch auf der Höhe sein, Einsichten aber lediglich simulieren, da sich das Ressentiment vor den Blick auf die Welt schiebt. Erkenntnis und der subjektive Ausdruck werden dadurch überformt, weshalb antisemitische Werke einen technisch-künstlerischen Anspruch behaupten, jedoch nicht einlösen können. Martin Walsers „Tod eines Kritikers“ beansprucht den Literaturbetrieb auseinanderzunehmen, scheitert jedoch aufgrund der Besessenheit, eine antisemitische Karikatur Riech-Ranickis zu denunzieren. Auch Eckharts Performance vermag es nicht, die Widersprüche der #MeToo-Bewegung einzufangen (das wurde vor allem innerhalb Bewegung selbst geleistet), sondern zielt daran vorbei, weil sie offenbar unbedingt auf die antisemitische Pointe hinauswill.
3. Mit dem Verschwinden künstlerischer Hemmungen, etwa im Bereich pornographischer oder exzessiv gewalttätiger Darstellungen, kann Antisemitismus als eine der wenigen Grenzen, deren Überschreitung öffentliche Empörung sicher ist, genutzt werden, um einen mutigen Tabubruch zu inszenieren. Verbote sind unbeliebt, sodass denjenigen, die diese Verbote ignorieren, einige (wohlwollende) Aufmerksamkeit sicher ist, selbst wenn dieses Verbot überhaupt nicht existiert, sondern bloß behauptet wird. Oft ist in Kommentarspalten zu lesen, man solle sich über alle Bevölkerungsgruppen, so also auch die Juden lustig machen, wer über Polizisten lacht, soll das auch über Jüdinnen dürfen usw. Die Argumentation ähnelt der des „reversed racism“ oder „reversed sexism“, wo zugunsten eines formalistischen Gleichheitsverständnisses reale und historische Machtverhältnisse ausgeblendet werden. Ignoriert wird dabei, dass Antisemitismus keine harmlose Spielerei ist, mit der man am Ende gar zu einem „unverkrampften“ Verhältnis zu Jüdinnen und Juden gelangt, sondern mörderische Konsequenzen haben kann.
Kritik am Werk des Künstlers oder Künstlerin wird häufig zur Bestätigung des vermeintlichen Verbots umgedeutet und damit inhaltlich entkernt, ganz gleich, ob die Kritik ein Verbot forderte oder nicht. Insbesondere ist das in der derzeitigen Debatte um „Cancel Culture“ zu beobachten, wenn etwa behauptet wird, Lisa Eckharts Auftritte sollten verhindert werden, obwohl ein solcher Versuch überhaupt nicht stattfand. Der Verdacht, es solle eine Künstlerin oder ein Künstler „mundtot“ gemacht werden, zeitigt den paradoxen Effekt, dass den kritisierten Personen überschwängliche Medienaufmerksamkeit zukommt. Ob hinter dem Tabubruch ein solches Kalkül steht, lässt sich schwerlich rekonstruieren, ist für die Frage des Antisemitismus aber auch unerheblich: Antisemitismus mag einem öffentlichen Konsens widersprechen, ist jedoch gesamtgesellschaftlich weit verbreitet, weshalb die Reproduktion des Ressentiments kaum als mutige Grenzüberschreitung, sondern durchaus im Einklang mit den Verhältnissen erfolgt.
Antisemitismus ist im Kulturbetrieb umso fester verankert als dass die oben genannten Strategien hier die Dethematisierung des Hasses gegen Jüdinnen und Juden erlauben. Die notwendige Unsicherheit, wann Kunst vom eigentlichen ins uneigentliche Sprechen übergeht und umgekehrt, kommt der (Selbst-)Verschleierung entgegen. Demgegenüber gilt es darauf zu beharren, dass die Kritik von Antisemitismus und die Kunstkritik keinen trennbaren Sphären angehören, die Freiheit der Kunst nicht gefährdet ist, wenn ihr antisemitischer Gehalt offengelegt wird, und eine Tabuisierung von Antisemitismus nicht gebrochen, sondern überhaupt erst einmal hergestellt werden sollte.
Zurück also zum eingangs erwähnten Kommentar: Wie kann eine Redaktion darauf reagieren, wenn ein Kommentator in der Zurücknahme eines Preises, das Ende der Kunstfreiheit wittert? Zunächst gibt es kein Menschenrecht auf Preisverleihungen. Wenn Aktionen der Kunstschaffenden inner- und außerhalb ihrer Werke so gravierend erscheinen, dass sie der Auszeichnung nicht würdig sind, ist es ihr gutes Recht, von der Verleihung Abstand zu nehmen. Denjenigen, die darin „Zensur“ am Werk sehen, ist entgegenzuhalten, dass sich die Freiheit vor Zensur auf staatliche Behörden bezieht, denen es untersagt ist, in die künstlerische oder journalistische Freiheit restriktiv einzugreifen. Nicht gemeint ist damit ein Anspruch auf öffentliche Plattformen. Wer Antisemitismus das Wort redet, sollte damit rechnen, von engagierteren Institutionen kein Podium geboten zu bekommen. In Zur Bekämpfung des Antisemitismus heute von 1964 schrieb Adorno: „Den Antisemitismus kann nicht bekämpfen, wer zur Aufklärung zweideutig sich verhält.“ Nun wäre eindeutige Kunst keineswegs wünschenswert und eher Propaganda als Kunst, aber die Reproduktion antisemitischer oder rassistischer Ressentiments sollte darauf reflektieren, dass es sich dabei eben um Ressentiments handelt. Ihre Wiederholung allein genügt nicht, die Wirkungsästhetik muss berücksichtigt werden, will man nicht Gefahr laufen, die Rezipient*innen zu agitieren, zum Beispiel über Juden zu lachen und eben nicht über Antisemiten.
Tom David Uhlig ist Bildungsreferent der Bildungsstätte Anne Frank sowie Mitherausgeber der Zeitschrift für psychoanalytische Sozialpsychologie „Freie Assoziation“ und der „Psychologie & Gesellschaftskritik“. Gemeinsam mit Eva Berendsen und Katharina Rhein veröffentlichte er zuletzt „Extrem Unbrauchbar. Über Gleichsetzungen von links und rechts“ (2019, Verbrecher Verlag).
Die Leserbriefe:
„Ich kenne weder Kamila Shamsie noch Walid Raad, gehe aber doch davon aus, dass ihnen die Preise in Dortmund beziehungsweise Aachen als Anerkennung für ihre künstlerischen Leistungen verliehen worden sind. Wenn nun diese Urteile der einschlägigen Kommissionen mit Hinweis auf die Gesinnung der Künstler liquidiert werden, ist das ein Skandal, zu dem ich klare Worte erwartet hätte. Stephans Urteil, die preisverleihenden Städte hätten „in dieser Sache zwangsläufig Stellung“ beziehen müssen, ist zumindest gedankenlos. Will er denn damit sagen, dass in Zukunft für die Verleihung von Kunstpreisen eine Gesinnungsprüfung Voraussetzung sein kann? Dann ginge es nicht mehr um den künstlerischen Rang – einen Preis erhält nur, wer die „richtige“ Gesinnung hat. Sollte das zur Haltung der Kunstkritik in der SZ werden?
(Süddeutsche Zeitung, 14.10.2019)
Sie schreiben groß, „Die Debatte um Achille Mbembe schadet Deutschland, denn die Erinnerungskultur braucht andere Perspektiven.“ Na, welche denn? Ich vermisse die Ansätze dazu. Es ist eine kleine, verdrehte Welt, wenn ein afrikanischer Historiker und Politikwissenschaftler sich zu einem freien Wort entscheidet und feststellt: „Ich respektiere die deutschen Tabus, aber es sind nicht die Tabus aller Menschen auf der Welt.“ Was sollte daran falsch sein und immerzu den Schlenker zum Antisemitismus rechtfertigen? Warum kann in Deutschland nicht, nach diesen unsäglichen Geschehnissen, offen auch die „Besatzungsmacht Israel“ mit allen logischen Denkansätzen kritisiert werden, ohne dass der Hammer „Antisemitismus“ hervorgeholt wird!?
(Süddeutsche Zeitung, 27.05.2020)
Logo Design von BMU ADVERTISING, Alexander Waldmann



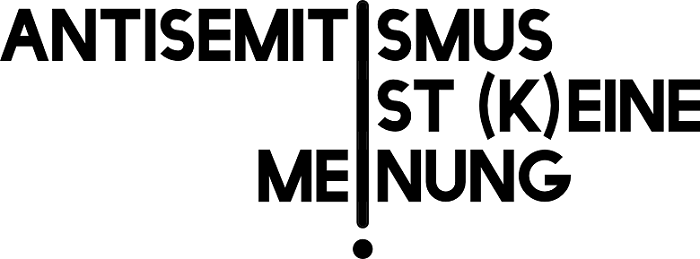


Zur Frage fehlt mir ein Tempus, sodass ich mir erlaube diese Fallunterscheidung vorzunehmen. So wird die Eingangsfrage, „Sind antisemitische Äußerungen eine Rechtfertigung, einen Preis nicht zu verleihen?“ von mir mit Ja und Nein beantwortet.
Nein wenn es sich um antisemitische Verfehlungen handelt, die aufrichtig bereut und aufgearbeitet wurden. Hierbei sind aktive Sühne, bzw. Wiedergutmachung gefordert, deren Wirkung in jedem Fall nur von den Verunglimpften selbst bestimmt werden können.
Mit ja, wenn der im oberen Absatz geschilderte Prozess nicht stattgefunden hat. Die Kunst in diesem Zusammenhang als Freiheit höherer Ordnung zu missbrauchen, würde bedeuten deren Skalierung über das Recht auf Leben zu stellen. Allein bereits eine solche Art der Deutung in Erwägung zu ziehen, zeigt die absolute Richtigkeit des salzbornschens Postulat; Hochhuth lässt grüßen. Hierbei von Gesinnung zu sprechen ist nicht ganz so verkehrt wie es zunächst scheint, jedoch sollte jedem klar sein, dass diese sich aus dem gleichen Quell speist wie die der Geschichtsrevisionisten.
Kommentarfunktion ist geschlossen.