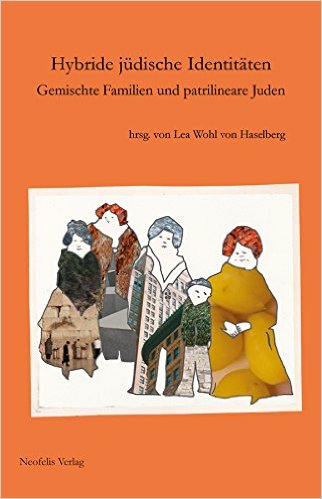Viele Jüdinnen und Juden lieben nichtjüdische Partner_innen, leben und haben Kinder mit ihnen. Die Vorstellung von ‚Juden‘ und ‚Nichtjuden‘ als klar unterscheidbaren Gruppen ist überholt. ‚Gemischte‘ Familien und Partnerschaften sind stattdessen Teil der zeitgenössischen Lebensrealität im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus…
Der nicht unumstrittene Begriff des Hybriden, ursprünglich aus Botanik und Biologie entlehnt und im 19. Jahrhundert in die Rassenlehre übernommen, wo er negativ besetzt wurde, findet seit einigen Jahren in diversen Bereichen der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften wieder Verwendung. Dort richtet sich das Interesse auf Begegnungen, Vermischungen, Übergänge, Übersetzungen und Neuschöpfungen. Daraus entstehen Fragen nach Inklusion und Exklusion, welche Formen ‚Vermischungen‘ oder ‚Hybridisierungen‘ in konkreten Kontexten annehmen und in welchen kulturellen Praktiken und Identitätskonstruktionen sich diese äußern. Solche Fragen stellen sich auch für zeitgenössische jüdische Lebensentwürfe: Versteht man Identitäten als reflexive Prozesse des Selbstverstehens, des Entwickelns von sich immer in Veränderung befindlichen Selbstbildern und als eine Beziehung, zeigt sich, wie bedeutsam der Kontakt mit anderen und das Erfahren von Fremdwahrnehmung durch andere ist. Widersprüchliche Definitionen von Jüdischsein führen hier zu Herausforderungen für gemischte Familien. Die Komplexität resultiert u.a. aus den verschiedenen Ebenen zeitgenössischer jüdischer Identität, wie der kulturellen, der religiösen und nach der Shoah der historischen Ebene der Familien- und Verfolgungsgeschichte.
Der Band „Hybride jüdische Identitäten“ versammelt Vorträge der gleichnamigen internationalen Tagung, die im November 2012 am Erziehungswissenschaftlichen Institut der Universität Zürich stattgefunden hat. Die Autor_innen bringen nicht nur Perspektiven unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen, wie der Psychologie, der Soziologie, der Kultur- und Literaturwissenschaft sowie der Psychoanalyse zusammen, sondern untersuchen auch unterschiedliche nationale Zusammenhänge und Spezifika. Der Sammelband bündelt damit erstmalig Forschungen zu gemischt jüdisch-nichtjüdischen Familien und deren Selbstverständnissen und Erfahrungen.
Lea Wohl von Haselberg (Hrsg.), Hybride jüdische Identitäten. Gemischte Familien und patrilineare Juden, Neofelis verlag 2015, 182 S., Euro 24,00, Bestellen?
LESEPROBE:
Einleitung
Lea Wohl von Haselberg
Als die vom Institut für Erziehungswissenschaften der Universität Zürich und einer Arbeitsgruppe ausgerichtete Konferenz „Hybride jüdische Identitäten? Gemischte Familien und patrilineare Juden“ Anfang November 2012 in Zürich stattfand, hatte sie bereits eine längere Geschichte. Verschiedene Fäden kamen in dem Team, das die Tagung möglich gemacht hat, zusammen: Einzelpersonen, die in interreligiösen Beziehungen leben oder aus solchen stammen und das Projekt doppel:halb, das versucht, Menschen mit gemischt jüdischen Hintergründen ein Forum für ihre Erfahrungen und Familiengeschichten zu geben, trafen auf wissenschaftliches Interesse an einem Thema, dem im deutschsprachigen Raum erst in den letzten Jahren langsam mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. ((Einen Einblick in die Forschungslage gibt auch die Auswahlbibliographie, die zwar nur die zentralen Arbeiten nennt, aber dennoch zeigt, dass die meisten von ihnen jüngeren Erscheinungsdatums sind.))
Gemeinsamer Ausgangspunkt war der Wunsch, die familiäre und identitäre Konstellation der gemischt jüdisch-nichtjüdischen Familie, die wir alle aus unserer Arbeit oder unserem Privatleben kannten, sichtbar zu machen, um damit Identitäten und Familiengeschichten in den Mittelpunkt zu stellen, die sich der klaren Zuordnungen jüdisch und nichtjüdisch entziehen und deshalb – willentlich oder unwillentlich – häufig nicht wahrgenommen werden. Sie stellen unsere sonst scheinbar so gut funktionierenden Schubladen in Frage, stoßen uns darauf, wie brüchig unsere Kategorien sind und wie wenig wir damit unsere Welt tatsächlich fassen können. Denn es leben viele Jüdinnen und Juden im deutschsprachigen Raum und auch darüber hinaus mit nichtjüdischen Partner_innen zusammen, es entstehen Kinder aus diesen Verbindungen und die Annahme, dass ‚die Juden‘ die Anderen seien, die klar von ‚uns‘ zu unterscheiden seien, ist ebenso problematisch wie jene, dass es eine klare, scharfe Grenzen zwischen ‚uns Juden‘ und ‚den Nichtjuden‘ gäbe. Doch eine Debatte um die Konstruiertheit dieser Grenzen und Definitionen, die nicht erst seit der jüdischen Zuwanderung aus den Staaten der ehemaligen GUS nach Deutschland, nicht funktionieren, ((So wanderten etwa 50 % der sogenannten Kontingentflüchtlinge auf Grund des sowjetischen Nationalitätengesetzes nach Deutschland ein, welches Jüdischsein patrilinear definiert. Dadurch galten die als Jüdinnen und Juden nach Deutschland Eingewanderten für die dortigen jüdischen Gemeinden aber (zunächst) nicht als jüdisch. Vgl. Yinon Cohen / Irena Kogan: Jewish Immigration from the Former Soviet Union to Germany and Israel in the 1990s. In: Leo Baeck Institute Year Book 50 (2005), S. 249–265; Karen Körber: Die Aufsteiger: Jung, europäisch, säkular: Eine Studie über das Selbstverständnis der zweiten Zuwanderergeneration aus der Ex-Sowjetunion. In: Jüdische Allgemeine, 20.12.2014. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/21080 (Zugriff am 02.07.2015).)) findet kaum statt. Besonders nach der Shoah ist die Auseinandersetzung darüber, wer Jude ist und wer nicht und vor allem wer dies zu entscheiden habe, aufgeladen wie nie.
Für gemischte Familien und vor allem Menschen mit vaterjüdischem Hintergrund führt das Matrilinearitätsprinzip nicht selten zu einer doppelten Ausgrenzung: So werden sie von ihrer nichtjüdischen Umwelt häufig als jüdisch wahrgenommen, während sie von jüdischer Seite als nichtjüdisch verstanden werden. Weiter zugespitzt ließe sich sagen, dass sie sich oft als jüdisch genug für Antisemitismuserfahrungen erleben, aber nicht als ausreichend jüdisch für einen positiven Zugang, unter dem häufig die Anerkennung durch jüdische Institutionen und das damit verbundene religiös-kulturelle Leben verstanden wird. In den Beiträgen dieses Bandes, die auf Interviews basieren, wird diese Erfahrung sehr eindrücklich beschrieben. Aber auch für Menschen mit jüdischer Mutter und nichtjüdischem Vater und für jüdisch-nichtjüdische Paarbeziehungen können spezifische Fragen bezüglich ihrer jüdischen Identität entstehen – etwa danach, welche Rolle Jüdischsein in ihrem Leben spielen und in welcher Form es an Kinder weitergegeben werden soll.
In den letzten Jahren wurde die Frage, wer eigentlich jüdisch sei, in jüdischen Gemeinden und Institutionen zunehmend diskutiert. Die schrumpfenden jüdischen Gemeinden müssen sich überlegen, wie ihre Zukunft aussehen soll und dabei auch den Umgang mit patrilinearen Juden überdenken, argumentierte beispielsweise Heinrich Olmer, der damalige Vorsitzende der Israelitischen Kultusgemeinde Bamberg, in seinem 2011 erschienenen Buch Wer ist Jude?. ((Heinrich C. Olmer: Wer ist Jude? Ein Beitrag zur Diskussion über die Zukunftssicherung der jüdischen Gemeinschaft. Würzburg: Ergon 2010.)) Aus Perspektive der jüdischen Gemeinden sind die jüdisch-nichtjüdischen Beziehungen und Ehen Anlass zur Besorgnis, bedrohen sie doch, so mag es scheinen, den Fortbestand der jüdischen Gemeinschaft. Auch in der Jüdischen Allgemeinen erschienen in den letzten Jahren einige Artikel, die interreligiöse Beziehungen und Matrilinearität thematisierten: Zentral um Matrilinearität und deren Folgen für patrilineare Jüdinnen und Juden sowie für die jüdischen Gemeinden in Deutschland geht es 2006 in einem Artikel von Ruth Zeifert und 2011 bei Micha Brumlik. ((Ruth Zeifert: Irgendwie jüdisch. Identitätsdilemma: Wenn der Vater Jude ist und die Mutter nicht. In: Jüdische Allgemeine, 17.08.2006. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6317 (Zugriff am 14.08.2015); Micha Brumlik: Papa ante portas. Warum die Gemeinden auch Kinder jüdischer Väter als Mitglieder akzeptieren sollten. Ein Plädoyer. In: Jüdische Allgemeine, 06.01.2011. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/9427. (Zugriff am 14.08.2015).)) Über die Ursprünge und Gründe für die matrilineare Transmission im Judentum schreibt 2013 Anette Boeckler. ((Anette M. Boeckler: Identität. Das Mutterprinzip. In: Jüdische Allgemeine, 03.05.2013. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/15829 (Zugriff am 14.08.2015).)) Und 2007 und 2013 befassen sich – ebenfalls in der Jüdischen Allgemeinen – Sue Fishkoff und Fabian Wolff mit der Selbstbeschreibung als ‚halbjüdisch‘. ((Fabian Wolff: Falsche Bruchrechnung. Warum der Begriff „Halbjude“ auf den Index gehört. In: Jüdische Allgemeine, 16.06.2011. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/10568 (Zugriff am 14.08.2015); Sue Fishkoff: „Ja, ich bin Halbjüdin.“ Zwischen Ablehnung und Akzeptanz: In den USA bekennen sich immer mehr Kinder aus Mischehen zu beiden Seiten ihrer Identität. In: Jüdische Allgemeine, 23.08.2007. http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/4280 (Zugriff am 14.08.2015).)) Während Fishkoff in ihrem Artikel vor allem auf die Situation von Menschen mit jüdisch-nichtjüdischem Familienhintergrund in den USA eingeht, dabei aber weniger deren Akzeptanz als Jüdinnen und Juden durch jüdische Institutionen problematisiert, sondern vielmehr, dass sie mit ihrem Selbstverständnis als ‚halbjüdisch‘ sowohl bei orthodoxen als auch bei liberalen Gemeinden auf Ablehnung stoßen, kritisiert Fabian Wolff die unbeschwerte Verwendung des Begriffs.
Den Begriff ‚halbjüdisch‘ auf Grund der Rolle, die er in der Judenvernichtung während des Nationalsozialismus spielte, ablehnend, befindet er ihn weiterhin als völlig unpassend, weil er das Bild einer jüdischen und einer nichtjüdischen Hälfte evoziere. Das Dilemma, dass der Begriff durchaus von Menschen aus jüdisch-nichtjüdischen Familien als Selbstbeschreibung verwendet wird, denen es nicht nur um die Akzeptanz ihres Jüdischseins, sondern auch um ihre anderen kulturellen und religiösen Hintergründe geht, deutet sich in seinem Text an. Er vermag es jedoch nicht aufzulösen.
2014 erschien ein Bericht zu Identitäten und Alltagspraktiken vo Kindern aus gemischt jüdisch-nichtjüdischen Familien von Julia Bernstein für das JDC International Centre for Community Development, in dem die Autorin auch auf die Tagung „Hybride Identitäten“ und die dort vorgestellten Konzepte und Überlegungen Bezug nimmt. ((Julia Bernstein: „Ab und zu Kosher, ab und zu Shabbat“. Eine Studie zu Identitäten, Selbstwahrnehmungen und Alltagspraktiken von Kindern aus ‚mixed families‘ in Deutschland. JDC International Centre for Community Development, 2014. http://www.bjpa.org/Publications/downloadFile.cfm?FileID=21544 (Zugriff am 02.07.2015). Die von Julia Bernstein durchgeführte Studie wurde zeitgleich auch für Frankreich und die Niederlande erarbeitet und sollte die Forschungslücke schließen, die es verglichen mit den USA für Europa hinsichtlich dieses Themas gibt.)) Bernstein beschreibt, dass die Heirat außerhalb der eigenen religiösen Gruppe von religiösen Autoritäten als „Einfallstor von Assimilation“ wahrgenommen werde, obwohl es sich letztlich bereits um ihre Manifestation handele. ((Ebd., S. 5.)) So scheint das Matrilinearitätsprinzip tatsächlich zum Ziel zu haben, den Zusammenhalt der jüdischen Gemeinschaft in der Diaspora zu sichern.
Matrilinearität in der Transmission des jüdischen Status gab es allerdings nicht ‚schon immer‘, sondern es stammt aus der Zeit Esras, also um 444 v. u. Z., wie Christina von Braun und Micha Brumlik in ihren Beiträgen zu vorliegendem Band zeigen. Damals war das Verbot der ‚Mischehe‘ und das Matrilinearitätsprinzip eine Reaktion auf spezifische historische Umstände mit dem Ziel, Zusammenhalt und Fortbestand jüdischen Lebens zu sichern. Und so ist es nicht verwunderlich, dass heute unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen, die matrilineare Transmission des Judentums wieder zum Gegenstand von Auseinandersetzungen wird. Verknappt ließen sich diese veränderten gesellschaftlichen Zusammenhänge anhand einiger sehr unterschiedlicher Entwicklungen beschreiben: wie der Massensäkularisierung, die seit dem Ende des 18. Jahrhunderts das jüdische Leben (in Europa) ergriffen hat; der Shoah sowohl mit der Definitionsmacht der Nazis, wer als jüdisch ermordet wurde, als auch mit er bis heute andauernden Bedeutung der Verfolgungsgeschichten in der Familie; der Existenz des Staat Israel als Alternative zur Diaspora, welcher patrilinear jüdische Menschen insofern anerkennt, als sie die israelische Staatsbürgerschaft erhalten können, wenn sie dort ohne Konversion auch nicht als Juden gelten; sowie nicht zuletzt postmoderne Identitätskonzepte, in denen nicht nur verschiedene Identitäten zusammengebracht werden, sondern Alltagspraktiken selektiv und höchst individuell zu Stande kommen. ((Bernstein: „Ab und zu Kosher, ab und zu Shabbat“, S. 7.))