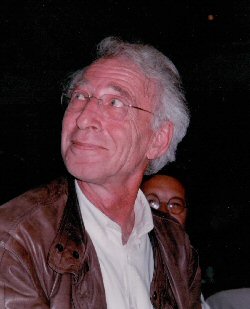Peter Finkelgruen wird 75…
Von Roland Kaufhold
Ralph Giordano, Überlebender der Shoah, war mehr als aufgebracht. In einer Besprechung von Peter Finkelgruens autobiografischem Buch Haus Deutschland bezeichnete der 70-Jährige einen Dortmunder Oberstaatsanwalt bewusst als „einen emotionslosen Ochsenfrosch, dem die Untat ins Gesicht geschrieben“ stehe. Und Giordano fügte hinzu: „Es heißt, der Mensch kann nur einmal sterben. Auch das ist ein Irrtum. Martin Finkelgruen wurde zweimal getötet: einmal physisch, und ein anderes Mal dadurch, daß gegen Malloth kein Verfahren eröffnet wurde.“ Dieser Dortmunder Oberstaatsanwalt hatte ein Jahrzehnt lang alles versucht, um den SS-Aufseher und Mörder eine Verurteilung zu ersparen.
Mit dieser 1993 in der Frankfurter Rundschau publizierten Intervention unterstützte Giordano seinen 19 Jahre jüngeren Kölner Freund Peter Finkelgruen nachdrücklich – und erfolgreich. Nun war der seit vier Jahren verschleppte Prozess gegen den Mörder von Finkelgruens Großvater eine öffentliche Angelegenheit. Der „Ochsenfrosch“ hatte auf ganzer Linie gesiegt. Heute wird der in Köln lebende jüdische Publizist Peter Finkelgruen 75 Jahre alt.
Geboren wurde Peter Finkelgruen am 9. März 1942 in Shanghai. Dorthin waren sein jüdischer Vater und dessen Ehefrau vor der Verfolgung geflohen. Shanghai war für 19.000 Verzweifelte aus Deutschland einer der wenigen offenen Zufluchtsorte. Vier Jahre lebte er dort, die Lebensumstände waren verheerend. Sein Vater Hans war am 25.5.1943, 16 Monate nach Peters Geburt, in Folge der nationalsozialistischen Verfolgung verstorben. Peter lernte ihn nie kennen. In Shanghai hatten seine Eltern einen kleinen Laden für Handschuhe und Lederwaren betrieben. Neun Monate nach seiner Geburt, am 10.12.1942, wird sein Großvater Martin im kleinen Lager Theresienstadt ermordet. Seelisch bleibt er für immer mit diesem verbunden.
Die Deutschen waren sehr gründlich: Im Februar 1943, Peter ist elf Monate alt, wird im fernen Shanghai das identische Wahnsystem wie in Europa aufgebaut: Das Ghetto Shanghai. Die Vernichtung der Juden wurde von deutschen Diplomaten und NS-Funktionären in Shanghai ab 1943 konkret erwogen und geplant.
Lange hat er nahezu nichts über seine ersten vier Lebensjahre erinnert. Bei seinen jahrelangen autobiografischen Recherchen ist manches wiedergekommen. Hierunter einige Fotos: Der Vierjährige inmitten von 55 Kindern seines Shanghaier Kindergartens.
Auch an seine Mutter Ernestine hat er nur wenige Erinnerungen. Esti war durch die Verfolgung sehr krank, kaum lebensfähig, aber in tiefer Sorge um ihren Sohn. Von Shanghai aus schreibt sie an die in Palästina lebende Schwägerin einen Briefe mit einer dringlichen Bitte: „Ich möchte Euch Peterle nochmals ans Herz legen. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, dass er dann zu Euch soll.“

Lebensstationen
Im Dezember 1946 geht der Vierjährige mit seiner Mutter in das kommunistische Prag. Dort wartet seine katholische Großmutter Anna auf ihn. Anna hat mehrere Konzentrationslager überlebt. Ins Lager kam sie, weil sie Peters jüdischen Großvater Martin versteckt hatte. Fünf Jahre bleibt Peter in Prag, muss wieder eine neue Sprache lernen, besucht dort eine Grundschule. Lachend erinnert er sich im Gespräch: „Das waren eigentlich die beinahe einzigen ordentlichen Schuljahre meines Lebens.“ 1949 schreibt seine todkranke Mutter an ihre Schwägerin Dora im Kibbuz Kfar Hammakabi: „Peterle geht zur Schule und hält mir politische Vorträge über Lenin. Zweimal mußte er schon Gedichtchen vortragen, zur Feier des Revolutionstages und zur Verbrüderung, das heißt zur Befreiung der Republik durch die Armeen.“ Im Mai 1950 stirbt Esti.
Jugend in Israel
1951 siedelt seine Großmutter mit dem Neunjährigen nach Israel über. Seine Tante und sein Onkel warten auf sie. Als überzeugte Zionisten waren sie in den 30er Jahren rechtzeitig in das damalige Palästina emigriert. So entgingen sie der von Deutschen organisierten Vernichtung.
Anfangs leben sie im Kibbuz seiner Tante im Norden Israels. Dieser muss sich, drei Jahre nach der Staatsgründung, vor häufigen Angriffen arabischer Terroristen mit Stacheldraht schützen. Anna erinnert dieser Stacheldraht an ihre Lagererfahrungen. Nach einem Jahr ziehen sie weiter in eine kleine Ortschaft in der Nähe von Haifa, bauen dort mit Hilfe eines arabischen Ziegenhirtes ein winziges Häuschen. Dort besucht Peter – der wieder eine neue Sprache erlernen muss – ein von französischen Patres geleitete Schule. Unterrichtssprache ist dort nicht hebräisch, sondern arabisch und französisch. Für ihn ist es eine erneut verwirrende, aber auch eine lebenslang prägende Zeit. Er erinnert sich an das erste Jahr: „Ich verstand noch weniger als in Ivrith. Ich wurde krank, bin tagelang abgehauen, kannte Haifa von oben bis unten. Ich ging in Antiquariate statt zur Schule. Jerry-Cotton-Hefte, Zeitschriften wie Stern und Kristall, nach und nach deutsche Bücher.“ Dann kommt er in Haifa in ein schottisches Internat. Der anglikanische Pfarrer ist für ihn „eine Lichtgestalt“, ein Vaterersatz: „Alle Jungen mochten ihn, und alle mit problematischem Hintergrund. Auf der Schule gab es Christen, Mohammedaner, Juden.“
Deutschland
Mit 17 Jahren macht Peter Finkelgruen in Israel sein Abitur. Er hat kein Geld, möchte aber auf jeden Fall studieren. Dies ist ihm in Israel nicht möglich. Er hört von den „Wiedergutmachungsgeldern“, die Deutschland für jüdische Verfolgte und deren Nachkommen zahlt. 1959 geht er gemeinsam mit seiner Großmutter nach Deutschland. In ein Land, das ihm vollständig fremd ist und vor dem er abgrundtiefe Ängste hat. Deutschland ist für ihn vor allem das Land der Mörder.
Es folgt ein Studium der Politikwissenschaft und Geschichte. Er erhält sogar einen Forschungsauftrag zur politischen Situation in Israel, lebt dort noch einmal einige Wochen. Dann arbeitet er als Journalist, landet schließlich bei der Deutschen Welle. Schrittweise wird ihm die Bundesrepublik vertrauter, aber die Konfrontation mit dem eher unverhüllten Antisemitismus verunsichert ihn immer wieder. Sein kleiner Freundeskreis besteht weitgehend aus Menschen mit jüdischem Hintergrund. Er engagiert sich im linken Flügel der Kölner FDP, sein Freund Gerhart Baum und viele andere kämpfen gegen den starken nationalsozialistischen Flügel der damaligen FDP. In Köln treffen sie sich Jahre später im parteiunabhängigen linksliberalen Liberalen Zentrum.

1979 tun sich Finkelgruen und sein vier Jahre jüngerer Kölner Freund Henryk M. Broder, angespornt durch die linke Protestbewegung, zusammen. In Eigenregie geben sie eine selbst finanziert, linke jüdische Zeitung heraus: Freie Jüdische Stimme prangt auf dem Titelbild. Sie erscheint monatlich im Zeitungsformat. Linke politische Themen, scharfe Analysen und Proteste gegen Rechtsextremismus, aber auch wortgewaltige Angriffe gegen „das Establishment“ des Zentralrats prägen das Erscheinungsbild. „Walter Scheel: Kölner Widerstandskämpfer waren Verbrecher!“ war der Aufmacher der ersten Ausgabe im Juli 1979. Insbesondere Henryk M. Broder positioniert sich immer wieder als „noch stärker links“ als Finkelgruen. In sehr scharfer Diktion greift Broder das Umfeld von Rechtsradikalen, aber auch Vertreter des Zentralrates und israelische Politiker an. Im Dezember 1980 ist nach zehn Ausgaben Schluss mit der Selbstausbeutung. Und beide beschließen unabhängig voneinander nach Jerusalem zu gehen, wo sie sich wiedertreffen.
Israelkorrespondent in Israel
Von 1982 bis 1988 eröffnet sich für Peter Finkelgruen eine ihn faszinierende Möglichkeit: Er kann als Journalist sowie als Leiter der Friedrich Naumann Stiftung nach Israel gehen. Israel ist ihm noch immer vertraut: „Dies waren die glücklichsten Jahre in meinem Leben“, erinnert er sich. „Wir waren voller Hoffnung, dass sich die Beziehungen zwischen Israelis und Palästinensern rasch verbessern würden.“ Für die Naumann Stiftung vermag er zahlreiche Konferenzen zwischen Israelis und Palästinensern zu organisieren. Alles erscheint als möglich. Die Chance, liberale, demokratische palästinensische Persönlichkeiten politisch zu stärken wird nicht genutzt. Heute hält er dies für ein tragisches Versäumnis.
In Israel gelingt es ihm, Yad Vashem zahlreiche Unterlagen über die Widerstandstätigkeit der Edelweißpiraten zur Verfügung zu stellen. 1984 werden einige von ihnen in Jerusalem in einer feierlichen Zeremonie als „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. In Köln gelten sie hingegen noch 20 Jahre lang als „Kriminelle“.
Der Mörder des Großvaters
Auf der Rückreise nach Deutschland wird Finkelgruen 1988 bei der Zeitungslektüre durch Zufall mit seiner eigenen Familienvergangenheit konfrontiert: Er erfährt den Namen des Mörders seines Großvaters. Zehn Jahre lang führt er einen einsamen juristisch-publizistischen Kampf gegen den friedlich in Deutschland lebenden Mörder – Anton Malloth – , der durch die nationalsozialistische „Stille Hilfe“ unterstützt wird. Zwei Bücher entstehen hieraus: Haus Deutschland und Erlkönigs Reich.
Peter Finkelgruen hat gelernt, mit Widersprüchen zu leben, diese als Herausforderung anzunehmen. „Immer im Widerspruch zur Obrigkeit“ ist seine Lebensmaxime.
2006 erleidet Finkelgruen einen Herzinfarkt. Mehrfach musste er operiert werden. Die aus den traumatischen Situationen seiner frühen Kindheit erwachsene Angst hat ihn nie losgelassen. Als die Berliner Bundesentschädigungsbehörde ihm – wie hunderten anderen NS-Opfern – immer wieder die Erstattung lebensnotwendiger Behandlungen verweigerte reicht es ihm irgendwann: 2009 tritt der 67-Jährige in einen Hungerstreik. Er weiß: Er vermag sich zu wehren, die Mehrzahl der traumatisierten NS-Opfer jedoch nicht. Nach massiven Protesten insbesondere von Schriftstellerkollegen gibt die Behörde nach. Sie beschließt eine Regelung, die für alle NS-Opfer gelten solle.
Ein Baum für Martin Finkelgrün
Zu seinem 70. Geburtstag pflanzen Freunde – hierunter Dogan Akhanli und Gerhart Baum – im Namen der zuständigen lokalen Bezirksvertretung einen Baum für den ermordeten Martin Finkelgrün. „Es ist nach meinem Wissen das erste mal in Deutschland, dass in dieser Weise, gemäß jüdischer Tradition, durch einen Baum an einen ermordeten Juden erinnert wird“, bemerkt Finkelgruen. Vor dem jungen Baum plaziert das Grünflächenamt zwei wuchtige Findlinge. „Die können nicht gestohlen werden“, ist die Überlegung. Auf einem dieser Findlinge wird ein metallenes Gedenkschild mit kurzen Erläuterungen angebracht. Anwohner hinterlassen immer mal wieder Steine zur Erinnerung an den Ermordeten, bis heute.

Geschichte soll sich nicht wiederholen. Das war die Grundidee dieser Baumpflanzung. Und sie wiederholte sich doch: Im Juli 2016 wird die Gedenkplatte mit weißer Farbe übersprüht, so dass sie unleserlich ist. Die Erinnerung sollte gezielt ausgelöscht werden.
Peter Finkelgruen reagierte auf Nachfrage auf die Schändung lakonisch: „Es hat vier Jahre und vier Monate seit Errichtung des Gedenksteins gedauert bis zur ersten Schändung. Ein kurzer Zeitraum? Ein langer Zeitraum? So ist die Lage eben in diesem Land. In dieser Stadt.“
Eine gekürzte Version erschien im Neuen Deutschland, 09.03.2017.