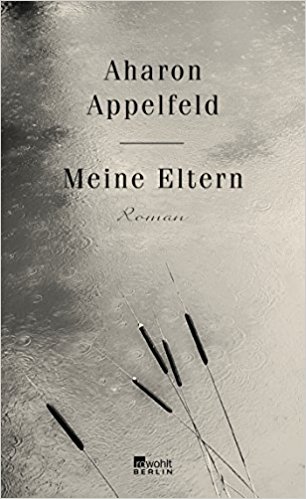Aharon Appelfelds neuer Roman „Meine Eltern“…
Von Karl-Josef Müller
Mit acht Jahren verliert Aharon Appelfeld seine Mutter und Großmutter, beide werden unmittelbar nach dem deutschen Einmarsch im Herbst 1940 von rumänischen Antisemiten ermordet. Die behütete Kindheit in Czernowitz ist zu Ende. Gemeinsam mit dem Vater wird Appelfeld in ein Arbeitslager verschleppt, aus dem er fliehen kann. „Mein Überleben war wie ein Märchen, es war irgendwo wie ein Märchen.“ In einem Interview vom Januar 2008 deutet Appelfeld an, wie er als Kind in diesem Märchenland hat überleben können.
Im Alter von etwa dreißig Jahren findet er den Vater wieder: „Er kam nach Israel, er wusste nicht, wo ich bin, er konnte sich nicht vorstellen, dass ich irgendwo überlebte. Ich habe nach ihm gesucht, er nicht nach mir, ein achtjähriges Kind konnte nicht überleben in diesen kalten Ländern.“ Aber Aharon Appelfeld hat überlebt, wie durch ein Wunder, auf so schwierige wie märchenhafte Weise.
Zu der Zeit, als er seinen Vater in Israel wiederfindet, hat Appelfeld noch nicht mit dem Schreiben begonnen, doch mit seinem Vater kehrt auch seine Kindheit zu ihm zurück: „Er hat mir zurückgegeben viele von meinen Erinnerungen.“
Damit erfüllt sich, was für das verlassene Kind eine Gewissheit war: „Sie waren mit mir, sie waren immer mit mir. Ich hab mit ihnen immer ein Gespräch gehabt und hab immer gesagt zu mir, sie haben mich nicht verlassen, sie kommen, ich muss warten, sie werden kommen, und ich warte, bis heute.“ Er wartet immer noch, und gleichzeitig hat sein Warten ein Ende gefunden, denn „mein Schreiben hat mir meine Eltern zurückgebracht.“ Im Schreiben kehrt Appelfeld in seine Kindheit zurück: „Ich wollte mein Heim erobern, ich wollte mein Heim, einen guten Raum bauen für mich und meine Eltern, ich habe jetzt ein Heim, ich habe nicht nur ein Heim, ich habe ein Viertel.“
Dieses Heim, diese verlorene und wiedergefundene heimatliche Geborgenheit schildert Aharon Appelfeld auch in seinem Roman „Meine Eltern“. Idyllische Bilder, erinnernd an Landschaftsbeschreibungen Eichendorffs, tauchen auf neben den unübersehbaren Menetekeln von Verfolgung, Krieg und hasserfülltem Antisemitismus.
Der Roman beschreibt über weite Passagen einen mehrwöchigen Sommerurlaub der Familie am Pruth. Der Fluss ist Anziehungspunkt für eine gemischte jüdische Urlaubsgesellschaft, die sich wie jedes Jahr dort zusammengefunden hat, kritisch beobachtet vom Vater des Erzählers, mitfühlend wahrgenommen von der Mutter. Appelfeld belässt allen ihre Würde, ohne ihre Schwächen zu verschweigen, denn letztlich sind sie alle Menschen, in denen das Göttliche aufscheint, wie Appelfeld im Interview bemerkt. Selbst die Antisemiten unterschiedlicher Coleur zeichnet der Erzähler nicht als Monster, sondern belässt auch ihnen menschliche Züge, ohne ihr Verhalten zu entschuldigen oder zu entschulden.
So leistet der Roman zweierlei. Appelfeld holt sich mit dieser Geschichte wie mit großen Teilen seines Gesamtwerkes seine Kindheit zurück, aus der er einst jäh und unbenennbar brutal herausgerissen wurde, und lässt gleichzeitig keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wie verletzlich deren Geborgenheit war.
Gegen Ende des Aufenthaltes am Fluss wird der Zehnjährige von einem Traum gequält: „Im Traum versuchen Polizisten und brutale Bauern, sich zwischen meine Eltern und mich zu drängen. Meine Eltern umklammern mich, schaffen es aber nicht, mich ihren Händen zu entreißen, und am Ende falle ich aus dem Bett und wache auf. Am nächsten Morgen fragte ich meine Mutter, ob der Krieg uns trennen würde. «Wie kommst du denn darauf?» «Im Traum hat man versucht, uns zu trennen», gab ich zu. «Wir werden zusammenbleiben», sagte sie und lächelte. Mir fiel auf, dass sie diesmal nicht «immer» sagte.“
Ein kurze Bemerkung von Miljenko Jergović aus seinem Roman „Die unerhörte Geschichte meiner Familie“ umschreibt recht gut, wie Aharon Appelfeld die aufziehende Katastrophe in seinem Roman zur Erscheinung bringt: „Leid, das mit keinem Wort beschrieben wird, aber so wahrhaftig aufscheint, wie es keine Beschreibung des Leids vermag. Was im literarischen Text nicht ausgesprochen wird, lassen gute Schriftsteller durch Abwesenheit sprechen, durch weiße Flecken, sie schreiben um die Leerstelle herum.“
Zwar benennt Appelfeld leidvolle Geschehnisse, doch sind diese nur Andeutungen dessen, was zwei Jahre später, der Roman spielt im Sommer 1938, geschehen wird.
„Schreiben ist kein Experiment, ich schreibe, was ich schreiben muss, nur was ich muss.“ Der unbedingte Wille, dem eigenen und unabweisbaren Antrieb zum Schreiben gerecht zu werden, führt Appelfeld zurück zum kindlichen Staunen: „Ohne das kindliche Staunen wird man ernsthaft, und das Denken füllt sich mit Zweifeln (…)“ Der Dichter Aharon Appelfeld hat für sein Erzählen seine ganz eigene Sprache gefunden, das bezeugt sein von Mirjam Pressler beeindruckend übersetzter Roman „Meine Eltern“ von neuem. Er hat das Zauberwort getroffen, das Eichendorff im Gedicht beschwört:
Schläft ein Lied in allen Dingen,
Die da träumen fort und fort,
Und die Welt hebt an zu singen,
Triffst du nur das Zauberwort.
Im Widerstand gegen den millionenfachen Mord beharrt Appelfeld darauf, dass seine Eltern gelebt haben und er immer noch von ihrer Geborgenheit zehrt, von der sein Roman Zeugnis ablegt.
Aharon Appelfeld: „Meine Eltern“. Aus dem Hebräischen von Mirjam Pressler, Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2017, 272 Seiten, 22,95 Euro, Bestellen?