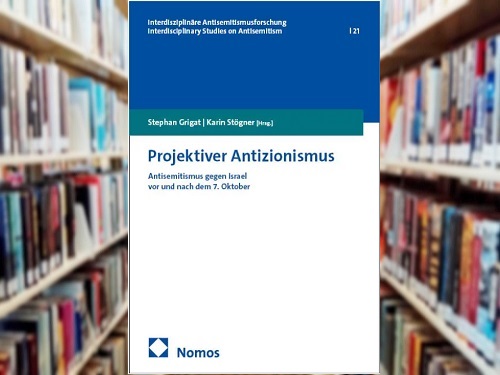Antisemitismus gegen Israel vor und nach dem 7. Oktober
Im projektiven Antizionismus findet eine geopolitische Reproduktion des Antisemitismus statt. Die Beiträge zeigen, wie der Hass auf den jüdischen Staat als Integrationsideologie fungiert, welche schon vor den Massakern vom 7. Oktober politisch heterogene Bündnisse gegen Israel ermöglicht hat. Aus politikwissenschaftlicher, soziologischer und geschichtswissenschaftlicher Perspektive wird die Zäsur der Hamas-Massaker für eine interdisziplinäre, sich an der Kritischen Theorie orientierende Antisemitismuskritik beleuchtet. Die Beiträge skizzieren globale Erscheinungsformen des Israelhasses und analysieren die theoretischen und historischen Traditionen eines antisemitischen Antizionismus und seine intersektionalen ideologischen Verschränkungen.
Stephan Grigat / Karin Stögner (Hg.): Projektiver Antizionismus. Antisemitismus gegen Israel vor und nach dem 7. Oktober, Nomos Verlag 2025, 600 S., erschienen auch im Open Access als kostenfreier PDF-Download.
–> Memefizierter Antisemitismus
Protest und antisemitische Projektion auf TikTok, Instagram & Co im Schatten des 7. Oktobers
LESEPROBE:
Kritik des projektiven Antizionismus
Israel als „Jude unter den Staaten“ und das „Gerücht über den Zionismus“
Stephan Grigat und Karin Stögner
Gibt man heute eine Sammlung gegenwartsbezogener Analysen zu Antisemitismus und Israelhass heraus, fallen diese schneller denn je hinter die sich in rasendem Tempo radikalisierende Realität zurück. Das zeigt sich etwa an dem galoppierenden Irrsinn in Teilen der Linken, die sich anschicken, sich als offen antisemitische Bewegung erkennen zu geben: Als die Jüdische Allgemeine am 24. Juli 2025 darüber berichtete, dass in Valencia eine Gruppe jüdischer Jugendlicher aus einem Flugzeug geworfen wurden, postete die Linksjugend Frankfurt, dass der Rauswurf leider nicht stattfand, während das Flugzeug in der Luft war (Majić 2025)2025). Wo wie hier offen zum Mord an Juden und Jüdinnen aufgerufen wird, bedarf es keiner elaborierten Analysen von projektivem Antizionismus und sekundärem Antisemitismus oder von Antisemitismus als „kulturellem Code“ (Volkov 2000). Die Realität droht, jede Analyse und jede auch noch so zugespitzte Kritik in den Schatten zu stellen.
Umso wichtiger ist es, die gesellschaftlichen, politischen und historischen Bedingungen der Möglichkeit von Antisemitismus und Israelhass in den Fokus zu rücken. Denn die nach dem 7. Oktober 2023 immer offener auftretenden Formen von klassischem Antisemitismus und von zunehmend gewalttätig agierendem Israelhass stehen in einer langen Tradition – ebenso wie die Kritik an ihnen: Jean Améry versuchte schon 1969 der deutschen Linken klarzumachen, dass der Antisemitismus im Antizionismus enthalten ist wie das Gewitter in der Wolke (Améry 2005: 133; Gallner 2023: 128). 128). Max Horkheimer kritisierte im selben Jahr sowohl den rechtsradikalen als auch den realsozialistischen Antizionismus: „In der Nationalzeitung wird das Wort ‚Juden‘, wie in den Zeitungen des Ostblocks, durch ‚Zionisten‘ […] ersetzt.“ (Horkheimer 1969: 725) Michael Landmann nahm 1971 Das Israelpseudos der Pseudolinken ins Visier ( Simone de Beauvoir erklärte bereits im „roten Jahrzehnt“ der 1970er Jahre (Koenen 2002), gewisse Äußerungsformen des linken Antizionismus seien „a euphemistic way of translating an anti-Semitism that one dares not admit“ (Beauvoir 2012: 319); und seit den 1990er Jahren ist insbesondere im deutschsprachigen Raum umfangreiche Literatur zur Kritik eines antisemitischen Antizionismus, zu linken Zionismus-Debatten und zur Kritik von jenen islamischen Traditionen des Antisemitismus erschienen, die erstmals nach 9/11 breiter diskutiert wurden und spätestens seit 10/7 im Fokus globaler Antisemitismusdiskussionen stehen – insbesondere im Zusammenhang mit einem projektiven Antizionismus.(1)
Der Zionismus ist in nahezu all seinen Ausprägungen eine Reaktion auf den Antisemitismus – sowohl auf den europäischen als auch, was in der deutschsprachigen Debatte zu selten in den Blick gerät, den arabischen und islamischen. Mit diesem war die zionistische Bewegung schon in den Dekaden vor der israelischen Staatsgründung konfrontiert; schon deshalb kann er kein Resultat dieser Gründung sein. Ob linker oder rechter, ob säkular oder nationalreligiös begründeter Zionismus – der Grundgedanke bleibt unabhängig von den je postulierten und stark divergierenden Identitätskonzepten, die eine gewichtige Rolle in den unterschiedlichen Ausprägungen sowohl des historischen als auch des gegenwärtigen Zionismus spielen, stets die Organisierung eines bewaffneten Kollektivs zur Selbstverteidigung gegenüber dem Antisemitismus. Darin unterscheidet sich der jüdische Staat von allen anderen auf dieser Welt. Die Etablierung und Verteidigung jüdischer Souveränität ist die Antwort auf eine sich durch die Jahrhunderte ziehende Verfolgungsgeschichte und insbesondere auf die nationalsozialistische Judenvernichtung (Grigat 2014).
Das politische Programm des postnazistischen Antizionismus besteht darin, Juden und Jüdinnen, mit welcher Begründung auch immer, das Recht auf einen eigenen Nationalstaat selbst noch nach der Shoah abzusprechen und aktiv auf die Zerstörung Israels hinzuarbeiten. Seine politischen und militärischen Hauptakteure waren über Jahrzehnte hinweg der arabische Nationalismus und der poststalinistische Realsozialismus (Herf 2019), und seit Ende der 1970er Jahre insbesondere die diversen Ausprägungen des sunnitischen und schiitischen politischen Islam – immer wieder in Kooperation mit oder unterstützt von diversen Formationen der westlichen Politik und Gesellschaften.
Der titelgebende Begriff des projektiven Antizionismus versucht, die Debatten ebenso einzuhegen wie abzugrenzen und meint einen sich gegen Israel richtenden Antisemitismus, der treffend als geopolitische Reproduktion des klassischen Antisemitismus beschrieben wurde (ISF 2002: 7–16; 7–16;Grigat 2007: 320f.; Bruhn 2020).(2) Im „conspiracist antizionism“ (Tabarovsky 2022) wird offen auf antisemitische Verschwörungsmythen zurückgegriffen. Der Begriff des projektiven Antizionismus knüpft an Léon Poliakovs Formulierung an, wonach Israel als „Jude unter den Staaten“ fungiert ( 33) – womit schlaglichtartig die pathische Projektion der antisemitischen Traditionen des Antizionismus auf den Punkt gebracht wird.
In dieser ideologischen Gemengelage dient der jüdische Staat als Projektionsfläche zum einen für die nicht begriffene Widersprüchlichkeit im Nationskonzept – dass der Staat als Manifestation des Kapitalverhältnisses gegenüber seinen Bürgerinnen und Bürgern das Gewaltmonopol verkörpert und gerade in dieser Monopolstellung deren Rechte zumindest pro forma garantiert – und zum anderen für den Umstand, dass der Staat und seine Institutionen nicht deckungsgleich mit seinen Bürgern und Bürgerinnen sind. Diese Nichtidentität von Staat und Volk ist der wunde Punkt, auf den der Antisemitismus in der Ablehnung alles Abstrakten reagiert, indem er die staatlichen Institutionen in der konkretistischen, gegen jede Vermittlung gerichteten Idee der Volksgemeinschaft einebnet, von der Juden und Jüdinnen exkludiert sind. Einerseits erscheint der Staat Israel im projektiven Antizionismus als der Inbegriff des Künstlichen, Abstrakten und Unauthentischen, als eine ‚Entität‘, die gar kein ‚richtiger‘ Staat sei; andererseits sieht man im jüdischen Staat das verkörpert, was man bei sich selbst überwunden oder verloren gegangen glaubt: ein völkisch-ethnisches Gemeinwesen, das durch sein verstocktes Festhalten an seiner Partikularität dem universellen Weltfrieden im Weg stünde. In beiden Fällen – der Vorstellung Israels als ‚künstlichem Gebilde‘ oder als ‚verstockte Partikularität‘ – werden ideologische Anleihen beim Nationalsozialismus genommen. Die Aufspaltung konkret vs. abstrakt, natürlich vs. künstlich wird so selbst beweglich und kann mal in dieser, mal in jener Form gegen Israel gewendet werden (Stögner 2025a). Insofern ist der projektive Antizionismus nicht als politische Gegenbewegung zum Zionismus misszuverstehen, sondern beruht auf dem „Gerücht über den Zionismus“ (Lenhard 2025: 810), das mit dem Zionismus als nationale und antikoloniale Befreiungsbewegung der Juden und Jüdinnen nichts zu tun hat, sondern die ideologische Legitimation für die Vernichtung Israels als der größten jüdischen Gemeinschaft weltweit abgibt.
Der projektive Antizionismus ist in seiner Vielschichtigkeit und Beweglichkeit die im Westen derzeit vordringliche Form des Antisemitismus. Er steht für sich selbst und bereitet den Weg für erneut erstarkende traditionelle Formen des Judenhasses, wie der eingangs exemplarisch genannte Fall der Linksjugend Frankfurt zeigt.
Den mittlerweile ubiquitär auftretenden Israelhass als „antisemitische Integrationsideologie“ (Salzborn 2018: 139) ins Visier zu nehmen, ist in einer sich an der klassischen Kritischen Theorie orientierenden Kritiktradition mittlerweile Konsens und wird auch in den beiden, dieses einleitende Vorwort ergänzenden Interviews thematisiert. Der projektive Charakter des antisemitischen Ressentiments dient ebenso als Empörungspotential wie als integrativer Schirm für unterschiedliche, auch gegensätzliche politische Akteure, die Gegenstand der hier versammelten Analysen sind: linke und rechte, islamische und christliche, postkoloniale und antirassistische, anti- und neoimperialistische, feministische und djihadistische, queere und rechtsradikale Akteure können sich ebenso darauf verständigen wie Akteure im Kunst- und Kulturbereich, an Universitäten und im Politikbetrieb, in internationalen Organisationen wie der UNO und NGOs, auf Social Media ebenso wie zunehmend auch in den Mainstream-Medien.(3)
Zäsur 10/7
Es verbindet die hier versammelten Arbeiten das Erschrecken darüber, dass die Gräuel des 7. Oktober, statt eine Welle anhaltender Solidarität mit Israel und seinen Bürgerinnen und Bürgern auszulösen, als Startschuss für eine globale Welle von Antisemitismus – insbesondere in Form eines projektiven, seit 10/7 immer gewalttätiger auftretenden Antizionismus – fungiert hat. Offensichtlich war die jahrzehntelange Diffamierung des Zionismus als „collective evil“ (Wilf 2025) eine der Grundlagen dafür, dass in antizionistischen Kreisen selbst noch vergewaltigten Frauen, ermordeten Babys und Greisen, Gefolterten und den nach Gaza verschleppten Geiseln Empathie verwehrt wurde, so sie nur als ‚Zionisten‘ ins Visier genommen werden konnten. Der 7. Oktober war sowohl für das Selbstverständnis des Zionismus als auch für die Mobilisierungskraft des antisemitischen Antizionismus eine Zäsur: „October 7 changed everything“ (Lipstadt 2025). 2025). Die Massaker des 7. Oktober haben eine „eliminatorisch-antisemitische Botschaft“ (Chernivsky/Lorenz-Sinai 2024: 13) global kommuniziert. Der mit Beteiligung von Teilen der palästinensischen‚ ausgelebte antisemitische und misogyne Blutrausch (4) evoziert für Jüdinnen und Juden weltweit ein zugleich neues und sehr altes Gefühl von Angst und Bedrohung (Heschel 2024). Der 7. Oktober bedeutet für Jüdinnen und Juden „einen fundamentalen und einschneidenden Verlust an Sicherheit“ (Hartmann 2024) und macht es notwendig, das Schutzversprechen des Zionismus zu erneuern.
10/7 hat zu einer Konstellation geführt, in der Israel gar nichts anderes übrig bleibt, als auf die Beseitigung der militärischen Macht seiner antisemitischen Gegner zu setzen (Grigat 2025a: 7–12). Zum Gesamtbild nach dem 7. Oktober gehört neben all den katastrophalen Entwicklungen auch, dass Israel sich an einigen Fronten ausgesprochen erfolgreich gegen seine antisemitischen Widersacher zur Wehr setzen konnte: Der vom iranischen Regime gezogene ‚Ring of Fire‘ rund um Israel konnte zerschlagen werden (Osten-Sacken 2025). Insbesondere die von Teheran massiv aufgerüstete Hisbollah im Libanon wurde entscheidend geschwächt, und die Schläge gegen das Ajatollah-Regime und sein Nuklearwaffenprogramm – die erfolgt sind, nachdem die europäische Politik 30 Jahre Zeit hatte, alle nichtmilitärischen Maßnahmen gegen das für den jüdischen Staat existenzbedrohende Nuklearwaffenprogramm zu ergreifen und das Gegenteil getan hat – können vor dem Hintergrund des antisemitischen Charakters der ‚Islamischen Republik‘ als „praktizierte Antisemitismuskritik“ (Grigat 2025b) verstanden werden.(5)
Definitionen und Kritik
Den meisten der hier publizierten Beiträge liegt ein Verständnis von Gesellschaft zu Grunde, welches das stets auf dem Sprung seiende antisemitische Ressentiment in das Zentrum der Kritik rückt und als negative Wahrheit dieser Gesellschaft begreift. Vor dem Hintergrund solch einer Kritischen Theorie der Gesellschaft und des Antisemitismus kann der Dauerdebatte über die Antisemitismus-Definitionsversuche in der Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA 2016) und der Jerusalem Declaration on Antisemitism (JDA) nur mit Skepsis begegnet werden. Die Arbeitsdefinition der IHRA wird oft wegen ihrer Vagheit und Unbestimmtheit kritisiert. Aus der Perspektive der Kritischen Theorie spricht aber gerade diese Unbestimmtheit für die IHRA-Definition Definition (Stögner 2025a) – trotz all ihrer offensichtlichen Mängel und Widersprüche (Lenhard 2020). Ohne eine gewisse Offenheit liefe die Definition Gefahr, den Antisemitismus auf eine seiner Ausdrucksformen zu reduzieren. Die definitorische Unbestimmtheit ist dem Phänomen Antisemitismus und seiner zweitausendjährigen Geschichte geschuldet – „definierbar ist nur das, was keine Geschichte hat“, schrieb Nietzsche in Zur Genealogie der Moral (1955: 820). Wiederholt hat sich die Kritische Theorie gegen den Vorwurf seitens des Positivismus verteidigt, ihre Konzepte seien zu offen und zu wenig greifbar. Laut Adorno (1993) erfordert ein gesellschaftliches Phänomen definitorische Offenheit und Anschmiegsamkeit. Was einige als vage ablehnen, eröffnet anderen die Möglichkeit, die unterschiedlichen, mitunter widersprüchlichen Bedeutungsebenen des Antisemitismus als historisch-soziales Phänomen zu beleuchten.
Dies kann die Definition von Antisemitismus in der JDA nicht leisten. Aufgrund ihrer mangelnden Offenheit gegenüber historischen Veränderungen und den verschiedenen Bedeutungsebenen des Antisemitismus ignoriert sie weitgehend dessen Geschichte seit 1945 und friert ihn in einer bestimmten Form von Vorurteilen und Ressentiments ein, die sich direkt gegen „Jüdinnen und Juden als Jüdinnen und Juden” (JDA 2021; siehe auch Klug 2013) richten.(6) Dadurch können Formen des sekundären Antisemitismus und des Antisemitismus gegen Israel, die sich einer indirekteren Kommunikation bedienen, kaum erfasst werden. Die JDA basiert nicht auf empirischer und historischer Forschung zum Antisemitismus, sondern auf politischen Überlegungen, die darauf abzielen, „einen Raum für eine offene Debatte über die schwierige Frage der Zukunft Israels/Palästinas zu schützen“ (JDA 2021). Dies ist eine politische Angelegenheit, keine der wissenschaftlichen Antisemitismuskritik (Rensmann/Stögner 2024). Auch wenn die Kritik des Antisemitismus stets politisch ist, sollte eine Definition an die Besonderheiten des Phänomens in all seinen Facetten gebunden sein und nicht an das, was politisch jeweils wünschenswert ist.
Auch die IHRA-Definition ist mangelhaft, weil sie das unter sie gefasste Phänomen notwendig partiell stillstellt. Allerdings tut sie dies in viel geringerem Maß als die JDA. Insofern ist sie die analytisch bessere Definition, auch wenn sie nicht von den Mühen befreien kann, den Antisemitismus in all seinen sich wandelnden Erscheinungsformen ideologiekritisch zu dechiffrieren. Es ist politisch sinnvoll, sich an der IHRA-Definition zu orientieren, die von zahlreichen jüdischen und nicht-jüdischen Institutionen und Organisationen adaptiert wurde. Mit ihr kann der projektive Antizionismus erfasst und gleichzeitig von anderen, nicht-antisemitischen Formen des Antizionismus abgegrenzt werden – was in der Kritik an der IHRA regelmäßig in Abrede gestellt wird.(7) Die JDA hingegen dient in erster Linie der Delegitimierung der Kritik des projektiven Antizionismus – weshalb es nicht weiter verwundern sollte, dass u. a. Nachrichtenagenturen des iranischen Holocaustleugner-Regimes sie freudig begrüßt haben (Grigat 2025a: 171).
Akademische Vernetzung
Am Ende der Einleitung des vor wenigen Monaten erschienenen Bandes Vom Antijudaismus zum Hass auf Israel: Interventionen zur Kritik des Antisemitismus hieß es mit Verweis auf das baldige Erscheinen des vorliegenden Bandes: „Die Antisemitismusforschung und die Politikwissenschaft stehen erst am Beginn, die Bedeutung der Zäsur des 7. Oktober in all ihren Konsequenzen zu erfassen.“ (Grigat 2025a: 12) Wir sind uns dessen bewusst, dass die im Folgenden publizierten Beiträge auch nur ein weiterer Mosaikstein dabei sein können, die Bedeutung des Grauens von 10/7 für die Erforschung und Bekämpfung des globalen Antisemitismus und für die Analyse zukünftiger Bedrohungskonstellationen hinsichtlich des jüdischen Staates zu erfassen. Neben der analytischen und dokumentarischen Anstrengung verstehen wir die Sammlung der Beiträge als Teil einer Vernetzungsbemühung antisemitismuskritischer und israelsolidarischer Akademikerinnen und Akademiker, denen in der Vergangenheit oft die Foren fehlten. Es gehört mittlerweile zum Selbstverständnis einer neuen Generation von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, Antisemitismuskritik zum einen als Kritik an jenen gesellschaftlichen Verhältnissen zu verstehen, in denen sich der Antisemitismus in immer neuen Metamorphosen beständig als mörderische pathische Projektion reproduziert – und alleine dadurch die Notwendigkeit des Zionismus und des jüdischen Staats als Notwehrmaßnahme und Versicherung verdeutlicht – und zum anderen als eine „Kritik im Handgemenge“ (Marx 1988: 381), die sich nicht scheut, wissenschaftliche Analysen explizit als Interventionen ins politische Geschehen zu begreifen und zu konzipieren.
Die Vernetzungsbemühungen haben sich zuletzt u. a. in einer Reihe von Konferenzen und Tagungen niedergeschlagen, in deren Kontext viele der nachfolgenden Beiträge entstanden sind, und die zahlreiche der im vorliegenden Band vertretenen Autorinnen und Autoren zusammengebracht haben: Neben den Sommerakademien des Centrums für Antisemitismus- und Rassismusstudien (CARS) sind hier u. a. die von der Gesellschaft für kritische Bildung organisierte Konferenz Grenzen der Aufklärung: Der 7. Oktober und die Gegenwart des Antisemitismus im Juni 2024 in Köln oder die Herbstakademie Antisemitismuskritische Antisemitismusforschung nach dem 7. Oktober 2023 des Tikvah Instituts im Dezember 2024 in Frankfurt am Main, die internationale Tagung Contemporary Antisemitism im März 2025 am London Centre for the Study of Contemporary Antisemitism und die Mid-Term Conference des Research Network Ethnic Relations, Racism and Antisemitism der European Sociological Association Hate in Transition and the Aftermath of 7 October: Antisemitism and Racism in Times of Political Crisis im September 2025 an der Universität Passau zu nennen. (…)
Stephan Grigat / Karin Stögner (Hg.): Projektiver Antizionismus. Antisemitismus gegen Israel vor und nach dem 7. Oktober, Nomos Verlag 2025, 600 S., erschienen auch im Open Access als kostenfreier PDF-Download.
Anmerkungen:
(1) Ausführlich dazu Grigat (2025a). Auch der Zusammenhang von Antisemitismus und Misogynie ist nicht neu (Stögner 2014), tritt aber ebenso wie ein sich intersektional, feministisch oder queer gebender Antizionismus seit 10/7 immer stärker ins Bewusstsein (Stögner 2024; 2025b).
(2) Die Formulierung „Antisemitismus gegen Israel“ haben zuletzt Klaus Holz und Thomas Haury mit ihrem Buchtitel popularisiert (2021). Zur Kritik an der mitunter zur Verharmlosung des antisemitischen Gehalts einiger Ausprägungen eines projektiven Antizionismus tendierenden Darstellungen bei Holz und Haury siehe Machunsky (2025: 176–190).
(3) Im vorliegenden Band findet sich kein Beitrag zum Antizionismus in den christlichen Kirchen vor und nach dem 7. Oktober. Siehe dazu Tarach (2022) und Staffa (2025).
(4) Zu den Ereignissen des 7. Oktober 2023 siehe APPG (2025).
(5) Eine Darstellung und Diskussion der innerisraelischen Debatten über die Art und Sinnhaftigkeit der Kriegsführung in Gaza bedürfte nicht nur eines eigenen Beitrags, sondern eines ganzen Sammelbandes – der aber in einer Reihe zu „Interdisziplinärer Antisemitismuskritik“ fehl am Platz wäre. Anders gesagt: Debatten über Entwicklungen in der israelischen Gesellschaft und Politik sind wichtig, aber ebenso wenig Gegenstand einer Kritik des projektiven Antizionismus wie die katastrophale Lage in Gaza.
(6) Kritisch zur JDA siehe Rensmann (2023) und Elbe/Ellmers (2025) apologetisch Ullrich et al. (2024). Verteidigungen der IHRA finden sich bei Jikeli (2023) und Johnson (2021).
(7) In der Debatte über die Definitionen ist hinsichtlich der Arbeitsdefinition zu Recht von einer „Mythenbildung“ (Uhlig 2024) und treffend vom „Gerücht über die IHRA-Defi Definition“ die Rede (Elbe/Stahl 2025).
Literatur
Adorno, Theodor W. (1993): Einleitung in die Soziologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp [1968].
Amery, Jean (2005): Der ehrbare Antisemitismus, in: Amery Jean: Werke, Bd. 7, Stuttgart: Klett-Cotta [1969], 131-140.
APPG – All-Party Parliamentary Group for UK-Israel (2025): 7 October Parliamentary Commission Report, https://www.7octparliamentarycommission.co.uk.
Beauvoir, Simone de (2012): Political Writings, Urbana-Champaign: University of Illinois Press.
Bruhn, Joachim (2020): Die Einsamkeit Theodor Herzls, in: sans phrase. Zeitschrift für Ideologiekritik 16 [2003], 11-24.
Chernivsky, Marina/Lorenz-Sinai, Friederike (2024): Antisemitismus vor und nach dem 7. Oktober. Historische Kontinuitäten, Erscheinungsdimensionen und empirische Befunde, in: Ligante – Fachdebatten aus der Präventionsarbeit, #7: Der Nahostkonflikt als Katalysator, 9-15.
Elbe, Ingo/Ellmers, Sven (2025): Wie die Jerusalemer Erklärung Antisemitismus verharmlost, in: Jüdische Allgemeine, 05.06.2025, https://www.juedische-allgemeine.de/ kultur/wie-die-jerusalemer-erklaerung-antisemitismus-verharmlost/.
Elbe, Ingo/Stahl, Andreas (2025): Das Gerücht über die IHRA-Definition. Workshop-Ankündigung, in: GfkB, 30.04.2025, https://kritischebildung.de/veranstaltungen/das -geruecht-ueber-die-ihra.
Gallner, Marlene (2023): Antisemitismus ohne Antisemiten. Zur Aktualität von Jean Amerys Kritik des Antizionismus, in: Grigat, Stephan (Hg.): Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart. Erscheinungsformen – Theorien – Bekämpfung, Baden-Baden: Nomos, 117-133.
Grigat, Stephan (2007): Fetisch und Freiheit. Über die Rezeption der Marxschen Fetischkritik, die Emanzipation von Staat und Kapital und die Kritik des Antisemitismus, Freiburg: ca ira.
Grigat, Stephan (2014): Die Einsamkeit Israels. Zionismus, die israelische Linke und die iranische Bedrohung, Hamburg: konkret.
Grigat, Stephan (Hg.) (2023): Kritik des Antisemitismus in der Gegenwart. Erscheinungsformen – Theorien – Bekämpfung, Baden-Baden: Nomos.
Grigat, Stephan (2025a): Vom Antijudaismus zum Hass auf Israel. Interventionen zur Kritik des Antisemitismus, Opladen: Barbara Budrich.
Grigat, Stephan (2025b): Das Resultat des Iran-Geschäfts ist dieser Krieg, in: Der Standard, 19.06.2025, https://www.derstandard.at/story/3000000274433/das-resultat -des-iran-geschaefts-ist-dieser-krieg.
Hartmann, Deborah (2024): Fachsymposium 2024: Kommentar von Deborah Hartmann. Fachsymposium „Nach dem 7. Oktober: Herausforderungen und Perspektiven für Bildung und Forschung“, YouTube, 27.11.2024, https://www.youtube.com/wat ch?v=jdv5 JkJ 5vxc.
Herf, Jeffrey (2019): Unerklärte Kriege gegen Israel. Die DDR und die westdeutsche radikale Linke, 1967-1989, Göttingen: Wallstein.
Heschel, Susannah (2024): 7. Oktober 2023 – ein Jahr danach, in: feinschwarz. Theologisches Feuilleton, 07.10.2024, https://www.feinschwarz.net/7-oktober-2023-ein-jahr -danach/.
Holz, Klaus/Haury, Thomas (2021): Antisemitismus gegen Israel, Hamburg: Hamburger Edition.
Horkheimer, Max (1969): Max Horkheimer an Zachariah Shuster, in: Horkheimer, Max: Briefwechsel 1949-1973. Gesammelte Schriften, Bd. 18, Frankfurt am Main: S. Fischer, 722-727.
IHRA – International Holocaust Remembrance Alliance (2016): Arbeitsdefinition von Antisemitismus, https://holocaustremembrance, com/resources/arbeitsdefiniti- on-antisemitismus.
ISF – Initiative Sozialistisches Forum (2002): Furchtbare Antisemiten, ehrbare Antizionisten. Über Israel und die linksdeutsche Ideologie, Freiburg: ca ira.
JDA – Jerusalem Declaration on Antisemitism (2021): https://www.jerusalemdeclaratio n.org/wp-content/uploads/JDA-German.pdf.
Jikeli, Günther (2023): Eine Verteidigung der IHRA-Definition. Ressentiments gegen eine Konkretisierung der Definition von Antisemitismus, CARS Working Papers 14, Centrum für Antisemitismus- und Rassismusstudien an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, Aachen, https://doi.org/10.17883/4342.
Johnson, Alan (Hg.) (2021): In Defence of the IHRA Working Definition of Antisemitism, London: fathom.
Klug, Brian (2013): What Do We Mean When We Say “Antisemitism”? Echoes of shattering glass, in: Jewish Museum Berlin/Foundation “Remembrance, Responsibil- ity and Future”/Center for Research on Antisemitism Berlin: Proceedings / Internationale conference “Antisemitism in Europe Today: the Phenomena, the Conflicts”, 8-9 November 2013, https://www.jmberlin.de/sites/default/files/media/documents/ antisemitism-in-europe-today_2-klug.pdf.
Koenen, Gerd (2002): Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977, Frankfurt am Main: Fischer.
Landmann, Michael (2013): Das Israelpseudos der Pseudolinken, Freiburg: ca ira [1971].
Lenhard, Philipp (2020): Undefinierbar. Die jüngsten Debatten um die „Arbeitsdefinition Antisemitismus“ sind eine Farce, in: sans phrase. Zeitschrift für Ideologiekritik 16, 24-28.
Lenhard, Philipp (2025): Benny Morris‘ The Birth of the Palestinian Refugee Problem, die „Neuen Historiker“ und der 7. Oktober 2023. Nachwort zur deutschen Übersetzung, in: Morris, Benny: Die Geburt des palästinensischen Flüchtlingsproblems. Eine Neubetrachtung, Berlin: Hentrich & Hentrich, 799-810.
Lipstadt, Deborah (2025): „Both things can be true at once: the fact that universi- ties have mishandled the situation and the fact that Trump’s rhetoric exploits antisemitism to attack universities”, Interview, in: K. – Les Juifs, l’Europe, le XXIe siecle, 24.07.2025, https://k-larevue.com/en/deborah-lipstadt-interview/.
Machunsky, Niklaas (2025): Über Archäos und Neos. Das antisemitische Ressentiment in der Zeitenwende, in: Finkielkraut, Alain: Revisionismus von links. Überlegungen zur Frage des Genozids, Freiburg: ca ira, 147-200.
Majic, Danijel (2025): Empörung über Linksjugend-Post auf X. „Aufruf zum Mord an jüdischen Kindern und Jugendlichen“, in: Hessenschau, 18.08.2025, https://www.hess enschau.de/politik/empoerung-ueber-linksjugend-aufruf-zum-mord-an-juedischen -kindern-und-jugendlichen-v1,antisemitischer-tweet-linksjugend-100.html.
Marx, Karl (1988): Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, in: Marx-En- gels-Werke, Bd. 1, Berlin: Dietz [1843/44], 378-391.
Nietzsche, Friedrich (1955): Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift, in: Nietzsche, Friedrich: Werke in drei Bänden, Bd. II, München: Carl Hanser [1887], 761-900.
Poliakov, Leon (2022): Von Moskau nach Beirut. Essays über die Desinformation, Freiburg: ca ira.
Osten-Sacken, Thomas von (2025): Strohfeuer statt Feuerring. Der Iran hat Schwierigkeiten, seine Milizen zu reaktivieren, in: Jungle World, 28.08.2025, https://jungle.wor ld/artikel/2025/35/iran-achse-des-widerstands-strohfeuer-statt-feuerring.
Rensmann, Lars (2023): Keine Judenfeindschaft:, nirgends? Die „Jerusalemer Erklärung“ und die Antisemitismusforschung, in: Grigat, Stephan/Hoffmann, Jakob/Seul, Marc/Stahl, Andreas (Hg.): Erinnern als höchste Form des Vergessens? (Um-)Deu- tungen des Holocaust und der „Historikerstreit 2.0“. Berlin: Verbrecher, 409-437.
Rensmann, Lars/Stögner, Karin (2024): Politische Dogmen schaden der Aufklärung, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16.06.2024, https://www.faz.net/aktuell/karriere-hochschule/dogmen-der-antisemitismusforschung-eine-replik-auf-uffa-jensen-und -stefanie-schueler-springorum-19779623.html.
Salzborn, Samuel (2018): Globaler Antisemitismus. Eine Spurensuche in den Abgründen der Moderne, Weinheim: Beltz Juventa.
Staffa, Christian (2025): Zwischen Empathie, Solidarisierung und Distanzierung. Kirchliche Israel-Positionierungen und überdauernde Stereotype nach dem 7. Oktober, in: Jikeli, Günther/Glöckner, Olaf (Hg.): Antisemitismus in Deutschland nach dem 7. Oktober, Baden-Baden: Olms, 37-58.
Stögner, Karin (2014): Antisemitismus und Sexismus. Historisch-gesellschaftliche Konstellationen, Baden-Baden: Nomos.
Stögner, Karin (2024): Intersectionality and Antisemitism: A new approach, in: Johnson, Alan (Hg.): Mapping Left Antisemitism: The Fathom Essays, Oxon/New York: Routledge 2024, 282-292.
Stögner, Karin (2025a): Critical Theory of Racism, Antisemitism, and the Demonisa- tion of Israel: Understanding Their Complex Interrelations, in: European Journal of Social Theory, online first (2025), https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1368 4310251323158, DOI: 10.1177/13684310251323158.
Stögner, Karin (2025b): Antisemitism and Sexism after 7 October – the Intersectionali- ty of Ideologies. Robert Fine Memorial Lecture 2024, in: Journal of Contemporary Antisemitism, 8(1), 123-132, https://www.jcajournal.com/open-access-articles.
Tabarovsky, Izabella (2022): Demonization Blueprints: Soviet Conspiracist Antizion- ism in Contemporary Left-Wing Discourse, in: Journal of Contemporary Antisemitism 5(1), https://doi.org/10.26613/jca/5fk97.
Tarach, Tilman (2022): Teuflische Allmacht. Über die verleugneten christlichen Wurzeln des modernen Antisemitismus und Antizionismus, Berlin/Freiburg: Edition Telok.
Uhlig, Tom (2024): Das Gerücht über die Definition, in: Jungle World, 14.11.2024, https://jungle.world/artikel/2024/46/bundestag-resolution-bekaempfung-antisemitismus-das-geruecht-ueber-die-definition.
Ullrich, Peter/Arnold, Sina/Danilina, Anna/Holz, Klaus/Jensen, Uffa/Seidel, Ingolf/ Weyand, Jan (Hg.) (2024): Was ist Antisemitismus? Begriffe und Definitionen von Judenfeindschaft, Göttingen: Wallstein.
Volkov, Shulamit (2000): Antisemitismus als kultureller Code: Zehn Essays, München: C.H.Beck.
Wilf, Einat (2025): Dr Einat Wilf on the Silence after the Sexual Violence of October 7, YouTube, 13.07.2025, https://youtube.com/shorts/E0VOml-EbII?si=V0Hy_vAJdCaab 9ef.