
„Der Tag wird auch kommen, wo wir stolzen Hauptes an unserem geliebten Führer vorbeimarschieren dürfen. Nicht nur in Berlin und auch in Nürnberg werden wir dabei sein, was Heinz, wie denkst du? Aber vorher wird noch reinen Tisch gemacht mit den Bolschewiki-Thommy und dem Erzfeind Juda“, schrieb ein Berliner am 31. Januar 1942 an seinen Freund an der Front und grüßt mit „Heil Hitler, dein Alfred.“ Und ein Feldwebel fragte seine „innnigstgeliebte Frau Lotti“ aus dem besetzten Griechenland: „Hast du auch die Rede des Führers gehört? Er sprach ganz zuversichtlich vom Sieg. Aber auch auf den Untergang der jüdischen Rasse wies er erneut hin. Es ist ein Jammer, wenn man sich überlegt, dass so viele Menschen ums Leben kommen, weil die Profitgier der Juden so groß ist.“
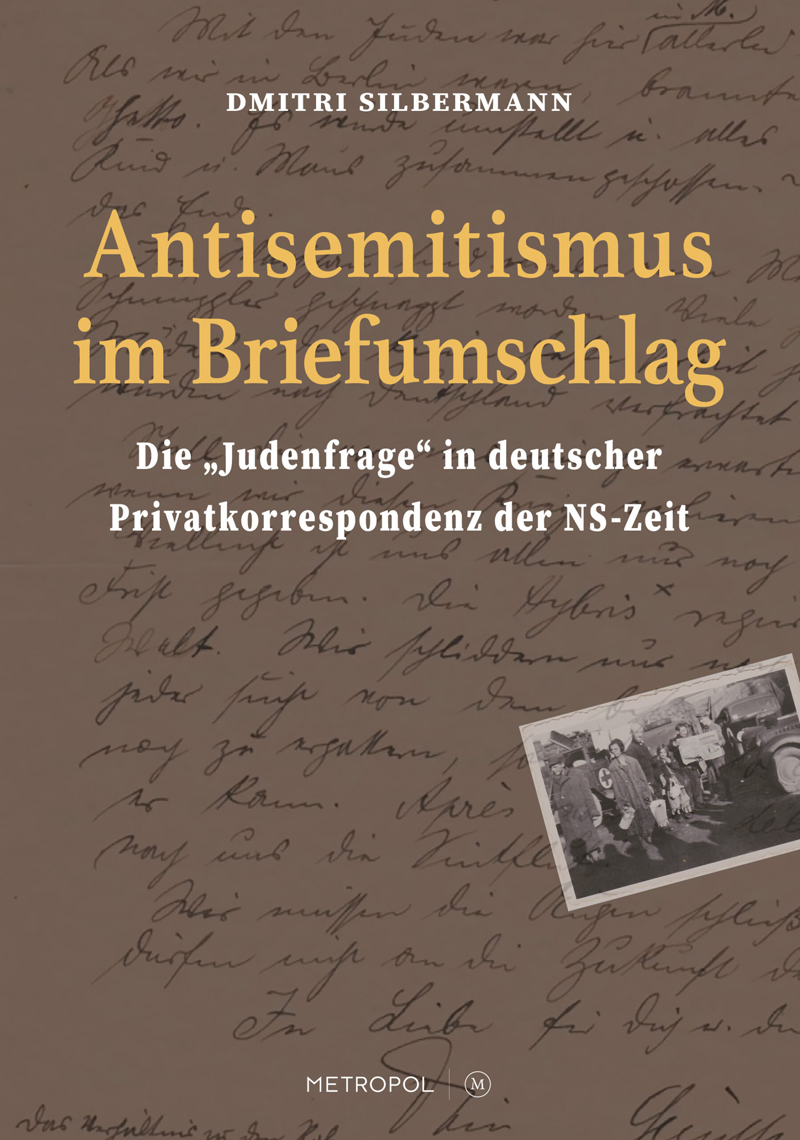 Solche Auszüge aus Briefen dokumentiert der Band Antisemitismus im Briefumschlag. Die „Judenfrage“ in deutscher Privatkorrespondenz der NS-Zeit von Dmitri Silbermann. Neben Schilderungen über die Verpflegung an der Front, den Alltag in der Heimat und Berichten über die Gesundheit der Kinder sowie das eigene Wohlbefinden in „schweren Zeiten“, gepaart mit Erzählungen vom Krieg und den Siegeslauf der deutschen Truppen, enthalten sie auch immer wieder kurze, teilweise auch scheinbar harmlos klingende Äußerungen über die jüdische Bevölkerung und den gerechten Kampf gegen das „Weltjudentum“. Der tief verwurzelte, weitverbreitete, alltägliche Antisemitismus des deutschen Volksgenossen, verpackt in einem herzlichen Gruß an die Lieben. Manchmal waren den Briefen in die Heimat auch Fotografien beigelegt, wie beispielsweise vier verschiedene Bilder auf denen 24 jüdische Männer auf einer Wiese sitzend abgelichtet sind. Die Aufnahmen zeigen zudem, wie ein Mann vor der Gruppe steht und mit einem Ast in der Hand Bewegungen ausführt. Die handschriftlichen Vermerke auf der Rückseite erklären die Szene: „Judenchor in Zvjahel, Dirigent vom Judenchor, morgens gesungen, mittags erschossen“. Im Gegensatz zu den in den Briefen formulierten Verleumdungen, Hetze und Mordphantasien, bei denen die Opfer anonym bleiben, sind sie auf diesen Fotos präsent. „Man sieht ihre Augen, ihre Körperhaltung – sie werden zu konkreten Menschen“, schreibt Silbermann, „wir wissen mit bedrückender Gewissheit, dass sie wenige Stunden später ermordet wurden.“
Solche Auszüge aus Briefen dokumentiert der Band Antisemitismus im Briefumschlag. Die „Judenfrage“ in deutscher Privatkorrespondenz der NS-Zeit von Dmitri Silbermann. Neben Schilderungen über die Verpflegung an der Front, den Alltag in der Heimat und Berichten über die Gesundheit der Kinder sowie das eigene Wohlbefinden in „schweren Zeiten“, gepaart mit Erzählungen vom Krieg und den Siegeslauf der deutschen Truppen, enthalten sie auch immer wieder kurze, teilweise auch scheinbar harmlos klingende Äußerungen über die jüdische Bevölkerung und den gerechten Kampf gegen das „Weltjudentum“. Der tief verwurzelte, weitverbreitete, alltägliche Antisemitismus des deutschen Volksgenossen, verpackt in einem herzlichen Gruß an die Lieben. Manchmal waren den Briefen in die Heimat auch Fotografien beigelegt, wie beispielsweise vier verschiedene Bilder auf denen 24 jüdische Männer auf einer Wiese sitzend abgelichtet sind. Die Aufnahmen zeigen zudem, wie ein Mann vor der Gruppe steht und mit einem Ast in der Hand Bewegungen ausführt. Die handschriftlichen Vermerke auf der Rückseite erklären die Szene: „Judenchor in Zvjahel, Dirigent vom Judenchor, morgens gesungen, mittags erschossen“. Im Gegensatz zu den in den Briefen formulierten Verleumdungen, Hetze und Mordphantasien, bei denen die Opfer anonym bleiben, sind sie auf diesen Fotos präsent. „Man sieht ihre Augen, ihre Körperhaltung – sie werden zu konkreten Menschen“, schreibt Silbermann, „wir wissen mit bedrückender Gewissheit, dass sie wenige Stunden später ermordet wurden.“
Der Autor hat Tausende von Feldpostbriefen, die er auf Flohmärkten und in Antiquariaten gefunden hat, gesammelt und ausgewertet. Eine kleine Auswahl von 307 Briefen, ergänzt um Fotografien und Zeichnungen, liegen nun in Buchform vor. Diese unverfälschten Zeugnisse zu lesen ist keine angenehme Lektüre – sie dokumentieren, wie der deutsche Volksgenosse dachte und fühlte – Empathie war nur selten vorhanden. Meistens gepaart mit Angst: „Stell dir vor, was wir zu erwarten haben, wenn wir diesen Krieg verlieren“, ist in einem Soldatenbrief vom Januar 1943 aus dem besetzten Polen zu lesen. Und ein Jahr später schrieb etwa ein Obergefreiter aus Griechenland an seine „liebe Herz gute Frau, … der Juden Hass ist groß und wenn der zur Geltung käme, das wäre unser Untergang … wie würde es dann ausgehen, wenn der Feind würde Fuß fassen im Vaterland. Wir können eben heute nichts mehr als wie aushalten: bis zum Sieg heißt die Parole und gehe es wie es will.“
Doch bei so manchem blieb der tief verwurzelte Antisemitismus auch nach 1945 erhalten. Ein Militärarzt berichtete etwa in einem Weihnachtsgruß an seine Kollegen: „Ich hause zwischen den Trümmern einer ehemaligen russischen Stadt von 80.000 Einwohnern. Heute vielleicht nicht mehr die Hälfte. Die größere Hälfte befindet sich in Massengräbern, selbst gegraben selbstverständlich.“ Es handelte sich um die Stadt Bobrujsk, in der das Einsatzkommando 8 schon 1941 etwa 20.000 Juden mittels Massenerschießungen ermordet hatte. Nach dem Krieg verunglimpfte der Arzt in seinen Erinnerungen die wenigen Überlebenden der Shoa, die in den DP-Camps Zuflucht fanden, als „schmierige Juden“, die in den deutschen Behörden nun das Sagen hätten.
Die Briefe dokumentieren eindrücklich die antisemitische Überzeugung der Verfasser und ihre damit verbundenen kruden Verschwörungserzählungen. Ihre privaten Vernichtungsphantasien gehörten zum breiten Spektrum der „Judenfrage“ und ihrer „Endlösung“, wie sie in der Normalität des NS-Alltages allgegenwärtig war. Antisemitismus im Briefumschlag vermittelt einen erschütternden Einblick in die dunkle Psyche und die niedrigsten Instinkte der Menschen, die im Nationalsozialismus ihr Heil suchten. – (jgt)
Dmitri Silbermann, Antisemitismus im Briefumschlag. Die „Judenfrage“ in deutscher Privatkorrespondenz der NS-Zeit, Metropol Verlag Berlin 2025, 200 Seiten, 22,00 €, Bestellen?



