|
Europa, Israel und der Nahe Osten
Herausforderung an Europa
Avi Primor
Im Dezember 1994 hat der Europäische Rat, als er unter deutscher
Präsidentschaft in Essen tagte, einen bedeutsamen Beschluss gefasst. Der
Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs kam einstimmig überein,
dem Staat Israel in seinem Verhältnis zur Europäischen Union einen
"privilegierten Status" zuzuerkennen.
Um welche Privilegien in der Neuordnung der Beziehungen zur EU es sich im
einzelnen handeln sollte, welche Bedeutung und Tragweite die Verleihung des
Sonderstatus an Israel für beide Seiten haben, welche Rechte und Pflichten
sich aus ihm ergeben würden und welche Schritte notwendig wären, um den
Beschluss umzusetzen und ihn gewissermaßen mit Leben zu erfüllen - alles
dies blieb vorerst unklar. Fest stand zunächst nur, dass die Entscheidung
zugunsten Israels ohne die sorgfältige Vorbereitung und das beharrliche
Bemühen seitens der deutschen Konferenzteilnehmer wohl kaum zustande
gekommen wäre, jedenfalls nicht zu diesem Zeitpunkt. Bis dahin hatte nur die
Schweiz von einem ihr gleichfalls zugesprochenen privilegierten Status
profitieren können.
Die Beziehungen zwischen Israel und der Europäischen Union nahmen festere
Konturen mit dem Vertrag an, der ein Jahr später, 1995, von Vertretern
beider Seiten unterzeichnet wurde. Lang erwartet und fast schon überfällig,
handelte es sich um die Erneuerung und Ergänzung des
Freihandelszone-Abkommens von 1975. Für Israel, aber auch für die EU stellte
die aktualisierte Fassung der alten Vereinbarungen einen echten Fortschritt
dar. Zum ersten Mal nämlich seit Bestehen der Union verband diese sich auf
dem Gebiet der wissenschaftlichen Forschung und Zusammenarbeit mit einem
Staat, der weder EU-Mitglied war noch zu Europa gehörte. Israel wurde durch
den Vertrag in die Gemeinschaft der EU fast wie ein Mitgliedstaat
einbezogen.
Dennoch gab es, wie gesagt, eine Reihe von Fragen zu klären, auch in
Israel. Ich brauchte mehr als zehn Monate, bis ich dem deutschen
Bundeskanzler die Vorstellungen der israelischen Regierung bezüglich des
1994 zugesagten privilegierten Status ausführlich darlegen und erläutern
konnte. Voraus gegangen waren intensive Verhandlungen mit der Jerusalemer
Regierung. Dabei wurde deutlich, dass Israel, so sehr es die Zuerkennung
eines Sonderstatus begrüßte, eigentlich mehr anstrebte, als der Vertrag von
1975 und das ergänzende Abkommen aus dem Jahr 1995 besagten.
Ein Vertrag gilt gewöhnlich solange, wie beide Parteien daran
interessiert sind. Jeder Übereinkunft, auch wenn sie in bester Absicht und
für längere Zeit geschlossen ist, haftet etwas Vorläufiges, Vorübergehendes
an. Israel wünschte keine nur in Vertragstexten fixierten Vereinbarungen; es
wollte fest in der EU verankert sein, in einer institutionalisierten Art und
Weise und möglichst unabhängig von konjunkturellen Interessen.
Daran, dass eine derart enge Verbundenheit Konzessionen von beiden
Partnern erfordert, besteht kein Zweifel. Im Falle Israels würden sie nicht
nur den Umbau wirtschaftlicher Strukturen bedeuten, sondern auch eine Reihe
von Gesetzesänderungen. Das eine wie das andere ist abhängig von politischen
Kräfteverhältnissen und der Zustimmung einer parlamentarischen Mehrheit: Was
nützt dem Überzeugten der stärkste Wille, wenn er nicht die Macht hat
durchzusetzen, was er für richtig hält? Das etwa war der Grund meiner langen
Verhandlungen mit den Regierungsbehörden in Jerusalem.
Am 1. November 1995 empfing mich Ministerpräsident Jitzhak Rabin. Am
folgenden Tag fand eine Konferenz unter Vorsitz von Außenminister Shimon
Peres statt, an der ranghohe Führungskräfte der israelischen 'Wirtschaft,
der Finanzminister, die Präsidenten der Notenbank und des Industrieverbands
sowie mehrere leitende Beamte teilnahmen. Am Schluss der Gespräche, in denen
ich meine Ideen zur praktischen Ausgestaltung des privilegierten Status
vortrug, erhielt ich grünes Licht, mich offiziell mit detaillierten
Vorschlägen an die Bundesregierung zu wenden. Nach Bonn zurückgekehrt,
machte ich mich sofort an den Entwurf eines Schreibens an Bundeskanzler
Helmut Kohl. Stunden später traf die Nachricht von der Ermordung Jitzhak
Rabins ein.
Nach Rabins Tod hat sich nicht nur die innenpolitische Situation in
Israel geändert, im gesamten Nahen Osten trat eine tief greifende Wende ein.
Nach wie vor aber ist es eines der vordringlichsten Ziele der israelischen
Regierung, den Sonderstatus des Staates Israel im Sinne derer zu nutzen, die
ihn seinerzeit verliehen und verkündet haben. Entsprechende Vorstellungen
sind in dem Brief enthalten, den ich im November 1995 dem deutschen Kanzler
zuleitete.
Das Schreiben nimmt, um Israels Interesse zu erklären, Bezug auf den
europäischen Wirtschaftsraum, wie er von der EU ursprünglich für die
ehemaligen Staaten, der Freihandelsassoziation, der EFTA, geschaffen worden
war, sozusagen als Brücke zum Eintritt in die Union. Praktisch erlaubte der
gemeinsame Wirtschaftsraum den EFTA-Staaten, von den meisten Privilegien,
die den Mitgliedsländern der Union zustanden, zu profitieren, ohne an deren
Entscheidungen verantwortlich beteiligt zu sein. Bei der großzügigen
Regelung konnte aufgrund der geographischen und geschichtlichen Bindungen
von der Annahme ausgegangen werden, der Beitritt der EFTA-Staaten zur Union
werde nur eine Frage der Zeit sein. Abgesehen von nur zwei Ausnahmen, der
Schweiz und Norwegen, sind tatsächlich alle ehemals in der EFTA assoziierten
Länder im Verlauf der neunziger Jahre Mitglieder der EU geworden.
Natürlich kann Israel kein EU-Mitgliedsstaat werden. Die Verfassung der
Union schließt Länder, die außerhalb des europäischen Kontinents liegen, von
der Aufnahme aus. Auch kann Israel sein Verhältnis zur EU nicht einfach
dadurch definieren, dass es Anspruch auf Teilhabe an einem Wirtschaftsraum
erhebt, wie er 1960 für die EFTA-Staaten eingerichtet wurde. Das alte Modell
könnte allenfalls richtungweisend wirken, kann nicht aber das mit einem
Anschluss an die Union erstrebte letzte Ziel sein. Vorgetragen wurde statt
dessen der Wunsch Israels, an den vier grundsätzlichen Freiheiten der
EU-Mitgliedsstaaten partizipieren zu dürfen: der Freiheit des Verkehrs von
Menschen, des Warenverkehrs, der Investitionen sowie sämtlicher
Dienstleistungen innerhalb der Union.
Natürlich wird sich dieses Wunschziel nicht von heute auf morgen
erreichen lassen; der Weg dorthin setzt politischen Willen auf beiden Seiten
voraus. Immerhin ist Israel vorerst schon mit der EU durch ein umfassendes
und neuen Entwicklungen angepasstes Freihandelszone-Abkommen verbunden.
Außerdem ist es Teil der Wissenschafts- und Forschungsgemeinschaft der
Europäer. In beiden Bereichen sind in den letzten Jahren Fortschritte
erzielt worden, die insgesamt auf noch engere und stärker erweiterte Formen
der Zusammenarbeit hoffen lassen, gerade auch auf wirtschaftlichem Gebiet.
Schon das bisher Erreichte sehen die meisten Israelis keineswegs als
selbstverständlich an.
Das Gefühl der Enttäuschung
Die weit verbreitete Ansicht, die Israelis seien ein kulturell stark
europäisch geprägtes Volk, sie seien überhaupt "ursprünglich" Europäer,
trifft nur bedingt zu, denn ein Großteil der israelischen Bevölkerung hat
seine Wurzeln nicht in Europa, sondern in islamischen Ländern. Und gerade
die Israelis europäischer Herkunft waren es, die sich zunächst am wenigsten
eine Vertiefung der Beziehungen zwischen ihrem Staat und der Europäischen
Union vorstellen konnten oder auch - eingedenk gewisser Erfahrungen -
vorstellen wollten. So kam es, dass sich viele Israelis nach der
Staatsgründung von Europa abwandten, insbesondere auch die von dort
stammenden, die damals die große Mehrheit der Bevölkerung bildeten. Die
Ursachen lagen teilweise weit zurück, teils bestanden sie aus jüngeren
Einzelschicksalen oder wenigstens aus deren Kenntnis. Erinnerungen an
positive Erfahrungen, die immerhin auch zur jüdischen Geschichte in Europa
gehören, verblassten, insgesamt überwog das Gefühl der Enttäuschung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg, noch unter dem Schock des Holocaust, kehrten
in Israel die alten Konflikte mit den Engländern zurück. Sie wirkten
bedrückend, zumal sich herausstellte, dass die gemeinsame Gegnerschaft gegen
Nazi-Deutschland nur kurzzeitig von den Ursachen der früheren Fehden
abgelenkt hatte, ohne das gespannte Verhältnis zwischen der britischen
Mandatsmacht und der jüdischen Bevölkerung Palästinas auch nur im
Entferntesten zu ändern. Sobald der Krieg vorbei war, brachen die Gegensätze
wieder auf. Tatsächlich haben die Briten sich als stärkste Widersacher des
entstehenden jüdischen Staates erwiesen, ganz offensichtlich vor allem in
der Behinderung der Hilfe für überlebende KZ-Opfer. Selbst nach dem Abzug
ihrer Truppen aus Palästina nahm die Regierung in London gegenüber Israel
noch jahrelang eine betont zurückhaltende, wenn nicht feindselige Haltung
ein.
Wenig ermutigend im Blick auf eine im Geist freundschaftlicher
Verständigung gestaltete Zukunft hat sich auch das Verhältnis zu anderen
europäischen Staaten entwickelt. Kurze Flitterwochen mit der Sowjetunion
nach dem Zweiten Weltkrieg gingen alsbald in erbitterte Feindschaft über,
und die anfangs erfreuliche Zusammenarbeit mit Frankreich erlitt 1967 einen
Bruch, der lange fortwirkte. Auch er trug dazu bei, dass Israel sein
Interesse an allem, was mit Europa zusammenhing, weitgehend verlor, sich
enttäuscht von der Alten Welt ab- und vermehrt den Vereinigten Staaten
zuwandte.
Ein Leidensweg führt durch Europa
An diesem Prozess, der sich über längere Zeit hinzog, war zweifellos auch
das Geschichtsbild beteiligt, mit dem jedes israelische Schulkind aufwächst.
Es ist, unter anderem, das Bild der sich über die zweitausend Jahre des
Exils erstreckenden Geschichte des eigenen Volkes mit den immer
wiederkehrenden Epochen der Erniedrigung und Vertreibung, die wiederum Teile
der europäischen Geschichte sind. Der längste und qualvollste Leidensweg,
den die Juden zurücklegten, führt durch Europa. Er beginnt nicht erst mit
den Kreuzfahrern, die im 11. Jahrhundert aufbrachen, um das Heilige Land von
den Moslems zu befreien und deren Hass auf "Ungläubige" so zügellos war,
dass sie ihn unterwegs schon an Juden ausließen. Die ältesten jüdischen
Gemeinden in Deutschland - Mainz, Speyer und Worms - verloren durch
blindwütige Gemetzel Tausende ihrer Mitglieder. Gelegentlich versuchten
Bischöfe und Kardinale, dem Morden Einhalt zu gebieten und verfolgte Juden
zu schützen, die gewöhnliche Priesterschaft dagegen hat die grausamen
Ausschreitungen gegen Wehrlose eher noch geschürt.
Nicht sehr viel glimpflicher ist, was das Schicksal der hier ansässigen
Juden angeht, die europäische Geschichte der folgenden Jahrhunderte
verlaufen. Kaum hatten sich irgendwo mit Genehmigung der jeweiligen Städte
und Landesherren jüdische Gemeinden gebildet, wurden sie wieder aufgelöst,
ihre Angehörigen für rechtlos erklärt und ausgewiesen. Obwohl in ihrem
Gastland total integriert, musste gegen Ende des 15. Jahrhunderts die auf
ihre Anerkennung stolze jüdische Gemeinschaft in
Spanien die Heimat verlassen.
Bleiben durfte nur, wer sich taufen ließ, der Übertritt zum Christentum aber
bewahrte die Zurückgebliebenen keineswegs vor den Schrecken der Inquisition:
Konvertiten machten sich der Glaubensunehrlichkeit verdächtig, des
heimlichen Praktizierens ihrer früheren Religion.
In der
Ukraine gilt Bogdan Chmelnizkij heute noch als Volksheld, weil er
mit seinen Kosaken erfolgreich gegen Polen zu Felde zog und 1654 die
Vereinigung seines Landes mit Russland erreichte. Dass er auch als einer der
berüchtigtsten Judenverfolger in die Geschichte einging, hat Chmelnizkijs
Ruhm jahrhundertelang kaum geschmälert. Dabei hatten die Juden, die zu
Tausenden ermordet wurden, mit der Fehde zwischen den Polen und Ukrainern
nicht das geringste zu tun, denn im Grunde ging es um einen Glaubenskampf
zwischen der römisch-katholischen und der griechisch-orthodoxen Kirche. Der
Hass, den auch die
Polen
auf die Juden ausweiteten, machte vor keinem Ghetto und keiner Synagoge
halt.
Als zweihundert Jahre später der Ausbruch der
Französischen Revolution
Europa erschütterte, wirkte er auf die meisten Juden wie ein großer,
gewaltiger Befreiungsschlag. Die Hoffnungen jedoch, die das Ereignis weckte,
hielten der Wirklichkeit nicht lange stand. Die öffentlich verkündete
Emanzipation scheiterte allzubald an der Hartnäckigkeit alter Vorurteile,
eine neue judenfeindliche Front formierte sich, ein Rassismus namens
Antisemitismus, der sich in den Gehirnen festsetzte und sie anfällig machte
für absurde Ideen, die das traditionelle, religiös motivierte Feindbild
ergänzten. In
Osteuropa
zumindest gehörten tätliche Judenverfolgungen weiterhin zum Alltag.
In unserem Jahrhundert dann der
Holocaust, die größte, furchtbarste Tragödie in der Geschichte der
Juden. Der millionenfache Mord wurde zwar von Deutschen initiiert und mit
deutscher Gründlichkeit durchgeführt, er fand aber in allen von den Nazis
besetzten Ländern erschreckend viele Mithelfer, die ihr Werk mit
Leidenschaft betrieben.
Drei weniger schwerwiegende, über längere Zeit aber gleichfalls als
typisch empfundene Schlüsselerfahrungen, die das Europabild der Israelis
trübten, wurden schon genannt; die unselige
Einwanderungspolitik der Engländer
nach dem Zweiten Weltkrieg in Palästina, das Zerwürfnis mit der
Sowjetunion und die Abkühlung der Beziehungen mit Frankreich. Im
Rückblick wird man sich vor einer Überbewertung des einen oder anderen
dieser Vorgänge und seiner Folgen hüten müssen, wie ja auch keineswegs nur
negative Eindrücke aus früheren Jahrhunderten der jüdischen Diaspora in
Europa ihre Spuren im kollektiven Gedächtnis der Israelis hinterlassen
haben. Oberhand aber behielt letztlich doch das Wissen um die dunkelsten
Perioden in der Leidensgeschichte der europäischen Juden - ein sich über
Generationen fortsetzendes Trauma, das zur allmählichen Abkehr von Europa
beitrug, während das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten sich in gleichem
Maß enger und freundschaftlicher gestaltete.
In den ersten Jahren nach der Staatsgründung Israels ließ sich dieses
Verhältnis durchaus nicht so einträchtig an. Gelegentlich, wenn auch nicht
offiziell, wurde Israel sogar von den USA boykottiert. Erst nach dem
Sechstagekrieg,
1967, genau zu dem Zeitpunkt, als sich die Beziehungen zu Frankreich
merklich abkühlten, setzte jene Vertiefung der Kontakte ein, die seither
allen Belastungsproben standgehalten hat. Es sind auf politischer Ebene die
bei weitem wichtigsten Kontakte, die Israel nach außen unterhält. Ihres
besonderen Ranges ist sich denn auch jeder israelische Bürger bewusst, der
sogenannte einfache Mann auf der Straße ebenso wie der Wissenschaftler,
Techniker und Intellektuelle.
Israelische Hochschullehrer halten einen Aufenthalt in den USA für einen
unverzichtbaren Markstein ihrer Karriere. Als ich nach meiner Wahl zum
Vizepräsidenten der Hebräischen Universität in Jerusalem eine Namensliste
jener Professoren erhielt, die damals, 1991, ein sogenanntes Sabbatjahr im
Ausland verbrachten, stellte ich fest, dass es unter 130 Lehrkräften nur
zwei gab, die es im Unterschied zu den übrigen 128 nicht nach Amerika
gezogen hatte, und auch diese beiden hielten sich nicht in Europa auf,
sondern sonstwo auf der Welt. Es mag Zufall gewesen sein, dass die Zahl
derer, die sich für ein Jahr in die USA verabschiedet hatten, so extrem hoch
lag; typisch für die Stimmung an den Hochschulen und die allgemeine
Hinwendung zu Amerika aber war sie allemal. Dorthin richteten sich die
Blicke aller, denen neben der eigenen Zukunft auch die ihres Landes am
Herzen lag. Überall, in jedem Berufszweig, interessierte man sich fast nur
noch für parallele Entwicklungen und deren Neuerungen in der weltstärksten
Handels- und Industrienation.
Der Tourismus von
Israel in Richtung Europa blieb davon weitgehend unberührt. Dafür sorgten
wohl auch die im Vergleich zu den USA geringeren Entfernungen und die
entsprechend niedrigen Reisekosten, aber es fiel auf, dass die Besucher aus
Israel nur wenig Interesse für das wirkliche Europa zeigten, für den Alltag
der Völker, für aktuelle politische Fragen und Meinungstrends. Eher schien
es, als bewegten die Reisenden sich in einem Museum oder einem Kasino.
Die allzu einseitige Ausrichtung nach Amerika als dem vermeintlich
einzigen Zentrum der Welt wurde weder den Realitäten in Israel noch den
eigentlichen Interessen des jungen Staats gerecht. Wirkliche Bedürfnisse
kamen zu kurz, und die Lösung künftiger Entwicklungsaufgaben konnte man
nicht allein der eigenen Kraft und der Hilfe des großen Bruders überlassen.
Was fehlte, war eine ähnlich starke Annäherung an Europa, eine Orientierung
Israels auch an der Alten Welt, möglichst auf der Basis wechselseitiger
Beziehungen. An Ansatzpunkten dazu herrschte kein Mangel, und das gilt auch
heute noch.
Es wird oft leicht vergessen, dass Israel jahrzehntelang um seine
Akzeptanz in der Völkergemeinschaft kämpfen musste, teilweise sogar heute
noch um internationale Anerkennung ringt. Im Gegensatz zu fast allen anderen
Staaten, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit erlangten, fiel
Israel die Souveränität nicht wie selbstverständlich zu. Es war schwierig
genug, Regierungen in aller Welt davon zu überzeugen, dass an dieser
Souveränität nicht zu rütteln war, allen Zweifeln und Vorbehalten zum Trotz.
In den fünfziger Jahren bemühte Israel sich um die Aufnahme diplomatischer
Beziehungen zu Ländern wie Birma oder Ghana, um gleichzeitig feststellen zu
müssen, dass es solche Beziehungen noch nicht einmal mit allen
westeuropäischen Staaten unterhielt: Weder mit Spanien und Portugal noch mit
Griechenland war damals dieses offizielle Netz schon geknüpft, auch nicht
mit Deutschland. Dabei konnte Israel wegen des Belagerungszustands, in dem
es sich befand, auf die Solidarität Westeuropas nicht verzichten. Von den
kommunistisch beherrschten Ländern weitgehend isoliert, von den islamischen
bekämpft und von der Dritten Welt größtenteils boykottiert, musste es sich
von der Vorstellung lösen, die Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten
allein genüge als Garantie für seine Zukunft.
Die Notwendigkeit, Brücken auch nach Westeuropa zu schlagen, wurde in
Israel von niemandem ernsthaft bestritten. Die Frage war nur, welchen Rang
diese Verbindungen erhalten, wie umfassend und tragfähig sie sein sollten.
Sofern man sich über die Art der Konstruktion überhaupt Gedanken machte,
dachte man mehr an eine beiläufige, oberflächliche Form der Zusammenarbeit.
In geradezu visionärer Vorschau aber erkannten bereits in den fünfziger
Jahren einige wenige Fachleute, welche Entwicklungen sich in Europa
anbahnten und welcher Wert ihnen im Hinblick auf Israels Rolle in einer sich
zunehmend rascher verändernden Welt beizumessen sei. Sie beobachteten das
schrittweise Entstehen der Europäischen Gemeinschaft und zogen daraus die
richtigen Schlüsse. Ihnen wurde klar, welche Chance die künftige EG für
Israel darstellte, welche wirtschaftlichen und außenpolitischen
Stabilisierungspotentiale sie einmal anzubieten hätte, allerdings auch,
welches Maß an Risiken in einer künftigen Zusammenarbeit steckte, falls sie
zustande kommen sollte. Auf jene wenigen vorausblickenden Experten wirkte
das Zusammenwachsen der Gemeinschaft, zumal in der noch embryonalen Phase,
wie ein verheißungsvolles Signal.
Mitunter meint es die Geschichte gut mit einem Volk, indem sie ihm
Persönlichkeiten mit Instinkt und Weitblick schenkt, Wegweiser in die
kommenden Jahrzehnte. Mit Beharrlichkeit gelingt es ihnen, die Regierung und
Bevölkerungsmehrheit ihres Landes auf Bahnen zu führen, deren Verlauf kaum
überschaubar, ja letztlich so ungewiss ist wie das Ziel, das auch jene
wenigen nur mehr ahnen als kennen. Im allgemeinen wurden Nachrichten, die
das Entstehen der EG betrafen, in Israel zunächst mit ziemlicher
Gleichgültigkeit behandelt, man nahm sie zwar zur Kenntnis, legte ihnen aber
selbst in Regierungskreisen keine größere Bedeutung bei. Das änderte sich
erst, als die Regierung in Jerusalem sich von Experten bewegen ließ, die
Vorgänge in Europa aufmerksamer zu verfolgen.
1958, als die Römischen Verträge von den Parlamenten der sechs
Gründerstaaten "der EG gebilligt worden waren, nahm Israel mit der
Gemeinschaft diplomatische Beziehungen auf. Nur zwei weitere Staaten
unternahmen damals den gleichen Schritt: Griechenland, das ernsthaft einen
Beitritt zur Gemeinschaft anstrebte, und die Vereinigten Staaten, die als
größte Weltmacht dafür bekannt waren, dass sie ohne Zögern diplomatisch
anerkannten, was sich auf der Erde an Neugründungen auch nur regte und
bewegte. Die meisten Staaten, die heute der EU angehören, haben der
Gemeinschaft seinerzeit ihre Anerkennung versagt, sie im Gegenteil sogar
teilweise zu bekämpfen versucht. So war die 1960 gegründete
Freihandelsassoziation, die EFTA, den Bestrebungen der im Entstehen
begriffenen EG deutlich entgegengerichtet.
Großbritannien, das zur Freihandelsassoziation gehörte, erwies sich als
besonders hartnäckiger und kompromissloser Gegner der Gemeinschaft.
Natürlich wurde es zur Teilnahme an den Verhandlungen geladen, die dem
Abschluss der Römischen Verträge vorausgingen, von Anfang an aber ließen die
Briten nicht den geringsten Zweifel an ihrer tiefen Abneigung gegen das
geplante Vertragswerk. Ein Zeuge, Jean-Francois Deniau, der 1956 auf
französischer Seite an den Verhandlungen teilnahm, erinnert sich an seinen
britischen Kollegen: "Nie hat der würdige Vertreter des Vereinigten
Königreichs während der Verhandlungen seinen Mund aufgemacht, es sei denn,
um sich eine Pfeife anzustecken. Endlich - eines Tages und zur Überraschung
aller Beteiligten bat er um das "Wort, und das auch nur, um eine kurze
Abschiedsrede zu halten. Er sagte: "Herr Vorsitzender, meine Herren, ich
möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken und Ihnen versichern, dass
sie ab heute beendet sein wird... Ich habe mit Interesse Ihre Arbeit
verfolgt, und ich muss Ihnen sagen, dass der künftige Vertrag, von dem Sie
sprechen und von dem Sie die Pflicht haben, ihn zu entwerfen, a) keine
Chancen hat, jemals vollendet zu werden; b) wird er trotzdem vollendet, hat
er keine Chance, gebilligt zu werden; c) wird er gebilligt, hat er keine
Chance, in die Tat umgesetzt zu werden. Wäre es trotzdem so, würde er auf
jeden Fall für Großbritannien vollkommen inakzeptabel sein". Deniau erwähnt
auch die öffentliche Erklärung eines britischen Ministers, der an den
Verhandlungen teilnahm. Nach dessen Ansicht handelte es sich bei dem Plan
zur Schaffung einer europäischen Gemeinschaft im Grunde um das Werk von
Besiegten. Unter denen habe aber England nichts zu suchen. Statt den
Widerstand gegen die Europäische Gemeinschaft aufzugeben, verstärkten die
Briten ihr Engagement in der EFTA, vornehmlich auf die Wahrung ihrer
nationalen Interessen bedacht.
Um so höher muss man wohl, gerade aus heutiger Sicht, den nüchternen
Realitätssinn jener Israelis einschätzen, die trotz starker gegenläufiger
Strömungen im eigenen Land in der Verbindung zur EG große wirtschaftliche
Entwicklungsmöglichkeiten für ihren Staat sahen. Zunächst erhofften sie sich
eine durchgreifende Modernisierung der Wirtschaft und eine gesellschaftliche
Liberalisierung. Unter dem Einfluss sozialistischer Ideen und infolge des
permanenten Kriegszustands hatte sich in Israel nicht nur eine
zentralistische Wirtschaftsform, sondern auch eine ähnlich konzentriert
gesteuerte Verwaltungsbürokratie etabliert, Systeme, die eine Zeitlang und
bis zu einem gewissen Maß zweckmäßig, vielleicht sogar unentbehrlich gewesen
waren, sich aber zunehmend als Hemmnisse für die freie Entfaltung
innovativer Kräfte herausstellten. Die Bevölkerung hatte sich an die
vermeintlichen Segnungen des Zentralismus gewöhnt; sie war weder willens
noch praktisch in der Lage, sich über kurz oder lang auf alternative
Experimente einzulassen. Auf die erstarrten, blockierenden Strukturen des
Zentralismus ließ sich Erfolg versprechend nur von außen einwirken. Nicht
als Patentrezept, wohl aber als ein sicherlich hilfreiches Mittel erschien
ihren Befürwortern eine enge Zusammenarbeit mit der Europäischen
Gemeinschaft.
Die Zukunft hat bestätigt, dass die Visionäre von damals keinen falschen
Vorstellungen folgten. Ihr Kalkül erwies sich als zutreffend, auch im
Hinblick auf die erwarteten positiven Folgen der Partnerschaft mit der EG
für Reformen in Israel. Die Wirkung glich in etwa derjenigen, die in den
letzten beiden Jahren in Italien im Zusammenhang mit dem Streit um die
Kriterien der Aufnahme in die Währungsunion eingetreten ist. Mahnende
Hinweise vor allem von Seiten der Bundesrepublik, Italien müsse zunächst
Ordnung in seine Finanzen und seine Verwaltung bringen, bevor man über die
Einbeziehung des Landes in die geplante Gemeinschaft entscheiden könne,
fanden durchaus Gehör; Italien aber mahnte seinerseits: Erst wenn es
überzeugende Beweise dafür gebe, dass man Italiens Mitgliedschaft wirklich
und uneingeschränkt wolle, werde sich die gewünschte Ordnung herstellen
lassen. Das eine wie das andere ist inzwischen geschehen. Nach gelungenen
Reformen, die manche für ein Wunder halten, steht dem Anschluss Italiens an
die Währungsunion nichts mehr im Wege. Um die Maastrichter Kriterien
erfüllen zu können, bedurfte es nur eines nachdrücklichen Vertrauensschubs.
Seit es 1958 diplomatische Beziehungen mit der EG aufgenommen, 1964 mit
ihr das erste Handelsabkommen unterzeichnet und 1975 nach mehrjährigen
Verhandlungen den begehrten Freihandelszone-Vertrag geschlossen hat, nimmt
Israel unter den Vertragspartnern der Gemeinschaft eine Sonderrolle ein. Sie
beruht nicht nur darauf, dass Israel als nichteuropäisches Land und ohne
Mitglied der EG zu sein dennoch eng mit ihr verbunden ist. Entscheidend ist
vielmehr das Prinzip vollkommener Gegenseitigkeit, auf das sich das Abkommen
über die Freihandelszone gründet. Später geschlossene EG-Verträge mit
anderen Staaten, auch mit solchen im Mittelmeerraum, enthalten Bestimmungen,
die diesem Prinzip nicht entsprechen.
Der Vertrag mit Israel verfolgt mit der Aussicht auf alle Vorteile für
beide Seiten nicht allein wirtschaftliche Ziele. Die EG hat zwar von
Vorteilen profitiert, die ursprünglich nicht einkalkuliert waren, die
Überlegungen jedoch, die zum Abschluss der Vereinbarungen führten, waren
überwiegend politischer Art. Obgleich die EG sich von Anfang an als
europäische Wirtschaftsmacht verstand und diese Funktion auch bis heute
erfüllt, ließen sich ihre Gründungsväter hauptsächlich von gemeinsamen
politischen Überzeugungen leiten. Kriege auf dem Kontinent sollten künftig
verhindert, Konflikte friedlich beigelegt, äußere Sicherheit durch ein enges
Verteidigungsbündnis gewährleistet werden. Kurz nach dem Zweiten Wellkrieg
standen die europäischen Völker Plänen zu einer derartigen Gemeinschaft
größtenteils ablehnend, zumindest skeptisch gegenüber. Das Fernziel der
politischen Einigung versuchte man deshalb zunächst mit der schrittweisen
Errichtung eines gemeinsamen Marktes anzusteuern. Jeder weiß im übrigen,
dass in aktuellen wirtschaftlichen Beschlüssen, die die EU betreffen, fast
immer auch politische Erwägungen zum Tragen kommen, die wiederum nicht
unbeeinflusst sind von der jeweiligen öffentlichen Meinung.
Mit dem Abschluss des Freihandelszone-Abkommens gewann der Handelsverkehr
zwischen den EG-Staaten und Israel neuen Auftrieb. Ende der siebziger Jahre
umfasste er in beide Richtungen vierzig Prozent von Israels Welthandel, ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Ein- und Ausfuhr, das sich damals aber
schon merklich verschlechterte: Israel importierte zunehmend aus der EG,
konnte aber seinen Export dorthin so gut wie nicht ausbauen. Heute liegt die
Ausfuhr von Waren und Gütern - Dienstleistungen ausgeklammert - bei kaum elf
Milliarden Mark pro Jahr, während die jährliche Wareneinruhr aus den
fünfzehn EU-Ländern einen Wert von 25 Milliarden Mark ausmacht. Das große
Handelsdefizit lässt sich nur ertragen, weil Israel im Verkehr mit anderen
Staaten Überschüsse erzielt, besonders in Geschäften mit den Vereinigten
Staaten, aber auch im Handel mit einem Land wie Japan, das aus Israel sogar
Komponenten der Hochtechnologie bezieht.
Der Handelsverkehr, den Israel betreibt, hat in den letzten Jahren weiter
zugenommen und erreichte mittlerweile Dimensionen, die - gemessen an der
geringen Größe des Landes - gewaltig sind. Vom Gesamtvolumen, 94 Milliarden
Mark, entfallen 66 Prozent auf den Handel mit der Europäischen Union.
Gegenüber den siebziger Jahren stark gewachsen ist allerdings auch das
Außenhandelsdefizit im Warenaustausch mit der Europäischen Union, der
ehemaligen EG. Zum Teil geht es auf die Unausgewogenheit der Bilanz des
Handels mit Deutschland zurück, teilweise war es das Ergebnis von Lücken,
Versäumnissen und korrekturbedürftigen Formulierungen des Vertrags aus dem
Jahr 1975.
Globalisierung
Seit Israel damals das Freihandelszone-Abkommen unterzeichnete, hat nicht
nur die Europäische Gemeinschaft eine andere Gestalt angenommen. Verändert
hat sich die gesamte Weltlage, mit dem Wegfall alter Märkte und dem
Entstehen neuer Absatzgebiete auch das Kraftfeld, in dem sich
wirtschaftliche Entwicklungen vollziehen. Neue Technologien haben in den
letzten zwei, drei Jahrzehnten zur weiteren Internationalisierung der
Finanz- und Handelsbeziehungen beigetragen; "Globalisierung", auf die
Wirtschaft gemünzt, ist das Stichwort für den Wandel herkömmlicher, allzu
vertrauter Strategien.
Das Abkommen von 1975 sollte regelmäßig aktualisiert werden, die
Anpassung unterblieb jedoch aus politischen Gründen. Israels Situation war
gegen Ende der siebziger und während der achtziger Jahre alles andere als
beneidenswert. Die Folgen des Jom-Kippur-Krieges 1973, die Ölkrise, der
anhaltende Druck der arabischen Staaten, die dank ihrer Ölvorkommen weit
selbstbewusster und anspruchsvoller als früher auftraten, letztlich auch die
Intifada - alles dies brachte Israel in Bedrängnis, verschaffte ihm
wirtschaftliche Nachteile und schwächte hier und da auch sein politisches
Ansehen in der internationalen Völkergemeinschaft. Der jüdische Staat verlor
an Durchsetzungskraft. Die Positionen, die er vor einem günstigen
Zeithintergrund einmal hatte einnehmen können, begannen Schaden zu nehmen.
Der Vertrag, der Israel an der EG-Freihandelszone beteiligte, erwies sich
nach einiger Zeit als überholt; die Vorteile, die er zunächst geboten hatte,
verringerten sich mehr und mehr. Die Folge war, dass sich das Defizit im
Handelsverkehr mit den Europäern zunehmend vergrößerte.
Ein rein technischer Ergänzungsvertrag mit dem EG-Ministerrat, den ich
1987 als Botschafter in Brüssel unterzeichnete, war das Ergebnis intensiver
Verhandlungen. Der Eintritt Spaniens und Portugals in die Gemeinschaft im
vorausgegangenen Jahr erforderte einige Änderungen des Vertrags von 1975.
Die notwendige Billigung dieser Änderungen durch das Europäische Parlament
war jedoch unversehens in Frage gestellt, als im Dezember 1987 die Intifada
losbrach, der Aufstand der Palästinenser in den israelisch besetzten
Gebieten. Schon in den vorausgegangenen Jahren, vor allem nach dem
Libanon-Krieg 1982, hatte sich unter den Europa-Abgeordneten eine von
Zweifeln und Misstrauen genährte Stimmung gegen Israel bemerkbar gemacht,
die sich nun, mit dem Beginn der Unruhen, derart verschärfte, dass die
Billigung des Vertrags durch das Parlament nicht mehr gewährleistet schien.
Erst in den folgenden zehn Monaten gelang es, die Bedenken auszuräumen und
eine Abstimmungsmehrheit für die notwendigen Ergänzungen zu sichern. Unter
den gegebenen Umständen bestand jedoch kaum Hoffnung auf künftige
Verhandlungen mit dem Ziel, den Vertrag fortlaufend den jeweiligen
Erfordernissen anzugleichen.
Oslo
Erst 1991, während des Golfkriegs, setzte ein allgemeiner Stimmungswandel
zugunsten Israels ein. Um die westlich orientierte arabische Allianz nicht
zu gefährden, ergriff die Regierung in Jerusalem weder Vorbeugungs- noch
Vergeltungsmaßnahmen gegen den Irak, der Israel aus einer Entfernung von
tausend Kilometern mit Raketen beschoss. Die bewusste Zurückhaltung zahlte
sich aus, auch im Hinblick auf das Verhältnis zu den Europäern. Der
Gemeinschaft war sehr an der Teilnahme an der sich relativ früh
abzeichnenden Friedenskonferenz gelegen, sie benötigte dafür aber die
Zustimmung aller Partner, einschließlich Israels. So gewann der Dialog
zwischen verschiedenen Gremien der EG auf der einen Seite und Israel auf der
anderen allmählich wieder an Inhalt. Auf einer vollkommen
sachlich-konstruktiven Ebene wurden dann die Verhandlungen gerührt, die mit
den Gesprächen in Oslo begannen. Auch das Abkommen, das 1995 die zwanzig
Jahre zuvor geschlossenen Vereinbarungen über die Freihandelszone ergänzte
und aktualisierte und Israel in die europäische Wissenschafts- und
Forschungsgemeinschaft einband, kam im Geist gegenseitiger
Verständigungsbereitschaft und einhelligen Vertrauens zustande.
Leider war der Zustand, der mit dem Abkommen erreicht war, nur von kurzer
Dauer. Nach der Welle der Terroranschläge, unter der Israel Anfang 1996 zu
leiden hatte, und dem folgenden Regierungswechsel geriet der Friedensprozess
im Nahen Osten ins Stocken. Daraus ergaben sich Belastungen für das
Verhältnis zu den europäischen Partnern, zeitweilige Spannungen,
Verstimmungen und Irritationen auf beiden Seiten. Zwar ist in der EU das
Verfahren, das der Billigung des Abkommens vorauszugehen hat, nicht
unterbrochen worden, doch ruht seither die Diskussion über die inhaltliche
wie auch praktische Erfüllung des privilegierten Status, der Israel 1994 vom
Europarat zuerkannt worden ist. Allerdings wird es sich hier nur um eine
Pause handeln. So unumkehrbar, trotz aller Unterbrechungen und Krisen, der
Friedensprozess im Nahen Osten ist, so sehr darf man hoffen, dass die
Beziehungen Israels zur Europäischen Union sich weiter verfestigen werden.
Was erwartet Israel von der Union?
Was erwartet Israel von der Union, welche Rolle, welche Aufgaben sollten
oder könnten die Europäer im Nahen Osten übernehmen? Verträge allein reichen
nicht aus, um den Beziehungen zwischen Israel und der EU künftig den
erforderlichen Rückhalt zu geben und dem Verhältnis Dauer und Stabilität zu
garantieren. Alle Übereinkünfte spiegeln zeitbedingte und zeitlich begrenzte
Interessen und so allgemeine Erwartungshaltungen wider wie den Wunsch,
bisherige Beziehungen zu beiderseitigem Nutzen fortzusetzen, miteinander auf
irgendwelchen Gebieten zu kooperieren, einvernehmlich Konfliktlösungen
anzustreben und dergleichen mehr. Seine offizielle Laufzeit ändert nichts
daran, dass ein Vertrag nur solange in Kraft bleibt, bis er zumindest für
einen der Partner keine Bedeutung mehr hat. Die vereinbarten Rechte und
Pflichten gelten dann mit der Sache, auf die sie sich beziehen, als
überholt.
Israel wird, wenn es mit seinen Nachbarn, die Palästinenser
eingeschlossen, endgültig Frieden geschlossen hat, ein anderer Staat sein
als heute. Worin er sich vom gegenwärtigen unterscheiden wird, lässt sich
kaum voraussagen; nach einem mehr als fünfzigjährigen Kriegszustand lässt
sich über das künftige friedliche Zusammenleben ehemals verfeindeter Völker
nur spekulieren. Eines aber ist heute schon gewiss: Um ihres Bestandes
willen muss jede Friedensregelung auf die elementaren Bedürfnisse der Völker
abgestimmt sein. Für Israel bedeutet dies, dass es offene Grenzen
garantieren, diplomatische Beziehungen zu den Nachbarn unterhalten,
ungehinderten Tourismus ermöglichen und, nicht zuletzt, Projekte entwickeln
wird, deren Realisierung in gegenseitigem Interesse liegt.
Die Israelis sind allerdings ein kleines und eigenständiges Volk,
angesiedelt inmitten einer Region, die von mehreren Völkerschaften mit
gemeinsamer Geschichte, Religion und Sprache bewohnt ist, ethnisch und
kulturell zusammengehörig und mit ähnlich stark ausgeprägten
Lebensgewohnheiten, wie sie der Bevölkerung des jüdischen Staates eigen
sind. Die Unterschiede lassen sich nicht einfach ignorieren. Israel wird
eines Tages mit den insgesamt um vieles größeren übrigen Staaten des Nahen
Ostens friedlich und gedeihlich zusammenarbeiten. Allerdings wird es seine
Identität und kulturelle Eigenständigkeit wahren müssen, ebenso sein
wirtschaftliches Niveau und seinen hohen Entwicklungsstand im Bereich der
Technologie und der wissenschaftlichen Forschung. Ein zugegeben schwieriges
Problem, an dem aber kein Weg zum Frieden vorbeirührt.
Andererseits können sich heute selbst erheblich größere Länder als Israel
nicht der Einsicht verschließen, dass ihr Kräftepotential zu schwach ist, um
sich auf Dauer selbständig in einer Welt fortschreitender Globalisierung
behaupten zu können. Den Vereinigungsbestrebungen in Europa liegt - unter
anderem - wesentlich auch diese Erkenntnis zugrunde. Auch in Israel ist man
sich grundsätzlich bewusst, dass aller Fortschritt, dass jede der
Errungenschaften, auf denen das bisherige Wachstum des Landes beruht, sich
nur in enger Verbundenheit mit einem wirtschaftlich möglichst starken
Partner kontinuierlich erneuern kann. Mit der Hilfe der USA, seinem
mächtigsten Freund und Förderer, wird der jüdische Staat wohl noch lange
rechnen dürfen, nicht aber mit der Einbeziehung in das amerikanische
Wirtschaftsgefüge. Die Interessen der Vereinigten Staaten konzentrieren sich
mehr auf Nord- und Lateinamerika, auf Freihandelszonen mit der Europäischen
Union und Südwestasien, nicht aber auf den Nahen Osten. Der erscheint heute
politisch wichtig, auch die dortigen Erdölvorkommen bieten amerikanischen
Konzernen Anreiz genug. Darüber hinaus aber verfolgen die USA in dieser
Region keine besonders ehrgeizigen Wirtschaftsziele.
Es bleibt also, da auch Japan aus mehreren Gründen ausscheidet, als
starker Bezugspunkt für Israel nur Europa, die Europäische Union. In ihr
wünscht Israel verankert zu werden, in einer dauerhart institutionalisierten
Art, die Turbulenzen standzuhalten vermag und von keinen nur beiläufigen und
vorübergehenden Interessen bestimmt wird.
Besondere Hoffnungen setzt Israel auf Deutschland. Die angestrebte
Vertiefung der Beziehungen sollte aber Hand in Hand gehen mit einem
gleichartigen Prozess im Verhältnis zwischen Israel und der Europäischen
Union. Er würde der Auffassung Helmut Kohls entsprechen, wonach der Staat
Israel "auf zwei Beinen stehen" müsse. "Heute steht er auf dem
amerikanischen Bein", sagte der Kanzler mir einmal. "Das ist gut so, und das
soll auch so bleiben. Aber Israel braucht, um vollkommen stabil zu sein, ein
zweites Bein, und das soll das europäische sein." Die Bundesrepublik,
ergänzte Kohl, werde der "Motor" sein in der EU, um dieses Ziel zu
erreichen.
Im Geist dieser Zusicherung kam es dann unter deutscher Präsidentschaft
beim EU-Gipfeltreffen im Dezember 1994 zu jenem einstimmigen Beschluss, der
Israel in seinen Beziehungen zur Europäischen Union einen privilegierten
Status zuerkennt. Der Begriff lässt vielerlei Auslegungen zu. Er regt zu
spekulativen Hoffnungen und Erwartungen an und gibt beiden Seiten
hinreichend Freiraum für die Formulierung von Ansprüchen, die - wie immer in
solchen Fällen - miteinander in Einklang zu bringen sind, wenn sie zu
konkreten Ergebnissen führen sollen. Was hat die Europäische Union von
Israel, was hat sie vom Nahen Osten überhaupt zu erwarten?
Vom Handelsverkehr mit Israel profitieren die Unternehmer in den
EU-Mitgliedsstaaten nicht unerheblich. Aus ihren Exportgeschäften im Wert
von fast 25 Milliarden Mark jährlich und den Wareneinfuhren von nur elf
Milliarden Mark ergeben sich beträchtliche Überschüsse zu ihren Gunsten.
Hinzu kommen für die Europäer Vorteile, die sie aus der Forschungsarbeit,
einem erfolgreichen und zukunftsorientierten Wissenschaftssektor in Israel,
ziehen. Den positiven Erfahrungen vor allem deutscher Wissenschaftler
schlössen sich ähnlich erfreuliche Resultate der Zusammenarbeit zwischen
französischen und israelischen Kollegen an. Sie überzeugten die EU vom
Nutzen solcher Kooperation, zumal sie auch finanziell ertragreich ist. Alles
dies ist allerdings, gemessen an den Dimensionen der europäischen Forschung
und Wirtschaft, für die Interessen Gesamteuropas letztlich nur eine
Nebensächlichkeit.
Die Notwendigkeit, sich im Nahen Osten politisch zu engagieren und nach
Möglichkeit auf den Friedensprozess einzuwirken, wird hingegen in der
Europäischen Union klar erkannt. Während ihre Aktivitäten auf
wirtschaftlichem und wissenschaftlichem Gebiet eher zurückhaltend
erscheinen, sieht sie sich als im Entstehen begriffene Supermacht von den
politischen Problemen geradezu herausgefordert. Tatsächlich stellt die
Instabilität in dieser Region auch für die EU eine Gefahr dar und berührt
unmittelbar eigene Interessen. Auswirkungen der sozialen und
wirtschaftlichen Lage im Nahen Osten und in Nordafrika machen vor den Toren
Europas nicht halt, wie - ob legal oder illegal - die Einwanderung von
Arbeitssuchenden zeigt. Allerdings ist der Zeitpunkt noch nicht gekommen, da
die Union ihre Einflussmöglichkeiten voll wahrnehmen kann. Die Chancen
werden sich voraussichtlich nach Einrührung der gemeinsamen Währung erhöhen,
erst recht natürlich dann, wenn den europäischen Regierungen die Mittel
einer gemeinsamen Außen- und Verteidigungspolitik zur Verfügung stehen.
Die Länge der Zeit, über die sich der europäische Einigungsprozess
hinzieht, lässt manchen verzweifeln. Bereits 1948 wurde der Beschluss zur
Gründung des Europarats gefasst. 1951 ist als erste übernationale
Organisation die Montanunion ins Leben gerufen worden, die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, die ein Jahr später ihre Arbeit aufnahm.
1958 traten die Römischen Verträge in Kraft, die Einigung selbst aber lässt
immer noch auf sich warten. Es ist aber wohl gerade die Langwierigkeit des
Verfahrens, die ihm letztlich Erfolg im Sinne einer krisenunauffälligen
Stabilität garantiert. Rasch, unter Druck oder gar gewaltsam erzwungene
Zusammenschlüsse zerfallen in der Regel mit der Macht, die sie
herbeirührten. Die Sowjetunion und Jugoslawien sind dafür eklatante
Beispiele.
Der Konsens, auf dem die Europäische Union beruht, ist nicht immer leicht
zu erreichen. Erforderlich sind Beharrlichkeit, Geduld und Zeit, der
gelassene, lange Blick auf das gemeinsame Ziel. Es liegt nahe, die EU mit
einer Schildkröte zu vergleichen, die sich langsam und vorsichtig, doch
unbeirrt voranbewegt, die Ruhepausen einlegt, ohne indes rückwärts zu gehen.
Alles, was bisher in der Union mit Einigungsschritten erreicht wurde, ist
ein "Aquis Europeen", ein dauerhafter, solider Grund, auf den sich weiter
aufbauen lässt. Mir selber will das künftige Europa wie eine große Schweiz
erscheinen - eine freiwillige Föderation verschiedener Sprach- und
Kulturgruppen unterschiedlicher Größe, die sich nicht bedrohen, sondern in
Eintracht miteinander leben und sämtlich vom sozialen System der
Subsidiarität profitieren.
Europas Rolle im Friedensprozess
Bis Europas künftige Rolle im Nahen Osten wirksam zum Tragen kommen kann,
dürfte also noch einige Zeit vergehen. Ungeduld wäre sicherlich fehl am
Platz, auch sind gegenwärtig zu diesem Punkt die Meinungsverschiedenheiten
innerhalb der Union noch zu groß. Überdies darf man nicht vergessen, dass im
Friedensprozess bereits die Amerikaner als Vermittler am Zuge sind, und das
schon seit geraumer Zeit. Allenthalben herrscht Einmütigkeit darüber, dass
sie allein schon die Summe ihrer bisherigen Erfahrungen legitimiert, ihre
Vermittlerrolle ungeteilt beizubehalten. Wenn dies aber so ist und vorläufig
bleiben soll, welche Aufgaben gibt es dann noch für die Europäer?
Die Frage lässt sich zunächst nur mit dem Hinweis auf das doppelte Gleis
der Verhandlungen beantworten, die mit dem Ziel eines Friedensabkommens
zwischen Israel und seinen Nachbarn geführt werden. Neben den bilateralen,
die jeweils zwischen Israel und Ägypten, Jordanien und den Palästinensern
stattfinden und zu denen hoffentlich einmal auch Gespräche mit Syrien und
dem Libanon kommen, laufen Verhandlungen auf multilateraler Ebene. An ihnen
beteiligen sich sowohl Amerikaner und Kanadier wie Europäer, Japaner,
Israelis, Palästinenser und Partner aus den Nachbarstaaten. Hauptthema
dieser Verhandlungen ist die Frage der Friedenssicherung: Wie lässt sich der
Frieden im Nahen Osten nach der Unterzeichnung entsprechender Abkommen auf
lange Sicht gewährleisten? Welche praktischen Schritte werden nötig sein, um
die Verträge allmählich so mit Leben zu erfüllen, dass der Ausbruch neuer
Konflikte vermieden, das Misstrauen zwischen ehemaligen Feinden allmählich
abgebaut und ein Zustand erreicht wird, wie er heute etwa zwischen früheren
Kriegsgegnern in Westeuropa besteht?
Ein geeignetes Mittel wäre die gemeinsame Ausarbeitung überregionaler
Entwicklungspläne, deren Realisierung, auf eine gesunde finanzielle Basis
gestellt, Vorteile für alle Beteiligten bringen würde. Solche
Gemeinschaftsprojekte, wer sie auch initiiert, würden vor allem zunächst
verbindende Interessen schaffen. Dies allein schon wäre eine Garantie für
die Realität, die Glaubwürdigkeit und Dauerhaftigkeit des Friedens. Darüber
hinaus würden die Projekte zum wirtschaftlichen Aufschwung der gesamten
Region beitragen. Denn deren Länder sind allesamt zu klein und zu arm, als
dass ein einzelnes sich im Alleingang den Luxus kostspieliger Unternehmungen
in Größenordnungen leisten könnte, die jenseits seiner Zahlungskraft liegen.
Die Verwirklichung gemeinsamer Entwicklungspläne würde zu einem
schrittweisen Ausgleich des Lebensniveaus der Israelis auf der einen und der
Araber auf der anderen Seite führen. Langfristig muss sich die in dieser
Hinsicht bestehende Kluft, wenn sie nicht aufgehoben wird, auf den Frieden
verhängnisvoll auswirken. Um den Nahen Osten in eine moderne, wirtschaftlich
florierende Entwicklungsregion wie Südostasien zu verwandeln, fehlt es zur
Zeit allerdings noch an den wichtigsten Voraussetzungen.
Gerade hier aber setzen die multilateral geführten Gespräche an. Sie
drehen sich zwar um Zukunftsprojekte, gehen aber von heutigen Notlagen und
Mängeln aus, beispielsweise von der unzureichenden Wasserversorgung, ein in
den Ländern des Nahen Ostens besonders relevantes Problem. Den Mehrbedarf an
Wasservorräten dadurch zu sichern, dass man wie bisher um die spärlichen
Ressourcen kämpft, macht keinen Sinn. Abhilfe könnte hauptsächlich der Bau
moderner, leistungsfähiger Entsalzungsanlagen schaffen.
Weitere überregionale Aufgaben liegen im Bereich des Verkehrs. Im Nahen
Osten fehlt ein durchgehendes Eisenbahnnetz mit Schnellverbindungen. Systeme
wie der deutsche ICE oder die französische TGV haben, nur in einem Land
eingesetzt, keine reelle Chance. Auch die Infrastruktur für den Straßen- und
Luftverkehr lässt sich, wenn sie künftigen Entwicklungen vorausgreifen soll,
nur in engem Kontakt mit allen nahöstlichen Ländern planen und gestalten.
Ähnliches gilt für größere industrielle Vorhaben und für Projekte auf dem
Gebiet des Umweltschutzes. Der Tourismus schließlich, der heute überall in
meist großem Maßstab betrieben wird, bietet ein nahezu unbegrenztes Feld für
gemeinsame Initiativen. dass ein Land, das soviel Attraktionen zu bieten hat
wie Israel - Sonne und Strande, berühmte historische Stätten -, trotz aller
Bemühungen jährlich nicht mehr als zwei Millionen Besucher anzieht, während
manche europäischen Länder pro Jahr zwischen vierzig und sechzig Millionen
verzeichnen, hängt hauptsächlich mit seiner geringen geographischen Größe
zusammen. Angebote von "touristischen Paketen" in Form von Rundreisen durch
den gesamten Nahen Osten würden sicherlich den Zustrom von Besuchern aus
aller Welt nicht nur in Israel anschwellen lassen, sondern die ganze Region
nach und nach für den internationalen Reiseverkehr erschließen helfen -
vorausgesetzt natürlich, es herrschte endlich Frieden unter den Völkern.
Der gute Wille, diesen Frieden allein durch Verhandlungen zu erreichen,
wird nicht genügen. Parallel dazu müsste die grundsätzliche Bereitschaft zur
Zusammenarbeit an Projekten gestärkt werden, die von sich aus schon
friedensstiftend sind. Deren Durchführbarkeit aber setzt Hilfe von außen
voraus: Ohne ausländische Investitionen wird sich kein größeres
Gemeinschaftsvorhaben in Angriff nehmen, geschweige denn zuendeführen
lassen. Und da es immerhin auch um Renditen geht - was liegt näher, als
kapitalkräftige private Investoren in Europa für solche Pläne zu
interessieren? Jede langfristige Kapitalanlage würde sich lohnen, selbst die
in den Bau von Filtrierwerken zur Aufbereitung von Wasser mit hohem
Salzgehalt. Das gewonnene Produkt ließe sich wie jedes andere absetzen, und
kein Hersteller müsste sich angesichts der enormen Nachfrage um den Verkauf
sorgen. Um aus dem Elend, in dem sie leben, herauszukommen, müssten die
Palästinenser dringend eine eigene Volkswirtschaft aufbauen. Die
Abhängigkeit von der Arbeit in Israel kann allenfalls eine vorübergehende
Lösung sein, nicht nur im Hinblick auf die Absperrungen, die gewöhnlich nach
jedem Terroranschlag angeordnet werden.
Im Rahmen der multilateralen Verhandlungen ist Israel auch mit den
Palästinensern im Gespräch. So wird beispielsweise über sogenannte
Industrieparks verhandelt. Die bisher vorliegenden Pläne sehen entlang der
Grenze die Errichtung von Industrieanlagen vor, zu denen die Palästinenser
aus ihren Gebieten Zugang haben sollen, ohne israelischen Boden betreten zu
müssen. Umgekehrt können die Israelis ebenso direkt aus ihrem Hoheitsgebiet
zu den Anlagen gelangen. Weder politische Unruhen noch Ausgangssperren
würden die Produktion behindern. Auch dieses Projekt, mit dessen Ausführung
noch vor dem Abschluss eines endgültigen Friedensvertrags begonnen werden
kann, bietet Anreiz vor allem für private Unternehmer: Sie würden
gleichermaßen von den billigen, aber erfahrenen Arbeitskräften, von der
israelischen Infrastruktur und von der Kompetenz gut ausgebildeter Techniker
und Ingenieure profitieren. Darüber hinaus leisteten sie - mit positiven
Rückwirkungen auf Europa - einen wertvollen Beitrag zur Sicherung des
Friedens an einem traditionell riskanten Unruheherd.
Europäische Unternehmer, die heute mit Investitionen die wirtschaftliche
Entwicklung des Nahen Ostens fördern, schaffen sich damit sichere und
lukrative Absatzmärkte für morgen. Die Risiken, die sie eingehen, sind
ungleich geringer als die Aussicht auf Rentabilität und auf langfristige
geschäftliche Kontakte, aus denen sich zu beiderseitigem Nutzen echte
Partnerscharten bilden können. Ein solches Dauerverhältnis ergab sich
übrigens aus dem deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen: Israel ist
seither ein zuverlässiger Kunde der deutschen Industrie.
Es gibt weitere Beispiele, die die Europäische Union ermutigen könnten,
in den multilateralen Verhandlungen über die Zukunft des Nahen Ostens die
Führungsrolle zu übernehmen. Nicht kurzlebiger Erfolge wegen, die sich rasch
von selber aufheben, sondern in realistischer Einschätzung der derzeitigen
politischen Situation im Nahen Osten und im Bewusstsein der Mitverantwortung
für das Gelingen des Friedensprozesses. dass sich aus einem solchen
Engagement der EU mit der Anmeldung wirtschaftlicher Interessen auch
Möglichkeiten der politischen Einflussnahme ergeben, liegt auf der Hand.
Richtig genutzt, können sich diese Chancen für die gesamte Region nur zum
Vorteil auswirken. Jedenfalls würde auch in diesem Fall gelten, dass
derjenige, der den stärksten wirtschaftlichen Einfluss ausübt, sich auch
politisch Geltung verschafft.
Hierin, im Mitgestalten der zukünftigen Entwicklung im Nahen Osten, liegt
eine der vielleicht sinnvollsten Aufgaben der Europäischen Union. Sinnvoll,
weil sie den eigenen Beziehungs- und Handlungsrahmen öffnen und Elemente der
Entspannung und Sicherheit in ein heillos zerrüttetes Gebiet dieser Erde
tragen würde. Wird die Aufgabe angenommen, entschädigt sie gewissermaßen für
die Vermittlerrolle der Amerikaner und wird dieser mindestens ebenbürtig
sein. Jedenfalls wird sie keine zeitlich begrenzte Herausforderung
darstellen, Friedenssicherung ist nicht an Fristen gebunden. Sie bedarf
permanenter Bemühungen und ähnlich bedachtsam gewählter Schritte wie der
Aufbau eines vereinigten Europa. Je überlegter und sorgfältiger das eine wie
das andere verwirklicht wird, desto haltbarer, desto weniger krisenanfällig
werden die Resultate sein.
Der lange, steile und steinige Weg nach Europa, den Israel vor vierzig
Jahren mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur EG betreten hat,
sollte dem Land zumindest zu einem Privileg verhelfen: als Brücke zu dienen
zwischen der Europäischen Union und einem künftig in Frieden lebenden Nahen
Osten.
Das Kapitel "Herausforderung an Europa" ist Avi Primors Buch "Europa,
Israel und der Nahe Osten", ersch. bei Suhrkamp, entnommen.
Siehe auch - Die EU-Beziehungen zu Israel:
Von Europa mit
Sympathie
EU-Kommissar Chris Patten schreibt in Jedioth achronoth...
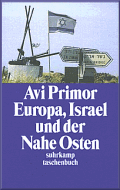


|