|

Rabbiner Dr. Israel Meir Levinger
Rabbiner der Israelitischen Gemeinde Basel
Die Jüdische Schlachtmethode
— das Schächten
I. Die religiösen Grundlagen
Das Schlachten von Tieren ist an sich ist in jeder
Methode grausam. Die Begriffe "human" und "schlachten" oder "schächten"1
können daher eigentlich nicht auf einen Nenner gebracht werden.2
Als notwendiges Übel soll es aber wenigstens so schonend wie möglich
durchgeführt werden. Unter Einhaltung bestimmter Vorschriften erlaubt auch
das jüdische Gesetz das Schlachten von gewissen Tieren.
Das jüdische Gesetz beschreibt in schriftlich und mündlich
überlieferten Ge- und Verboten Inhalt und Führung des jüdischen Lebens. Es
basiert auf dem geschriebenen Text der Torah
3, der Propheten und der
Schriften.4 Dieses Fundament
kann freilich ohne entsprechende Erläuterung nicht zur praktischen Anwendung
gelangen. Diese praktische Ergänzung findet sich in der "mündlichen Tora".
Beide, die schriftliche und die mündliche Tora, wurden Moses am Berge Sinai
übergeben.5
In der Natur mündlicher Tradition liegt die Anlage zur
Weiterentwicklung. Bedingt durch historische Ereignisse, wie die Vertreibung
der Juden aus ihrer Heimat und das Aufkommen des Christentums, waren die
Juden gezwungen, die mündliche Lehre in der Mischnah (ca. im Jahr 180 der
allgemeinen Zeitrechnung) und später im Talmud (ca. im Jahr 500)
niederzuschreiben. Diese Texte bilden daher eine heilige und unverrückbare
Grundlage der jüdischen Religion.
Als Religion für ein ständig Veränderungen unterworfenes Leben ist das
Judentum offen für eine weitere Entwicklung, die durch die Rabbinen
geleistet und in verschiedenen Formen festgehalten wird. Dieses gesamte
Gebilde wird Halacha genannt.6
Eine Anweisung erlangt halachische Verbindlichkeit,
wenn sie sich auf eine lange Tradition und eine anerkannte Autorität stützen
kann; auch ein Schriftbeweis alleine genügt nicht, wenn nicht zugleich die
genannten Kriterien erfüllt sind. Daraus folgt, dass sich die Halacha sehr
bedächtig und behutsam entwickelt.
Die wichtigsten rabbinischen Sammlungen der Halacha sind die Mischnah, die
Tossefta, die halachischen Midraschim und der Talmud, sowie aus späterer
Zeit die Mischne Tora von Maimonides (ca 1160) und der Schulchan
Aruch von
Josef Karo (ca 1575). Erst das Verständnis um Entstehung, Inhalt und
Wirkung dieser verpflichtenden Kodizes eröffnet den Weg jüdischen religiösen
Denkens.
Hartinger
7
sowie Rowe et alii
8,
die in ihren Schriften gegen das Schächten
auftreten, argumentieren nun richtig, dass eine Vorschrift über das Betäuben
vor dem Schächten weder in der Bibel noch im Talmud zu finden sei.
Dieses Argument stimmt und muss stimmen, weil zur Zeit der Niederschrift der
Bibel und des Talmuds eine der heutigen Form vergleichbare Betäubung vor dem
Schlachtvorgang gar nicht bekannt war. Vielmehr war durch die extrem strenge
Regelung des Schächtens selbst die äußerste Schmerzminimierung der
Schlachttiere angestrebt und gewährleistet.
Die schriftliche Tora bietet lediglich einen kleinen Hinweis auf das
Schächten. So heißt es in Dewarim (Deuteronomium) 12,21: "Du sollst von
Deinem Großvieh und Kleinvieh schlachten, so wie ich Dir befohlen habe".
Die Worte "wie ich Dir befohlen habe" sind sehr interessant, denn da
wir in der ganzen Bibel keinen weiteren Hinweis finden, weisen sie auf eine
dahinterliegende Schicht, auf eine noch ältere Vorschrift, auf die mündliche
Lehre.9 Diese ist in die
spezifischen Gesetze über das Schächten eingegangen, die wir im Talmud
(Traktat Chulin 1-2) in Maimonides' Mischne Tora (Sefer Keduschah) und in
Karos Schulchan Aruch (Jore De'a 1-28) finden.
Diese halachischen Vorschriften bestimmen ein exaktes Verfahren für das
Schächten, wie es unten noch beschrieben wird. Eine zweite, dem
Schächtschnitt vorangehende Betäubung würde dem Tier Verletzungen zufügen
und es trefa (unrein) machen. Sie stünde daher im Widerspruch zur
jüdischen Religion.
Dafür dass die jüdische Religion das Schächten als die ideale
Schlachtmethode betrachtet, lassen sich wichtige Gründe ins Treffen führen:
die
Heiligkeit des Lebens, die Psychologie des Schächters und auch
die Fleischqualität.
Die Rettung von Leben ist sehr essentiell in der jüdischen Lehre.10
Wenn es dabei um ein Menschenleben geht, dürfen alle Gesetze der jüdischen
Religion mit Ausnahme von Mord, Götzendienst und Ehebruch übertreten werden.
Auch das Leben eines Tieres hat eine große Bedeutung im Judentum.11
Es gibt eine Reihe von Gesetzen in der Tora, im Talmud oder den
nachtalmudischen Kodizes, die den Tierschutz zum Gegenstand haben.12
Die strengen Vorschriften des Schächtens stehen ebenfalls im Zeichen des
Tierschutzes. So darf das Schächten nur durch qualifizierte Personen
ausgeführt werden. An einen Schochet (Schächter) werden dieselben
hohen ethischen Anforderungen gestellt wie an einen Rabbiner.13
Der Schochet muss die Schächtung bewusst ausführen.
Er darf dabei nur solche Apparate verwenden, die durch Menschenkraft
angetrieben werden, nicht jedoch mechanisch-automatische Apparate mit
Wasser-, Wind- oder elektrischem Antrieb. Schächtet ein Schochet
unqualifiziert, lastet die volle Verantwortung für das Töten des Tieres auf
seinem Gewissen.14
Das Schlachten ist nur erlaubt zur Versorgung des
Menschen und muss daher
Fleisch von höchster Qualität in bester Ausbeute bringen. Falls es zu
wenig Fleisch ergäbe, müssten weitere Tiere geschlachtet werden, was im
Gegensatz zum Prinzip der Schonung und des Tierschutzes stünde. Die
Fleischqualität ist nach dem Schächten besonders gut, weil das Tier wegen
des Weiterfunktionierens des Herzens optimal ausblutet.
>> 2.Teil -
Vorbereitung und Methode
- Hebräisch Schechitah. Vgl. ausführlicher und mit
weiteren Nachweisen I.M.Levinger, Schechita im Lichte des Jahres 2000,
Jerusalem 1996.
- Trotz des Versuchs in den USA, die entsprechende
rechtliche Reglung als
Humane Slaughter Act zu bezeichnen; vgl unten R. Kuppe,
Schächten und Tieropfer im Recht der Vereinigten Staaten von Amerika (in
"religionsrechtliche schriften 2- Schächten. Religionsfreiheit und
Tierschutz Plöchl-Kovar) 183 ff.
- Pentateuch, 5 Bücher Moses.
- Altes Testament.
- Schmot 1 Exodus 24,12.
- Das hebräische "halakh" bedeutet "gehen" und deuet
auch im Namen auf den Entwicklungsprozess hin.
- W Hartinger, Das Tier in
der Thora, Tenach und Talmud, München oJ (1991).
- H. T Rowe. L K. Skriver & U. Wenzel,
Quälen für den Glauben, Du und das Tier 23, (1991)3.
8.
- Dies ist einer der Hinweise, dass die mündliche
I..ehre ebenso alt ist wie die schriftliche, dh von der Uebergabe der
Torah am Sinaj.
- Talmud, Joma 82a.
- B. E. Jizchak, Ziwchei
Tamim (Ohel Jizchak), Wilna 1885.
- Vgl Levinger, Schechita 2000, 14 ff.
- Vgl. J.J. Grunwald, The Shochet and Shechita
in rabbinic literature, New York 1955.
Diese Anforderungen sollen dem
Trend entgegenwirken, dass Menschen, die sich mit Töten beschäftigen,
grob sind und das Leben verachten. Im Talmud (Kidduschin 82a) heißt es
dazu: "Der Beste der Schächter ist der Partner Amaleks."
- J.Karo, Schulchan Aruch.
Jore De'a, 7:1.
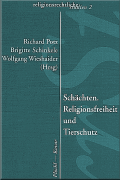 Quelle: Quelle:
religionsrechtliche schriften 2
Schächten - Religionsfreiheit und Tierschutz
Herausgeber: Potz, Schinkele, Wieshaider
[Bestellen]
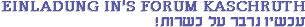
 Kashruth (Koscheres Leben)
Kashruth (Koscheres Leben)
 Jewish in Germany
Jewish in Germany
 Jahaduth: Juedische Religion
Jahaduth: Juedische Religion
 haGalil onLine: Inhaltsverzeichnis
haGalil onLine: Inhaltsverzeichnis
1997 - All Rights Reserved by the Author
and haGalil onLine |