|
Die Geschichte der
Juden
in Deutschland V
1650
aZ:
Messianische Wirren leiten die Aufklärung
ein |
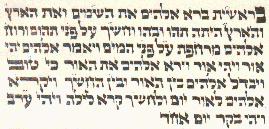 |
1648/49: Die Gemetzel Chmelnickis
in Polen und der Ukraine zwingen viele osteuropäische Juden zur neuerlichen
Flucht in den Westen, diesmal in deutsche Gebiete.
1649: Die Juden werden aus
Hamburg vertrieben.
1670-1671: Die Juden werden aus Wien und den österreichischen Erblanden
vertrieben; fünfzig wohlhabenden Wiener Familien wird es gestattet, sich in
Berlin anzusiedeln.
1646-1724: Das Tagebuch der in Hamburg geborenen
Glückel von Hameln gewährt einen einzigartigen Einblick in die deutsche
jüdische Welt im späten 17. und frühen 18. Jahrhundert. Mit 14 Jahren
verehelicht, bringt sie zwölf Kinder zur Welt, wird mit 44 Jahren zur Witwe und
führt das Geschäft ihres verstorbenen Mannes weiter, während sie ihre noch
unverheiraten Kinder aufzieht. Sie heiratet wieder mit 54 Jahren, erleidet zwei
Jahre später Bankrott, wird mit 66 wieder Witwe und stirbt im 78. Lebensjahr. Im
Jahr 1690 beginnt sie ein für ihre Kinder gedachtes Tagebuch, in dem sie
ausführlich über ihr Familienleben, das Leben ihrer Freunde und Nachbarn,
Geburten, Heiraten, Krankheiten und Todesfälle ebenso wie über ihre
geschäftlichen Erfahrungen und die wichtigeren Ereignisse ihrer Zeit berichtet.
Durch ihren Bericht ist uns auch das Stärkerwerden des Messianismus überliefert,
des Glaubens an die unmittelbar bevorstehende Ankunft des Messias, der die Juden
aus dem Exil und seinen Leiden und Demütigungen erlösen und ins gelobte Land
führen wird. Als
Shabbatai Zevi, ein 1626 in Smyrna geborener religiöser Fanatiker, sich
1665 durch Nathan von Gaza zum Messias erklären lässt und für das nächste Jahr
(das nach den Lehren der Kabbala das Jahr der Wende ist) die Rückkehr der Juden
in das von den Türken beherrschte Land Israel deklariert, folgen die Juden an
vielen Orten diesem Aufruf, verkaufen allen ihren Grundbesitz und halten sich
bereit für den Weg nach Osten. Als bekannt wird, dass Shabbatai Zevi 1666, im
Jahr der großen Wende, zum Islam übergetreten ist und einen kleinen Ehrenposten
am Hof des Sultan in Istanbul angenommen hat, herrscht zwar grosse Enttäuschung
über ihn, aber der Glaube an die baldige Ankunft des Messias wird nicht
schwächer: zu groß ist das Leid und die Hoffnungslosigkeit. Noch mehr als
hundert Jahre später kann
Jakob Frank auf diesem Glauben aufbauen und ihn für seine Zwecke
benutzen (s. Offenbach).
Die ständige Enttäuschung des Messiasglaubens bringt viele Juden vom
überkommenen Glauben ab und unterstützt die Bemühungen der Aufklärung.
Mitte des 18. Jahrhunderts: Die Aufklärung ist eine Periode intensiver
intellektueller Bestrebungen, religiöse Vorurteile und drückende Bräuche und
Traditionen durch die Kraft der Vernunft zu überwinden. Der deutsche Dichter
Lessing und der jüdische Philosoph
Mendelssohn sind bedeutende Vorkämpfer dieser Bewegung und tragen viel
dazu bei, den Weg für die schließliche Emanzipation der Juden zu bahnen.
1729-1786: Moses Mendelssohn gilt als der erste moderne jüdische Denker
der deutschen Aufklärung und als geistiger Führer des deutschen Judentums; er
will die Barrieren beseitigen, die die Juden vom deutschen gesellschaftlichen
und kulturellen Leben trennen. Neben seiner umfangreichen schriftstellerischen
Tätigkeit ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann und leitet in seinen späteren
Jahren eine Seidenfabrik. Er übersetzt die Torah ins Deutsche und veröffentlicht
die deutsche Übersetzung (zuerst in hebräischen Lettern gedruckt) zusammen mit
dem hebräischen Original und Kommentaren. So lehrt er die Juden, deutsch zu
lesen und zu schreiben und macht andere mit der hebräischen Sprache vertraut.
Mendelssohn glaubte, dass der Zugang zu Sprache und Kultur der Mehrheit die
jüdische Identität nicht gefährde. Und doch bringt das von ihm angebahnte
bessere Verständnis zwischen den beiden Völkern zahlreiche Übertritte zum
Christentum. Sein langjähriger Freund G. E. Lessing setzt ihm in "Nathan der
Weise" ein bleibendes literarisches Denkmal.
1778: David Friedländer gründet die erste jüdische Freischule, an der die
Unterrichtssprache Deutsch anstatt Hebräisch ist.
1781: In Berlin erscheint die Schrift "Über die bürgerliche Verbesserung
der Juden in Deutschland" von Ch. W. Dohm, einem hohen preussischen Beamten.
Seine emanzipatorischen Vorschläge sollten im 19.Jahrhundert die preußische und
später die deutsche Gesetzgebung nachhaltig beeinflussen.
1791: Die Französische Revolution bringt nicht nur den wenigen
französischen Juden, sondern in den von Napoleon besetzten Gebieten
vorübergehend auch den deutschen jüdischen Gemeinden die bürgerliche
Emanzipation.
1797-1856:
Heinrich Heine, einer der großen deutschen Dichter, wird als Sohn einer
jüdischen Familie in Düsseldorf geboren, tritt aber wie viele Zeitgenossen im
Zuge der erstarkenden Assimilationsbewegung zum Christentum über. Obwohl er
formell nie zum Judentum zurückkehrte, ist sein Ausspruch bekannt: "Ich mache
kein Geheimnis aus meinem Judentum, zu dem ich nie zurückgekehrt bin, weil ich
es nie verlassen habe."
1806: Ende des Heiligen Römischen Reiches, das seit der Krönung Karl des
Grossen im Jahr 800 die deutschen Gebiete mit mehr oder weniger grossen
Machtbefugnissen beherrschte. Um die drohende Wahl Napoleons zum römischen
Kaiser zu verhindern, löst Kaiser Franz II. das auf Wahl durch die Kurfürsten
beruhende römische Kaiserreich (nach vorsorglicher Gründung des erblichen
österreichischen Kaiserreichs) auf.
1812: Preußen führt ein Gesetz zur Judenemanzipation ein. In den
folgenden Jahren wird die Gleichstellung der Juden Schritt für Schritt wieder
rückgängig gemacht.
1818: Leopold Zunz (1794-1886) veröffentlicht eine Schrift "Etwas über
die rabbinische Literatur", die ein vorläufiges Programm des Studiums der
jüdischen Geschichte und Literatur enthält; daraus erwächst später die "Wissenschaft
vom Judentum". In wissenschaftlichen Zeitschriften erscheinende Studien
regen die Diskussion zwischen jüdischen und christlichen Intellektuellen an und
tragen zur Stärkung des jüdischen Selbstbewusstseins bei. 1854 wird in Breslau
das "jüdisch-theologische Seminar" gegründet. Das ist die erste Institution, die
sich der Wissenschaft vom Judentum widmet. Es folgt die Gründung ähnlicher
Organisationen in Deutschland und anderen Ländern.
1819: Der Schlachtruf "Hep! Hep!" ertönt während anti-jüdischer Unruhen;
sie brechen in mehreren Gegenden Deutschlands aus, zum Teil wohl deswegen, weil
sich manche Christen durch den sozialen und wirtschaftlichen Aufschwung der
Juden und durch die Judenemanzipation bedroht fühlen.
1836:
Samson Raphael Hirsch (1808-1888) veröffentlicht seine "Neunzehn
Briefe über das Judentum" und "Aufsätze über die Pflichten Israels in
der Diaspora", in denen er sich mit den Beziehungen des Judentums zur Weltkultur
befasst. Rabbi Hirsch ist der prominenteste geistige Führer der jüdischen
Orthodoxie im 19.Jahrhundert.
1848: Wenige Wochen nach der Pariser Februarrevolution bricht auch in
Deutschland die Revolution aus, die ein Ende der Kleinstaaterei, eine liberalere
Regierung und volle bürgerliche und politische Rechte für das ganze Volk
anstrebt. Die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt beschließt eine
Verfassung, die auch den Juden dieselben Rechte gewährt. Die Nationalversammlung
unter ihrem Präsidenten Eduard Simson, einem getauften Juden, bietet dem
preußischen König Friedrich Wilhelm IV. die deutsche Kaiserkrone an, er lehnt
diese Krone die "aus dem Dreck der Revolution geknetet ist", ab. Die Revolution
wird schließlich vom Milagen. Es folgt eine Periode der Reaktion.
 Nächster Teil demnächst
Nächster Teil demnächst
 Erste Seite
Erste Seite
Wenn Sie hierzu
ein Buch lesen möchten:
Reiseführer durch das jüdische Deutschland
Peter Hirsch und Billie Lopez, Kovar Verlag
zu bestellen bei haGalil onLine
info.order@hagalil.com
|
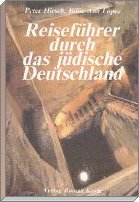
|
|