|
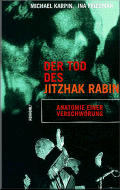
Michael Karpin und Ina Friedman:
Der Tod des Jitzhak Rabin
- Anatomie einer Verschwörung
[BESTELLEN]
Die Hetzkampagne gegen Jitzhak Rabin in Israel mochte noch so roh
und schrill sein - verglichen mit der Kampagne in den USA, die sich
gemeinhin eines zivilen Umgangstons im politischen Streit rühmen
kann, konnte sie einem fast maßvoll vorkommen.
Aus Kapitel 5:
American Connection
Teil 4
Es beginnt mit Worten:
Geistige Brandstiftung
Nach außen hin, vor dem Kongress und der
allgemeinen Presse, zeigten die Gegner Rabins noch eine gewisse
Zurückhaltung, dies galt aber nicht in den "eigenen Reihen".
... Fortsetzung von Teil
3
»
Vor ihren eigenen Gemeinden schlugen die führenden Vertreter der
Orthodoxen und Rechten jedoch ganz andere Töne an. Beispiele für
solche Brandreden gibt es genug. Der World Likud (ein Ableger der
israelischen Partei) überschwemmte orthodoxe Synagogen in Brooklyn
und Miami mit Flugblättern, auf denen die israelische Regierung
angegriffen wurde.
Rabbiner Mordechai Friedman, Leiter der orthodoxen Vereinigung
amerikanischer Rabbiner, klagte in Radio- und Fernsehinterviews:
«Rabins Demokratie verfolgt die Siedler» und «Die israelische Armee
ist in eine ultralinke Rabin- Peres-Miliz verwandelt worden». Als
Rabbiner Benjamin Schaferstein von der Kanzel aus wetterte, «Israel
ist nicht mehr demokratisch, sondern eine Diktatur von Rabin und
Peres», nahmen die Gläubigen das Diktum protestlos hin - kein
Wunder, denn in den Blättern der orthodoxen Gemeinschaft war die
israelische Regierung bereits als «Judenratpolizei» denunziert
worden. Andere Würdenträger mieden demonstrativ die sumpfigen Felder
der Politik und widmeten sich der allgemeinen Volksbildung. Rabbiner
Moshe Tendler etwa, Biologieprofessor an der Yeshiva University und
angesehene Halacha-Autorität, erläuterte den Medien geduldig, daß
gemäß dem jüdischen Religionsgesetz jeder, der als
Rodef erkannt ist, getötet werden muß.
Während die Gemeinderabbiner ihre Offensive
vorantrugen, achteten sie sorgfältig darauf, ihre Flanken zu
schützen. Den IDF-Offizieren, die nach Amerika geschickt wurden, um
die Umsetzungsschritte des Osloer Abkommens zu erläutern, verwehrten
sie den Zutritt zu ihren Synagogen. Die Mitglieder ihrer Gemeinden,
so die Rabbiner, seien der gegenwärtigen israelischen Regierung
nicht gewogen, und sie könnten daher nicht für die Sicherheit der
Offiziere einstehen. Wenigstens ersparten sie den Militärs die
Demütigung ihrer diplomatischen Weggefährten: Talia Lador etwa,
Konsul für Öffentlichkeitsarbeit in New York, wurde bei der
Eröffnung der Jerusalemwoche in Queens mit den Rufen «Verräter» und
«Nazi» empfangen.
 Zev
J. Brenner, President of TALKLINE COMMUNICATION NETWORK Host of
TALKLINE WITH ZEV BRENNER, America’s premier Jewish program (acc. to
http://www.talklinecommunications.com). Zev
J. Brenner, President of TALKLINE COMMUNICATION NETWORK Host of
TALKLINE WITH ZEV BRENNER, America’s premier Jewish program (acc. to
http://www.talklinecommunications.com).
Auch Colette Avital kam bald unter Sperrfeuer. So
beschimpfte man sie am Telefon als «Nazi» und drohte, sie zu
«erledigen». Hörer, die bei Zev Brenners Radioshow «Talkline»
anriefen, bezeichneten sie als «Feind Israels» und «Verräterin, die
vor Gericht gestellt werden sollte». «Wir sorgen dafür, dass sie vor
ein Erschießungskommando gestellt wird», raunzte ein Anrufer.
Brenner, der nach eigenem Bekunden derlei noch nie erlebt hat,
beobachtete, daß die Hasstiraden gegen die Regierung Rabin zweimal
besonders explosiv waren: nach der Bekanntgabe des
Friedensnobelpreises im Oktober 1994 und nach der Unterzeichnung des
Abkommens Oslo II im September 199s.
«Die Juden aus Brooklyn, die in der Sendung anriefen, legten gleich
mit wüsten Beschimpfungen los und nannten Colette Avital und Rabin
'Nazis' und 'Verräter'. Ich mußte sie aus der Leitung werfen, um ein
Mindestmaß an Würde zu bewahren.» Avital schlug zurück, in
Sendungen, die ein viel breiteres Publikum erreichten.
Bei Mike Wallace in «60 Minutes» antwortete sie auf Drohungen von
Mike Gozovsky, dem Leiter der Kahane Chai in New York, und warnte
vor der verbalen Gewalt jüdischer Fanatiker. Dieser Auftritt brachte
ihr einen weiteren Schwall telefonischer Beschimpfungen ein, die
zeigen sollten, dass sie jederzeit mit neuen Angriffen zu rechnen
hatte.
Anregungen fand die Kunst der Hetze gegen die Regierung Rabin auch
in selbstgebastelten «Infos», die per Fax und E-Mail verschickt oder
auf Webseiten abgelegt wurden und dann mündlich oder durch Zitate in
rechten jüdischen Publikationen weitergetragen wurden. Avital
erinnert sich: «Einmal ging bei den Orthodoxen das Gerücht um,
israelische Soldaten, die Siedler (im Westjordanland) begleitet
hätten, hätten den Befehl erhalten, sie inmitten eines arabischen
Gebietes zu verlassen und damit ihr Leben in Gefahr zu bringen.
Viele orthodoxe Juden in Amerika haben Söhne und Töchter in den
besetzten Gebieten und waren erbost. Doch das Ganze war natürlich
eine Ente.»
Anfang 1995 sprach Rabbiner Sholom Gold
(Paraschoth bei
http://www.yeshiva.org.il
- http://www.613.org...) vor
einer Rabbinerversammlung in New York, und das Algemeiner Journal
druckte lange Passagen seiner Rede ab. Gold verglich zunächst die
Gefahren, die in Rabins Politik lauerten, mit dem Holocaust, und
rechtfertigte dann seine Charakterisierung von Rabins Kabinett als
«unmoralische Regierung» mit einem Gerücht, das ihm zu Ohren
gekommen war. Dem
Algemeiner Journal
zufolge behauptete Gold: «Vor zwei Wochen, an dem Abend, als ein
junger israelischer Taxifahrer von Terroristen auf offener Straße
ermordet wurde, hatte das israelische Kabinett zu einer Party
eingeladen. Auf die Frage, ob es nicht angebracht sei, diese
abzusagen, nachdem ein Jude von einem Terroristen getötet wurde, hat
Rabin geantwortet: 'Solche Dinge passieren in Israel jeden Tag'.»
Das Publikum reagierte erwartungsgemäß mit Zornesschreien, woraufhin
Gold seine Zuhörer mahnte: «Die Zeit der politischen Höflichkeiten
ist um. Machen Sie jedem Mitglied der Regierung, das nach Amerika
kommt, das Leben schwer.»
Ein in den orthodox-jüdischen Kreisen Amerikas
besonders beliebtes Klagelied, das in Israel selbst nur von den
Mitgliedern der radikalen
Zo Artzenu zu hören war, handelte von der angeblichen
Neigung der Regierung Rabin, die eigenen Bürger zu tyrannisieren.
1995 brachte
The Jewish Press
während des ganzen Sommers auf den ersten Seiten großformatige Fotos
israelischer Polizisten, die haredische Demonstranten vom Ort einer
Protestaktion wegschleiften. Die Fotos waren nicht gefälscht; die
begleitenden Schlagzeilen, in denen behauptet wurde, Rabbiner seien
bei Demonstrationen verhaftet worden, waren Mummenschanz. Berichte
dieser Art häuften sich: Die israelische Regierung ließe Rabbiner
systematisch verprügeln und verhaften und dann während der Haft
foltern; die Regierung versuche jeglichen Protest zu ersticken,
indem sie Demonstrationen verbiete, die Polizei anweise,
Demonstranten mit brutaler Gewalt zu vertreiben und sie vor allem
dazu anhalte, dabei auch Frauen und Kinder zu schlagen. Allenthalben
behauptete die orthodox-jüdische Presse, Jitzhak Rabin habe das Land
in eine «Diktatur» verwandelt, während dieselben Blätter in großer
Aufmachung über die vielen Demonstrationen berichteten, die zum Teil
von ihren Lesern finanziert wurden.
Die Parteilichkeit dieser Blätter tat dem
Vertrauen in ihre Berichterstattung keinen Abbruch. Die Jewish Press
und ihr Herausgeber Sholom Klass waren für ihre Sympathien für
jüdische Fanatiker bekannt. Rabbiner Kahane und sein Sohn Benjamin
hatten in der Zeitung ihre festen Kolumnen, ein Forum, das letzterer
nutzte, um «das apathische jüdische Volk gegen die israelische
Regierung zu mobilisieren, die israelische Kinder mit Drogen, AIDS
und anderen Annehmlichkeiten der westlichen Kultur vollgestopft
hat». Die Schlagzeile, mit der das Blatt 1994 seinen Bericht über
das Massaker an Palästinensern in der Höhle der Stammesväter
schmückte, überging solche Einzelheiten wie die Zahl der Opfer und
den Namen des Mörders, um gleich auf den Punkt zu kommen:
«Hintergründe des Massakers: Regierung Rabin auf der Anklagebank».
In einem Artikel dieser Ausgabe wurde Goldstein als «Heiliger von
Kiryat Arba» bezeichnet. Und in nicht mehr zu unterbietender
Niederträchtigkeit zitierte man seine Bewunderer mit den Worten:
«Die Araber, die Goldstein töteten, hatten vor, Juden zu töten.»
Der Wunsch, das Schlimmste über die von der
Arbeitspartei geführte Koalitionsregierung zu denken, trieb die
Leser dieser Zeitungen dazu, jedem Bericht zu glauben und dann die
israelischen Vertretungen in New York und Washington mit Anrufen und
Faxen zu überfluten, in denen Rabin und seine Minister als
«Verräter» und «Regierung der Nazis» beschimpft wurden. «Woche für
Woche bezeichnen sie die israelische Regierung als Nazis», klagte
Avital in einem Interview mit der New York Times, während der
Sprecher des Konsulats sich regelmäßig bei Klass über die giftige
Sprache seines Blattes beschwerte - doch es nützte nichts.
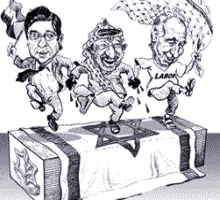 Neuere
Beispiele: Neuere
Beispiele:
Mai 2004 "Women in Green"
Beilin (mit palästinensischer Flagge), Arafat (mit Blut an den
Händen) und Peres (mit einem T-Shirt der Arbeitspartei) tanzen
gemeinsam auf dem Sarg eines israelischen Opfers - oder ist es
gleich der gesamte Staat Israel, der im Sarg liegt?
Die orthodoxen Wochenblätter standen mit ihren
Feindseligkeiten gegenüber Rabin und dem Vertrag von Oslo nicht
allein. Und der Ministerpräsident war nicht das einzige Objekt von
unverfrorenen Ausfällen und Tiraden.
Peres eignete sich ebenso als Ziel, da er in Israel bereits mit
einer Reihe von Verleumdungskampagnen konfrontiert gewesen war. Die
Gerüchte, die man während seiner langen politischen Laufbahn über
ihn in Umlauf brachte, reichten von der Behauptung, seine Mutter sei
Araberin (Peres ist in Belorußland geboren und hat auch einen
entsprechenden Akzent), bis hin zur Anschuldigung, sein Sohn habe
sich vor dem Wehrdienst gedrückt (er war in Wahrheit
Luftwaffenpilot). Doch als Ministerpräsident war Rabin ein
lohnenderes Ziel, wenn auch gewiß ein weniger bequemes.
 Neuere
Beispiele: Neuere
Beispiele:
Heute tanzt er mit Scharon:
Oktober 2004 "Women in Green"
Seine militärische Laufbahn, von den Tagen an, da
er sich als Jugendlicher dem Palmach-Untergrund anschloß, bis zu
seiner Ernennung zum Stabschef der IDF im Sechstagekrieg, verlieh
ihm gerade in den Augen nationalistischer Kreise einen
unangreifbaren Rang im Pantheon israelischer Helden und bekräftigte
sein Image als Verkörperung eines «echten Eingeborenen», eines
Sabra: Er stand für Bodenständigkeit und Aufrichtigkeit, ja sogar
Reinheit. Rabin hatte an der politischen Börse Israels zwei
beneidenswerte Beinamen: «Mr. Sicherheit» und «Teflon», letzterer,
weil der Schmutz, mit dem ihn seine politischen Feinde bewarfen,
nicht an ihm haftenblieb.
Auf der anderen Seite des Globus jedoch, fern
von der Mythologie der «Sabra-Erfahrung», waren die Versuche, Rabin
als Feind alles Gerechten, Guten und Aufrechten zu diffamieren, in
geradezu unglaublichem Maße erfolgreich. Mit groben, unbeholfenen
Pinselstrichen machte man aus dem Helden ein Schreckgespenst, das
sich dem Alkohol ergeben habe, die Religion verabscheue und allen
jüdischen Werten feindlich gegenüberstehe. Selbst seine
militärischen Leistungen wurden durch Verleumdungen in den Schmutz
gezogen: Er habe im Unabhängigkeitskrieg von 1948 seine Leute auf
dem Schlachtfeld im Stich gelassen und am Vorabend des
Sechstagekrieges einen Nervenzusammenbruch erlitten.
Die Februarausgabe 1995 des Outpost, damals Vierteljahresschrift der
afsi.org , heute auch
mideastoutpost.com,
ist ein erhellendes Beispiel dafür, wie Hetze funktioniert: Haltlose
Vorwürfe werden als Fakten vorgestellt, die dann als Rechtfertigung
für Schmähungen dienen. Die meisten Autoren der Ausgabe schlagen in
ihren Beiträgen auf Rabin und seine Friedenspolitik ein; der
Aufmacher ist ein Artikel mit dem Titel «Der wahre Rabin» von Erich
Isaac, emeritierter Geographieprofessor der New York City University
und Mitglied des Herausgebergremiums von Outpost.
Zu Beginn fragt Isaac nach der Quelle des Vertrauens, das die
«etablierten jüdischen Organisationen und führende Persönlichkeiten
der Vereinigten Staaten» Rabin entgegenbrächten, und kommt zu dem
Schluß: «Zum großen Teil gründet sich dieses Vertrauen auf Jitzhak
Rabin, den Armeeführer. Typisch dafür ist eine Anzeige in einer
Reihe von amerikanisch-jüdischen Blättern vom August 1994 mit der
Überschrift: 'Wenn es um Israels Sicherheit geht, kann keiner Rabin
etwas vormachen. Keiner'. Tenor der Anzeige war, dass Rabin als der
Mann, der 1967 für Israel die Gebiete eroberte, niemals territoriale
Zugeständnisse machen würde, die den Staat gefährden. Für all jene,
die sich einlullen lassen von Rabins angeblichen militärischen
Glanzleistungen als unerschrockener Führer in der Schlacht vor der
Staatsgründung und als siegreicher General bei der Verteidigung des
Landes, sollte Dr. Uri Milsteins demnächst erscheinendes Buch The
Rabin File ein Weckruf sein. Vielleicht wird eines Tages dann
folgende Frage zu den historischen 'Was-wäre-wenn'-Gedankenspielen
hinzukommen: 'Hätte Milsteins Buch den knappen Sieg der
Arbeitspartei verhindert, wenn es einige Jahre früher erschienen
wäre?'»
 Neuere
Beispiele: Neuere
Beispiele:
Haman, erkennbar an den Ohren, war der erste, der die völlige
Vernichtung des jüdischen Volkes plante. Im Buch Esther wird
geschildert, wie es gelang seinen Plan zu vereiteln. Wie damals ist
dazu auch heute ein Wunder nötig, da Jossi Beilin und Uri Avnery,
die heutigen Nachfolger dieses "Prototyps des
Ausrottungs-antisemiten", sich daran machen die "finsteren Pläne des
Ariel Scharon" zu unterstützen...
Was in New York als durchaus vernünftige Frage
klingen mochte, erwies sich bald als trügerisch. Denn Milsteins Buch
- in dem er Rabin der blamablen Feigheit während des
Unabhängigkeitskriegs bezichtigt - wurde von seinen
Historikerkollegen in Israel in der Luft zerrissen. «Die
kommentierenden Ausführungen Milsteins ergänzen nicht die Tatsachen,
sie ersetzen sie und werden als Tatsachen aufgetischt», schrieb Dr.
Levy Yagil in der Ha'aretz in einer trockenen, aber vernichtenden
Kritik.
(Anm.: Trotzdem erscheinen auch heute immer wieder
Bezugnahmen auf Milsteins Buch, zB im Internet Magazin
ourjerusalem.com zur
8. Jahrzeit nach Rabins Ermordung).
Isaacs Artikel ist in klarem und nüchternem Stil
verfaßt und war - wenn auch auf Schlußfolgerungen aus zweifelhaften
Forschungen beruhend - als ernsthafter Beitrag zur demokratischen
Auseinandersetzung gemeint. Doch in derselben Ausgabe von Outlook
findet sich auch der Beitrag eines gewissen J. S. Sorkin, der sich
alle Mühe gibt, den Ruf des Ministerpräsidenten zu vernichten, und
sich über Rabins angebliche Feigheit hermacht. Die Autoren in
Outlook werden immer kurz mit Hinweis auf ihre wissenschaftliche
oder organisatorische Tätigkeit vorgestellt, doch unter Sorkins
Beitrag hieß es nur, «bevor die Order ausgegeben wurde, man habe dem
Händedruck zu applaudieren», habe der Autor «Arbeiten in
verschiedenen Blättern veröffentlicht». Ein Wink mit dem Zaunpfahl:
Sorkin macht erst gar nicht den Versuch, Isaacs nüchternem Stil zu
folgen. Im Gegenteil, er beklagt die «gespenstische Charade der
Nobelpreiszeremonie in Norwegen» und den Glauben, wonach der «Weg
zum Frieden über einen Staat westlich des Jordan für das alte
palästinensische Volk führt, ein Glaube, der in die besten Köpfe
Israels eingedrungen ist wie eine 'Invasion der Körperfresser'». Er
stempelt Rabin zum «Borderline-Alkoholiker, der bekanntermaßen sein
Leben lang immer wieder psychische und militärische Rückzüge
angetreten hat», und holt am Ende zu folgendem Schlag aus:
«Was immer Rabins persönliches Schicksal sein mag, sein bisheriges
Vermächtnis ist belastet von Anschuldigungen, er habe sich 48 als
feige vor dem Feind erwiesen, von seinem selbsteingestandenen
psychischen Zusammenbruch von 1967, seinem Rückzug im Libanon 1985*,
seinem Rückzug aus Gaza und Jericho 1994 und Gott weiß aus welchen
Gebieten noch in den kommenden Wochen...
Viel jüdisches Blut ist bereits im Namen des Friedens vergossen
worden, und obwohl man darauf vertrauen kann, daß sein Wahnsinn nie
obsiegen wird, bleibt die Frage - ein halbes Jahrhundert nach dem
Holocaust -, wieviel Blut die Juden noch vergießen müssen, bis
dieser erbärmliche Mensch von dannen zieht.»
*) Als Verteidigungsminister in der Regierung der
nationalen Einheit 1984-1988.
Rabins «Feigheit vor dem Feind» im Jahr 1948 ist
eine «Tatsache», die Sorkin bei Milstein auflas. Von anderen
Historikern des Unabhängigkeitskrieges wird sie allerdings als die
Entscheidung eines Feldkommandeurs bewertet, seine Männer nicht in
eine Schlacht zu werfen, die nichts weiter gebracht hätte, als die
ohnehin schon ausgebluteten Einheiten noch weiter zu dezimieren.
Außerdem griff Rabins Harel-Brigade den Feind 1948 mehrmals an, bis
sie die Straße nach Jerusalem freigekämpft und gesichert hatte.
Sein «psychischer Zusammenbruch» zwei Wochen vor dem Ausbruch des
Sechstagekriegs ist eine Episode, die Rabin mit seltener und
vielleicht unvorsichtiger Offenheit in seinen Memoiren schildert.
Dagegen half schon ein Beruhigungsmittel und eine gut durchschlafene
Nacht.
Sein «Rückzug im Libanon 85» war weder der seine noch ein «Rückzug»,
sondern ein Teilrückzug, befohlen von der Regierung der nationalen
Einheit, in der einige Minister entsetzt waren, daß die israelischen
Streitkräfte überhaupt so tief in den Libanon eingedrungen waren.
Und sein «Rückzug aus Gaza und Jericho» ließ einen Seufzer der
Erleichterung durch die Reihen der Soldaten und Reservisten gehen,
die Befehl hatten, die israelische Kontrolle über die Million elend
dort lebender Palästinenser aufrechtzuerhalten. Sogar Vertreter der
Rechten unterstützten den Schritt, der Rabin dann den
Friedensnobelpreis einbrachte...
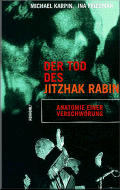 »»»
Fortsetzung... »»»
Fortsetzung...
[Frühere Kapitel]
Aus dem Buch von
Michael Karpin und Ina Friedman:
Der Tod des Jitzhak Rabin
- Anatomie einer Verschwörung
[BESTELLEN]
hagalil.com
04-11-2004 |