|
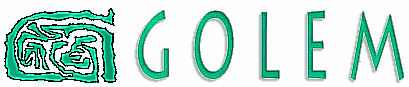
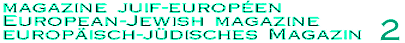
Vladimir Vertlib
Namen
Ein dichter Nadelwald. Sumpfiger Grund.
Im Frühjahr und Herbst versinken die Wagen auf der ungeteerten Straße im
Schlamm. Auf dem einzigen Hügel weit und breit die Ruine des Herrenhauses, ein
beliebter Spielplatz für Kinder. Hinter einer scharfen Biegung erscheint
plötzlich das Dorf am Fluß. Felder. Brachland. Holzhäuser, die sich um die
Kirche, den kleinen Hafen und die Bahnstation gruppieren. Etwas abseits die
Synagoge und gleich dahinter unser Haus mit dem Schuppen, wo das Eis im Sommer
gelagert wird, den Gemüsebeeten und den beiden Apfelbäumen im Garten. Seit den
großen Umbrüchen hat sich hier wenig geändert. Sogar Kirche und Synagoge
stehen den Gläubigen noch zur Verfügung. Im dreißig Kilometer entfernten
Nachbarort ist in der Synagoge nun ein Schweinestall und in der Kirche ein
Club für Atheismus – geleitet vom Juden Raikin. Sie haben schon Humor, diese
Kommunisten. Und sie haben Wort gehalten, zumindest was die Elektrifizierung
des Landes betrifft. Entlang der Bahnlinie, am Fluß, haben sie Masten
aufgestellt, glänzende Drähte gezogen. In jedem Haus hängt jetzt ein
Glühbirnchen von der Decke. Fünf Laternen beleuchten die Hauptstraße, so daß
man an mondlosen Nächten nicht mehr im Schlamm ausrutscht oder in Pfützen
steigt. Bald wird nichts mehr so sein wie früher. Große Zeiten stehen uns
bevor.
Nur daß in unserem Dorf viele Bauern
die Lichtschalter nicht anrühren, denn was in der Nacht ohne Feuer leuchtet,
kommt vom Teufel, sagen sie, und die Vorsitzende der örtlichen kommunistischen
Jugendorganisation "Komsomol" weigert sich am Samstag zu den Versammlungen zu
kommen, weil Schabbat ist. Ich kann darüber nur lachen. Ich bin klug und
gebildet, gehe schon in die neunte Klasse der Friedrich-Engels-Mittelschule,
nicht irgendwo, sondern in Gomel, wo man in der großen Halle der Hauptpost
telephonieren kann, wo es eine Forstwirtschaftliche Hochschule gibt und wo
bald sogar Straßenbahnen fahren werden.
Mein Vater hat es geschafft. Mit der neuen Macht ist er aufgeblüht, ist
selbstsicherer geworden, sieht seine große Zeit gekommen. Wer früher unter den
Verhältnissen gelitten und es zu nichts gebracht hatte, der steht heute auf
der Seite der Sieger. Seit 1922 ist Vater Sekretär des Dorfsowjets, obwohl ihn
seine Arbeit in der Regionalen Forstkooperative, wo er ebenfalls eine fixe
Anstellung hat, genügend in Anspruch nimmt. Deshalb hilft ihm meine Schwester,
den nötigen Papierkram für das Sekretariat zu erledigen. In den Sommerferien,
wenn ich von Gomel nach Hause komme, löse ich sie ab.
Die Arbeit ist anstrengend, aber nicht
schwer. Zur Zeit wird ein wichtiges Allunionsdekret umgesetzt. Jedem
Staatsbürger des Landes muß ein Personalausweis ausgestellt werden. Aus den
umliegenden kleineren Dörfern und Weilern kommen die Leute in unser
Gemeindeamt, wo ich hinter einem Schreibtisch sitze und mit schwarzer Tinte
ein Formular nach dem anderen ausfülle, bis mir die Finger schmerzen.
Leschtschenko, Sachar Kirilowitsch, wohnhaft im Weiler Bolotkino, verheiratet,
Landarbeiter, geboren am ... Der junge Bauer kratzt sich am Kinn. "Achtzehn
Jahre werden es wohl schon sein, daß mich meine Mutter geboren hat", sagt er,
überlegt noch einen Augenblick. "Vielleicht auch neunzehn." Ich schüttle den
Kopf. "Haben Sie eine Geburtsurkunde?" frage ich. Er denkt nach. "Ich hatte
eine, glaube ich. Aber die ist sicher verbrannt mit dem alten Haus. Als ich
auf die Welt gekommen bin, hat sich jedenfalls Antoschka, der alte Schmied,
das Genick gebrochen. Das weiß ich von meiner Mutter, Gott hab sie selig."
"Ich habe nie von einem Antoschka
gehört." "Hm." Seine Augenbrauen ziehen sich zusammen, die Stirn furcht sich
zu einem Dreizack. "Es hat damals diesen furchtbaren Hagel gegeben, der die
Tiere erschlagen hat, sogar Pferde." Vom großen Hagel haben mir schon andere
erzählt. Das Geburtsjahr 1905 steht demnach fest. "Kennen Sie den Tag Ihrer
Geburt?" frage ich. Was weiß ich. Mein Gott, Mädchen, es gibt Wichtigeres im
Leben." Zum wiederholten Male weise ich auf den Stuhl. Aber er bleibt stehen,
umklammert mit beiden Händen die Lehne. "Es war im Frühjahr", sagt er. "Ein
paar Wochen nach der Schneeschmelze." Nach einigem Zögern trage ich den
Fünften Mai in die vorgesehene Rubrik ein. 5.5.1905 – ein schönes
Geburtsdatum. Für Juden ist die Fünf eine magische Zahl. Obwohl der Bauer kein
Jude ist, soll er, wenn es nach mir geht, Glück haben im Leben. Er hat ein
sympathisches Gesicht mit Grübchen in den Wangen und kräftige Arme. Wenn ich
ihn anschaue, überkommt mich ein eigentümliches Gefühl, angenehm und
beängstigend zugleich, so daß ich schnell den Blick senke.
Ein anderer Bauer legt mir eine
Geburtsurkunde mit Doppeladler und ausgebleichtem Stempel vor. "Wie unser
Erlöser", sagt er stolz und zeigt mit dem Finger auf das Datum. Es ist der 24.
Dezember 1887. Schnell rechne ich nach und schreibe: "6. Januar 1888". Er
blickt mir über die Schulter. "Aber Mädchen!!!" Ich zucke zusammen. Ein
häßlicher Farbklecks breitet sich über das Blatt, verwandelt sich zuerst in
einen Käfer, dann in eine Spinne. Ich taste nach dem Stofftuch in der Tasche
meines Kleides.
"Der neue Kalender", murmele ich. "Der
Gregorianische. Nach der Reform von 1918. Wir müssen die Geburtsdaten nach dem
Kalender neuen Stils eintragen." "Ich möchte aber meinen richtigen Geburtstag
behalten!" bleibt der Bauer stur. "Die Sowjetmacht hat dekretiert, daß..." Ich
springe auf und schreie. Mit einer heftigen Bewegung hat der Bauer das
Tintenfaß vom Tisch gefegt. Die Tinte spritzt mir auf Schuhe und Strümpfe.
"Zum Teufel mit deiner Sowjetmacht, du Judengör!" brüllt der Mann und fuchtelt
mit der Faust vor meinem Gesicht. "Zuerst requiriert sie mein Getreide, bis es
meinen Kindern die Bäuche aufbläht, weil sie nichts zu fressen haben. Und dann
nimmt sie mir nicht nur den Tag, sondern auch das Jahr. Gib mir mein
Geburtsjahr zurück! Gib es mir zurück!" Ich verstehe, daß wir von den großen
Zeiten noch weit entfernt sind. Der Bauer erhält, wonach er verlangt.
An den Abenden kommen mein Vater und
der Vorsitzende des Dorfsowjets, um die Pässe zu unterschreiben. Links unten,
auf dem Blatt mit den Personalien, setzt Vater, der Sekretär, seine
Unterschrift, rechts der Vorsitzende, Iwan Murtschenko, genannt der Rote
Wanjka. Im Weltkrieg hochdekoriert, im Bürgerkrieg Kommandant einer Roten
Eliteeinheit, ist er für mich aufgrund seiner Aufrichtigkeit und
Unbestechlichkeit der einzige wahre Kommunist unter den Bolschewiken. Doch an
der Papierfront strauchelt er schnell. Angesichts der bereitliegenden Pässe
hat er Schweißausbrüche. Er krempelt die Ärmel hoch und seufzt: "Ach! So viel
Arbeit!" Wenn er schreibt, streckt er die Zunge aus, mit der er jeden mühsam
gesetzten Strich auf seinem Oberlippenbart nachzuzeichnen scheint. Ein
schiefes I, ein buckliges M. Am nächsten Tag werden die solcherart amtlich
beglaubigten Dokumente ihren Inhabern ausgehändigt.
Eines Tages betritt eine junge Frau,
sie ist vielleicht zwei, drei Jahre älter als ich, die Amtsstube. Nichts in
ihren Bewegungen verrät jene Mischung aus Mißtrauen, unterdrückter Angst und
Ehrfurcht, die ich sonst meist erleben muß. Sie legt das Photo, das sie wohl
wie alle anderen beim alten Isaak in seinem kleinen Atelier neben dem Bahnhof
machen ließ, auf den Tisch und setzt sich unaufgefordert auf den Stuhl. Ihr
Gesicht mit dem schmalen Mund und dem breiten Kinn kommt mir bekannt vor, aber
ich denke vorerst nicht weiter darüber nach, breite mit einer über Wochen
erworbenen Routine ein Formular auf dem Tisch aus, streiche über die leicht
gerippte Oberfläche des breitkörnigen Papiers.
"Name?"
"Rabinowitsch. Rivka Mowschewna."
Die Stahlfeder kratzt leise und gleichmäßig. Meine O’s sind rund wie
Mühlsteine, die A’s wie flinke Äffchen mit langen Schwänzen. Und plötzlich
fällt mir ein, woher ich das Gesicht der Frau kenne. Aus der Mühle
stromabwärts, dort wo der Bach in den Fluß mündet. Die Mühle gehörte früher
der Witwe Sakodower, die 1920 während eines Pogroms ermordet wurde. Nun ist
der Betrieb in den Besitz der staatlichen Kooperative übergegangen und
beschäftigt drei oder vier Arbeiter. Mowsche Rabinowitsch wurde nach der
Übernahme als provisorischer Leiter bestellt. Doch das Mädchen, das mir
gegenübersitzt, ist nicht seine Tochter. Sie heißt Jewdokija und ist
Ukrainerin. Vor zwanzig Jahren ist ihr Vater als Arbeiter am Bahnbau in unsere
Region gekommen und hier geblieben. Jewdokija ist mir aufgefallen, weil sie
kräftig ist wie ein Mann und die Getreide- und Mehlsäcke mit einer so
verbissenen Miene schleppt, als führte sie einen ganz persönlichen Krieg gegen
sich selbst und die Welt. Ich lege die Feder weg.
"Karastschuk", sage ich. "Jewdokija, eh..., Isajewna, wenn ich mich nicht
irre."
Ich schaue sie an und sie mich.
"Hast du nicht gehört? Schreib, was ich dir gesagt habe!"
Keine von uns senkt die Augen.
"Geburtsurkunde", flüstere ich. Mund und Gaumen fühlen sich plötzlich so
trocken an.
"Hab ich nicht", sagt sie. "Verloren, verbrannt, gestohlen... Bin ich die
Hüterin der Papiere meiner Eltern?"
Die letzten Sonnenstrahlen eines
spätsommerlichen Tages fallen durch das offene Fenster der Amtsstube. Die über
dem Tisch an einem ungesicherten Draht hängende Glühbirne schaukelt leicht.
Ein ovaler Schatten tanzt über das Gesicht meines Gegenübers. In der Dämmerung
wirken ihre Augen wie hinter einem Schleier, matt und unwirklich.
"Sonst irgendwelche Dokumente? Zaristische? Deutsche? Polnische?"
"Da! Schau her! Das ist mein Dokument!" Sie macht ein unanständiges Zeichen
mit den Fingern und gibt einen jener langen, komplizierten und phantasievollen
russischen Flüche von sich, die mit der Mutter oder Großmutter des Adressaten
beginnen und mit seinen Kindeskindern enden.
Als hätte man mich mit Exkrementen beworfen.
"Du, hör auf damit!" höre ich mich sagen. Meine Stimme ist heiser und tief.
"Hör auf, sonst hau ich dir eine runter! Hör auf!"
Alles muß ich mir auch nicht gefallen
lassen von diesem Luder, das kaum älter ist als ich. Ich bin nicht irgendwer.
(Trotzdem haben meine letzten Worte mehr als Bitte, denn als Drohung
geklungen.) Ich bin eine Amtsperson. Ich erfülle eine wichtige Aufgabe. (Sie
erschlägt mich, ganz ohne Zweifel!) In der Schule in Gomel bin ich die beste
der Klasse. Sogar der Direktor hat mich gelobt. (Dieser dumme Bauerntrampel
ist stärker als ich!) Meine Freundinnen schätzen mich. (Sie haßt mich, gleich
schlägt sie zu!)
Sie steht auf, beugt sich zu mir über
den Tisch. Etwas zieht sich mir im Magen zusammen. Meine Hände drehen den
Holzstiel der Feder, schneller, immer schneller. Wenn ich doch nur aufstehen
könnte, um mir aus der anderen Ecke des Zimmers ein Glas Wasser zu holen.
Reflexartig drehe ich den Kopf zur Seite. "Schlag mich! Versuch es!" Sie hat
leise gesprochen, beinahe geflüstert. Es klingt fröhlich. Ein leichtes Lächeln
huscht über ihr Gesicht. Sie setzt sich wieder, kreuzt die Arme auf der Brust,
schlägt die Beine übereinander. "Ich bin nicht lebensmüde", sage ich und
lächle nun ebenfalls, kann wieder durchatmen. "Was mußt du noch wissen?" fragt
sie. "Geburtsdatum!" "12. Oktober 1906."
Ich spüre, wie ihr spöttischer Blick
auf mir lastet. Als würden kleine Nadeln in meinen Körper dringen. Ich springe
auf, laufe zur Wand, zum Lichtschalter. Die 60 Watt Glühbirne verströmt ein
sattes, kaltes Licht. Das Mädchen wendet mir die milchig-bleiche Maske ihres
Gesichts zu – undurchsichtig, undeutbar, wie zuvor, als sie eingetreten war.
Mit den gespreizten Fingern ihrer rechten Hand fährt sie durch ihr zerzaustes,
blondes Haar. Diese Geste hat etwas Beruhigendes.
"Ich mache es so, wie du willst, die Sowjetmacht ist großzügig", sage ich und
frage nun doch: "Aber wozu der falsche Name? Und ein jüdischer noch dazu. Die
Leute wissen ja ohnehin, wer du wirklich bist."
"Kümmer du dich um deine eigenen
Angelegenheiten", antwortet sie schroff, doch habe ich das Gefühl, daß sie es
mir trotzdem erzählen wird. Sie zögert einen Augenblick, mustert mich prüfend.
"Es ist nämlich so. Ich möchte in diesem elenden Kaff nicht bleiben. Meine
Eltern sind sowieso tot, ich habe niemanden. Ich will was erreichen in meinem
Leben. Ich geh nach Minsk oder sogar nach Moskau oder Leningrad." "Aber
wozu..."
"Wozu? Gerade du solltest es besser
wissen. Wer geht denn in der Stadt zur Schule, wo man all die klugen Dinge
lernt, die man braucht, um irgendwann anderen anzuschaffen, anstatt Mehlsäcke
zu schleppen? Du tust es und Chaim und Rahel, die Tochter des Kesselflickers,
nicht Jewdokija. Wie erreicht man am besten seine Ziele in einem Land, wo die
Krummnasigen regieren? Also! Schreib! Schreib! Und vergiß den Stempel nicht."
Es fällt mir schwer zu beschreiben, wie
ich mich nach diesen Worten fühle. Wie mir das Blut ins Gesicht schießt, wie
ich zittere, wie ich mich hasse, weil ich nichts erwidern kann. Ich habe
Angst. Ich bin verwirrt. Ich bin ein kleines Mädchen. Ich hasse meinen Vater,
der mir diese Arbeit aufgebürdet hat, der nicht bei mir ist und mich gelehrt
hat zu schweigen. Ich hasse die großen Zeiten, die uns Glück bringen werden
und die unser aller Sehnsucht sind. Ich schaue dem Mädchen nach, wie es festen
Schrittes aus dem Zimmer geht und die Tür hinter sich schließt.
Jahrzehnte später sehe ich Jewdokija in
Leningrad wieder. Ich habe studiert, gearbeitet, habe geheiratet, zwei Kinder
geboren, habe meinen Mann verloren, seit einigen Jahren bin ich Großmutter.
Der Krieg hat die alte Welt hinweggefegt, in meinem Geburtsort – zwei Dutzend
dunkelgrauer Betonbauten, die sich um eine Industrieanlage gruppieren - gibt
es keine Juden mehr, und seit mein Vater tot ist, habe ich meine Muttersprache
Jiddisch fast vergessen. Stalin wuchs heran zum Gott und ist ganz ungöttlich
gestorben. Die Ängste und schlaflosen Nächte ließ er uns zurück. Chrustschow
hat alles verändert und ist vom Sockel gefallen, sein Nachfolger kriecht
schnaufend auf das Mausoleum des großen Initiators, steht dort jahraus,
jahrein als Symbol der Unverrückbarkeit und Sicherheit unseres Lebens.
Der Alltag ist ereignislos, die
interessantesten Menschen trifft man in der Schlange vor dem Metzgerladen. Was
für Gespräche habe ich dort geführt! Sie ist schon eine wunderbare Erfindung,
die Mangelwirtschaft. Wann hat man sonst Zeit füreinander, außer in der
Schlange, welche, einer großen Raupe gleich, vorwärts kriecht, den Kopf
verliert, sich selbst regeneriert, bis die Tür des Ladens krachend ins Schloß
fällt. Trippelfüßchen, Geborgenheit, Neugierde, Überraschung, Herzlichkeit und
der Ellbogenchek unter die Rippen, daß du glaubst, du hauchst das Leben aus,
und kommst dann meist doch noch irgendwie ans Ziel. Ein Pfund knochigen
Schweinefleisches als Trophäe.
Nach so vielen Jahren erkenne ich
Jewdokija, nein – ich müßte doch Rivka sagen -, sofort, obwohl beinahe alles
anders geworden ist in diesem Gesicht, das mit ihrem Körper aufgegangen ist
wie eine Teigmasse. Sie steht vor mir. Etwas auf der Straße erregt ihre
Aufmerksamkeit, sie dreht sich um, schaut mich an, zieht die Augenbrauen hoch.
"Jewdokija?!" "Es ist ein Menschenalter her, daß mich jemand so genannt hat",
murmelt sie und zwingt sich ein Lächeln ab. "Vor dem Krieg war ich Rivka
Mowschewna. Heute sagen alle Raissa Markowna zu mir." Ein Augenblick des
Schweigens für fünf Jahrzehnte. Reglos stehen wir einander gegenüber.
"Graschdane (Bürger), schließt auf, haltet die Schlange nicht auf!" tönt es
von hinten.
Eine Stunde später bin ich bei ihr zu
Hause. Sie schenkt mir Tee ein. In der Erdgeschoßwohnung müssen sich mehrere
Familien vier Räume teilen. Ihr Zimmer ist groß, in früheren Zeiten ist es
wohl ein großbürgerlicher Salon gewesen. Trotzdem kann man sich kaum bewegen,
muß sich zwischen den Möbelstücken durchzwängen, als vollführe man einen
neumodischen Tanz. Das monotone Rauschen hinter der Wand komme aus der
Toilette, erklärt sie mir. Seit Jahren schon sei die Spülung defekt. Ihr Mann,
ein hinkender Kriegsveteran, begrüßt mich mürrisch und zieht sich in die Küche
zurück. Der Sohn hält ein kleines Kind in den Armen, schaukelt es sanft. Die
Schwiegertochter hat Abendschicht und ist deshalb nicht zuhause.
"Mein Jaschenka hat zwei Tage frei",
erzählt mir Rivka, "ab morgen hat er wieder achtundvierzig Stunden Dienst. Er
ist nämlich Krankenpfleger im Städtischen Altersheim."
"Altersheim ist gut", sagt Jascha, während er sein Kind, das in seinen Armen
eingeschlafen ist, vorsichtig ins Gitterbett legt. "Ein Hundezwinger ist ein
Sanatorium dagegen."
"Dabei wollte er Arzt werden." Rivka seufzt. "Er hat einen klugen Kopf, mein
Jascha, fast so als wäre er ein richtiger Jude. Aber man hat ihn nicht
genommen, eben weil man glaubte, er sei ein richtiger Jude."
"Jetzt fängt Mama wieder mit der Legende an, daß ich kein Jude bin." In
Jaschas Stimme schwingt die Verärgerung eines Menschen mit, der es leid ist,
über ein altes, längst abgehandeltes Thema zu diskutieren.
"Sie kann es bestätigen!" Die Mutter macht eine Kopfbewegung in meine
Richtung. "Das ist nämlich die kleine Jüdin, die mir damals den Ausweis
ausgestellt hat, du kennst doch die Geschichte..."
"Jetzt hör endlich auf!" Jascha fällt ihr ins Wort, wird laut und befreit mich
von der unangenehmen Verpflichtung, als Zeugin aufzutreten. "Du mußt endlich
lernen, dazu zu stehen, was du bist. Zu lange hat man auf unserem
leidgeprüften Volk herumgetrampelt."
"Hörst du das! Hörst du das!" schreit die Mutter. "Ein richtiger Zionist. Gut,
daß sein seliger Großvater so etwas nicht miterleben muß. Er war Sohn eines
Popen."
"Mama, schau mich an!" Jascha ist
aufgestanden, wendet sich aber nicht seiner Mutter, sondern mir zu. Die Arme
breitet er unnatürlich nach Außen, so daß sein Oberkörper an ein Dreieck
erinnert. "Wenn ich kein vollblütiger Jude bin, dann bin ich der Kaiser von
Japan."
"Sehr erfreut, Eure Majestät", murmelt die Mutter.
In der Tat sieht Jascha aus, als wäre er eine lebendig gewordene
Stürmerkarikatur. Die Nase wie der Hauptkamm des Kauskasus. Die Lippen
sinnlich, rot wie die Fahnen bei den Aufmärschen am 1. Mai. Das schon etwas
lichte Haar kraus und schwarz wie Teer, unterbrochen von einzelnen weißen
Strähnen. Und in den dunkelbraunen, glänzenden Augen spiegelt sich jene
altbekannte Traurigkeit - der Schmerz eines seit zweitausend Jahren
unterdrückten und getretenen Volkes...
"Und der Vater...?"
"Wassjka? Kommt aus dem Dorf
Peripitjulkino bei Orenburg. Der hat soviel Jüdisches in sich wie unser
heißgeliebter Parteivorsitzender von einem Professor für Nuklearphysik."
Ein höchst interessantes Phänomen, denke ich. Mein Sohn Kostik hat schon
recht, wenn er sagt, wir lebten im Land der begrenzten Unmöglichkeiten.
"Aber da waren doch sicher andere", frage ich schüchtern. "Ich meine, außer
Wassjka."
"Was glaubst du, weshalb ich seit vierzig Jahren fast tagtäglich mit meinem
Mann streite... Lauter Vorwürfe und Bezichtigungen! ... Aber nein, es geht
sich in keinem einzigen Fall aus. Nur Wassjka kann der Vater sein."
Der Augenblick erscheint mir günstig,
weitere Fragen zu stellen. Bereitwillig erzählt sie mir ihre Lebensgeschichte,
darüber wie sie in Minsk in einer Fabrik gearbeitet, eine Abendschule und
danach die Abenduniversität für Arbeiter absolviert hat, wie sie nach
Leningrad übersiedelt und sich zur leitenden Angestellten eines
Maschinenbaukombinats emporgearbeitet hat, wie sie zu Kriegsbeginn mit der
gesamten Belegschaft der Fabrik auf den Ural evakuiert worden ist. "Wir waren
Helden an der Arbeitsfront. Zehn Tage Arbeit, ein Tag frei, zwölf Stunden
jeden Tag." Ende der Vierziger Jahre änderte sich plötzlich alles. Raissa
Markowna – für ihre Vorgesetzten plötzlich wieder Rivka Mowschwna – verlor,
des Kosmopolitismus verdächtigt, ihre leitende Position, mußte das Kombinat
verlassen und sich mit Gelegenheitsarbeiten durchschlagen. Der Sohn durfte
nicht studieren, und sogar jene fernen Verwandten in der Ukraine, an die sie
sich wandte, damit sie ihr Nichtjudentum bestätigten, wollten nichts von ihr
wissen.
"Laß uns in Ruhe, haben sie mir gesagt.
Wenn man erfährt, daß wir mit einer Jüdin verwandt sind, vielleicht sogar
selber Juden sind, dann Gnade und Gott. Du weißt ja, wie das ist. Alle sagen,
du bist ein Kamel, und dann beweis einmal, daß du keines bist..."
Sie atmet schnell und laut, so als wäre sie im Laufschritt drei Treppen
hinaufgelaufen. "Ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, dich zu suchen,
damit du meine Version bestätigen kannst. Aber dann habe ich mir gedacht –
wozu sollst du für meine Dummheit geradestehen und womöglich Schwierigkeiten
bekommen!"
Nach Stalins Tod war die unmittelbare
Bedrohung durch Deportation und Tod für die Juden der Sowjetunion nicht mehr
gegeben, die Diskriminierung aber blieb. "Diese verdammten Saujuden", schimpft
Jewdokija-Rivka. "Zuerst erobern sie das Land, krempeln es um, zerschlagen
alles und dann können sie nicht einmal die Macht halten und lassen sich wieder
verfolgen. Der einfache Mensch kann sich auf nichts mehr verlassen. Ständig
wird er von den Juden betrogen. Ein mieses Volk ist das. Entschuldige, du
persönlich bist nicht gemeint." Aber ich bin nicht beleidigt.
"Du hast sicher recht, Rivka Mowschewna", sage ich.
Für einen Augenblick blitzt Wut in
ihren Augen auf. Das Teeglas in ihrer Hand beginnt zu zittern, und auf ihrer
hellen Bluse sehe ich braune Punkte gleichförmig wachsen. Sie stellt das Glas
auf den Tisch und bedeckt - eine nutzlose Verlegenheitsgeste - mit den Händen
den beschmutzten Teil der Bluse. Ich sollte aufstehen und sie in die Arme
nehmen, ihr von mir und ähnliche und noch viel schlimmere Geschichten
erzählen, etwas Banales sagen, das alles viel leichter und gleichzeitig viel
schwerer macht. Ich bleibe sitzen.
"Und nun möchte Jaschenka nach Israel
auswandern. Von ein paar Wochen hat er die Dokumente eingereicht."
"Ich will so schnell wie möglich weg von hier", sagt Jascha, der während der
Erzählung seiner Mutter geschwiegen hatte. "Wir Juden haben nun endlich ein
Land, wo wir uns zuhause fühlen können."
"Da hörst du es selbst." Rivka-Jewdokijas Stimme klingt kraftlos. "Jaschenka
möchte uns, Wassja und mich, in seinen Judenstaat mitnehmen. Wassja wäre ja
nicht abgeneigt. Er träumt von einer Wohnung am Meer. Mit Balkon. Und einer
Palme im Blickfeld. Ich selbst weiß ja nicht mehr, was ich will."
"Na ja, vielleicht findest du doch noch das Glück... Dort wo die Krummnasigen
regieren", sage ich. Sie schweigt und schenkt mir wieder Tee ein.
Vladimir Vertlib, geb. 1966 in
Leningrad, emigrierte 1971 mit seiner Familie nach Israel. Von 1971 bis 1981
"Odysee" durch Europa, Israel und die USA, seit 1981 ständiger wohnsitz in
Österreich. Österreichischer Staatsbürger seit 1986. Studium der
Volkswirtschaftslehre in Wien. Lebt seit 1993 als freischaffender
Schriftsteller, Sozialwissenschaftler und Übersetzer in Wien und Salzburg.
|