|

"Zeichne, was du siehst"
Ausstellung der Künstlerin und Zeitzeugin
Helga Weissová-Hosková
Zur Eröffnung der Ausstellung mit Kinderzeichnungen aus
Theresienstadt sprach am Dienstag, 26.Januar 1999 die
Bundestagsvizepräsidentin Anke Fuchs.
|

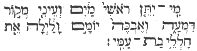
Jirmijahu 8.23
|
. |
"Sei doch mein Kopf ein Wasser
und meine Augen ein Tränenquell,
daß ich weinen könnte
Tag und Nacht
um die Erschlagenen der Tochter meines
Volkes". |
Morgen, am 27. Januar, gedenkt der
Deutsche Bundestags eines millionenfachen Mordes, der in deutschem Namen
begangen wurde.
Auch mehr als 50 Jahre nach dem Untergang
des nationalsozialistischen Terrorregimes bleibt das Geschehene für uns
Nachgeborene immer noch unfaßbar.
Auch die zahlreichen Reden, die morgen aus Anlaß des
Holocaust-Gedenktages gehalten werden, werden diese Unfaßbarkeit
unterstreichen. Die Ratio versagt. Die systematische Vernichtung der
deutschen und europäischen Juden und anderer Bevölkerungsgruppen durch
die nationalsozialistische Vernichtungsmaschinerie kann in ihren
erschütternden Dimensionen mit rationalen Kategorien nicht erfaßt
werden. Um so wichtiger bleibt es, das politische Umfeld, das Verhalten
der Menschen immer wieder zu durchleuchten.
Jede Konfrontation mit den Geschehnissen unserer jüngeren Vergangenheit
ruft unweigerlich auch Schmerz, Scham und Ratlosigkeit hervor. Denn wir
sprechen nicht nur über Geschichte, über Ursachen und Geschehnisse,
sondern wir sprechen von Menschen, die umgebracht wurden. Kinder,
Frauen, Männer, die ermordet wurden, weil sie Juden waren.
Die Unfähigkeit, die entsetzlichen Greueltaten der
nationalsozialistischen Machthaber zu begreifen und einzuordnen,
schlagen sich auch heute noch - über ein halbes Jahrhundert danach - im
Streit über eine angemessene Form des öffentlichen Gedenken nieder.
Vieles, was an öffentlicher Trauer- und Erinnernungsarbeit geschieht,
ist geprägt von Rat- und Hilflosigkeit.
Wie kann man der Tragödie gedenken, das Grauen erinnern, die Schuld
begreifen? Die Diskussion über die angemessene Gestaltung einer
zentralen Gedenkstätte zum Gedenken an die Millionen ermordeter
europäischer Juden in Berlin hat uns allen diese Schwierigkeiten im
Umgang mit der Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen
Schreckensherrschaft deutlich vor Augen geführt. Diese Diskussion ist
gut und wichtig - und sie wird und muß schmerzlich und schwierig
bleiben.
Das Gedenken an das dunkelste
Kapitel unserer Geschichte soll uns aber auch jetzt und in Zukunft für
neue Gefahren wachsam machen, die unserem demokratischen Rechtsstaat von
totalitären und inhumanen Strömungen jeglicher Art immer wieder drohen.
Es muß gelingen, die Schrecknisse der Vergangenheit in unser
kollektives Bewußtsein dauerhaft zu verankern. Dann gibt es die Chance,
daß sich historische Irrwege und Fehler in Zukunft nicht wiederholen.
Die Möglichkeiten des Erinnerns sind vielfältig und nicht auf
eine bestimmte vorgegebene Form festgelegt. Mehr noch: um die
historische Wirklichkeit in all ihren Facetten nachvollziehen zu können
und ein Gespür dafür zu erhalten, wie die betroffenen Menschen wirklich
lebten, Tag für Tag, müssen wir uns in unterschiedlichster Weise
erinnern.
Die Ausstellung der tschechischen Malerin Helga
Weissová-Hosková "Zeichne, was Du siehst" kann uns einen unmittelbaren
und nachhaltigen Eindruck vom Alltag im Terror vermitteln.
Diese Ausstellung leistet etwas ganz Wesentliches: sie kann
jedem, der sich auf eine Auseinandersetzung mit den hier präsentierten
Bildern einläßt, einen unvermittelten Einblick in das Leben der
Betroffenen, ihre Erfahrungen und Gefühle im alltäglichen Leben geben.
Wer vor den hier präsentierten Bildern verweilt, wird gefangen
genommen und ergriffen. Die Bilder erzählen von der Alltagswirklichkeit
eines heranwachsenden Kindes im Lager Theresienstadt. Anders als in den
über das abstrakte Medium der Sprache vermittelten Zeitzeugen-Berichten
werden in den Bildern reale historische Erfahrungen von Schmerz,
Verzweiflung und Leid, aber auch scheinbar banale Alltagssituationen
unvermittelt und authentisch wiedergegeben.
Den Betrachter lassen diese Bilder nicht ungerührt: die
Zeichnungen, die die Ängste und Leiden in Theresienstadt aus dem
Blickwinkel eines Kindes widerspiegeln, lassen etwas von der tiefen
Verzweiflung und der Ausweglosigkeit derjenigen erahnen, die in
die Fänge der nationalsozialistischen Vernichtungsmaschinerie geraten
waren. Auf diese Weise tragen die Bilder von Helga Weissová-Hosková
vielleicht mehr als andere Kommunikationsmedien dazu bei, unser
emotionales Bewußtsein zu schärfen und unser Mitgefühl für die Leiden
der Betroffenen zu stärken.
Die Ausstellung, die zu eröffnen ich heute die Ehre habe,
stellt zweifellos eine Bereicherung in unserem Bemühen dar, die
Erinnerung an die Zeit der Naziherrschaft und die damit verbundenen
schrecklichen Geschehnisse wach zu halten. Gerade Kindern und
Jugendlichen, die heute in etwa im Alter der Künstlerin zur Zeit ihrer
Inhaftierung in Theresienstadt sind, kann über die Auseinandersetzung
mit den Bildern von Frau Weissowá ein Zugang zur NS-Zeit eröffnet
werden.
Frau Weissowá hat mit ihren Bildern das Unfassbare lebendig
gemacht. Sie zeigen, wie die Betroffenen sich in der abgeschlossenen
Welt des Gettos so gut es ging einzurichten versuchten und dennoch
ständig um ihr eigenes und das Leben ihrer Angehörigen fürchten mußten.
Die Darstellung alltäglicher Szenen wie die morgendliche Wäsche im
Gemeinschaftswaschraum, die Essensausgabe, die bedrückende Bilder von
alten Menschen, die in tragischer Verkennung ihrer tatsächlichen
Situation glaubten, daß sie in einen Kurort geschickt würden,
dokumentieren eine furchtbare historische Erfahrung, wie sie
eindringlicher und ergreifender kaum sein könnte - so auch die
Zeichnungen über die Ankunft in Theresienstadt oder den Abtransport in
die Vernichtsungslager.
Beklommen stehen wir vor dem Geburtstagsbild für Fränzi.
Fränzi erhält zu ihrem 14. Geburtstag von ihrer Freundin Helga einen
gemalten Traum, den Traum von einer Rückkehr in die Geborgenheit des
früheren Lebens. Wir wissen, daß Fränzi niemals einen Kinderwagen durch
Prag schieben sollte, sie erstickte im Gas von Auschwitz, wenige Monate
später. Das Jahr 1957, von dem die beiden Mädchen damals träumten, haben
andere erlebt, Fränzi nicht mehr, weil es niemanden gab, der ihren
Mördern Einhalt geboten hätte.
Helga Weissowá wurde mit gerade zwölf Jahren aus ihrer
Kindheit gerissen und zusammen mit ihren Eltern nach Theresienstadt
deportiert. Hier verbrachte sie drei Jahre, bevor sie 1943 mit ihrer
Mutter nach Auschwitz gebracht wurde. "Zeichne, was Du siehst!"
hatte der Vater gleich zu Beginn ihrer Internierung in Theresienstadt
dem künstlerisch begabten Kind geraten und so machte sich Helga Weissowá
daran, die traurige Wirklichkeit im Getto zeichnerisch zu erfassen.
Wer die Bilder betrachtet, wird verstehen, wenn Frau Weissowá
die Eindrücke und Wahrnehmungen, die ihren Werken zugrunde gelegen
haben, das Ende ihrer Kindheit markierten: Das Leben im Getto war ein
Leben auf Abruf, ein armseliges und trostloses Leben unter der
Gewaltherrschaft, daß insbesondere Kindern jede Chance auf eine
"normale" und angemessene Entwicklung raubte. Es wird berichtet, daß
Kinder aus Theresienstadt ihr Alter so angaben: "12 Jahre, 7 Monate, 4
Tage." Es waren Kinder, die wußten, daß ihre Tage gezählt waren.
Dies mag uns, die wir all dies nicht erleben mußten, eine
Ahnung davon geben, wie sehr Haß, Gewalt und Tod das Leben der den
Nazi-Schergen schutzlos ausgelieferten Kinder prägte. Noch schwerer mag
den Betrachter die Tatsache bedrücken, daß die Kinder von Theresienstadt
so gut wie keine Überlebenschance hatten. Von den 15.000 Kindern, die in
Theresienstadt interniert waren, überlebten nur etwa einhundert. Es
kommt einem Wunder gleich, daß Helga Weissova überlebt hat. Ihre Bilder
sind mahnende Zeitzeugnisse.
Die Bilder von Frau Weissowá zeigen Menschen in einer Welt von Haß und
Ohnmacht. Die Welt der Ordnung und des Rechtes hat sich in eine Welt der
Menschenverachtung und des Todes gewandelt. Die Bilder bringen das
Unverständnis der Menschen über diese Welt anschaulich zum Ausdruck.
Liebe Frau Weissova-Hoskova, Sie sind heute bei uns, und wir sind sehr
dankbar dafür, daß Sie hier mit Ihrem Werk und mit Ihren Erinnerungen
Zeugnis ablegen. Sie haben der Verzweiflung Ihre künstlerische Arbeit
entgegengesetzt.
Heute sind Sie hier, um gemeinsam mit uns wider das Vergessen und die
Ignoranz ein Zeichen der Erinnerung und für Humanität zu setzen.
Extremismus, Diktatur und Totalitarismus sind bei uns in
Deutschland nach vielen Jahren der Unterdrückung und des Leids endlich
überwunden. Zum Ende dieses so tragischen und grausamen Jahrhunderts
leben alle Deutschen in Frieden, Freiheit und sozialer Sicherheit.
Ausstellungen wie diese erinnern uns daran, daß wir immer verpflichtet
sind, stets wachsam zu sein und den Feinden der Humanität und der
Freiheit frühzeitig und kraftvoll entgegen zu treten.
Denn auch heute noch gibt es Menschen, die aus ideologischen
Gründen oder aufgrund materieller Interessen das elementare Recht auf
Leben nicht respektieren. Daß Menschen zur Barbarei fähig sind, wissen
wir. Wichtig ist, daß wir uns immer bewußt bleiben, wie hemmungslos
menschliche Boshaftigkeit und Niedertracht wüten können, wenn die
Grenzen der Humanität und des Rechts erst einmal überschritten sind.
Auch wenn es uns lästig und mühsam erscheint, uns mit dem
deutschen Rückfall in die Barbarei auseinanderzusetzen, sind wir
Deutsche auch heute und in Zukunft verpflichtet, dies zu tun. Denn nur
so können wir auch ermessen, wie wertvoll und schützenswert unsere
freiheitlich-demokratische Ordnung ist, die jedermann gleichermaßen
unter den Schutz des Gesetzes stellt. Und diese humane Ordnung stellt
sich nicht von selbst ein, sondern bedarf des bürgerlichen Engagements.
Wenn es Gefährdungen gibt, bedarf es des Mutes, nicht wegzuschauen,
nicht zu verdrängen, nicht zu verniedlichen.
Ich danke darum dem niedersächsischen Verein zur Förderung von
Theresienstadt für die Bemühungen, nach so vielen Jahren, diese
Zeichnungen nun auch einem größeren Publikum bekannt zu machen.
Ausstellung und Katalog geben uns die Möglichkeit, aus einer sehr
persönlichen Perspektive nachzuempfinden, was Totalitarismus und
politischer Extremismus für die betroffenen Opfer bedeutet.
Frau Weissowá, ich danke Ihnen ganz besonders herzlich dafür,
daß sie diese Ausstellung möglich gemacht haben, obwohl die
Konfrontation mit der Vergangenheit Ihnen persönlich sehr schwer
gefallen ist.
Ich wünsche der Ausstellung viele Besucher, damit viele
Menschen erfahren, was Menschen Menschen angetan haben. Ganz besonders
wünsche ich mir, daß viele junge Menschen die Ausstellung besuchen
werden, also diejenigen, die immer seltener Gelegenheit haben, mit
Menschen zu sprechen, die die Zeit der Nazi-Diktatur noch erlebt und
durchlitten haben. Denn diese Bilder sprechen und erwecken Mitgefühl. In
diesem Sinne wünsche ich der Ausstellung und Ihnen Frau Weissowá
persönlich alles Gute und viel Erfolg.
Quelle der Abb.: Terezín 1941-1945,
Prague 1965
Veröffentlicht vom Rat der jüdischen Gemeinden der
Tschechosslowakei
haGalil
onLine - Donnerstag 28-01-99 |