|
Rudolf Ekstein (1912 - 2005):
"Wiener mit amerikanischem
Pass"
Vor 70 Jahren, am 22.12.1938, floh der
Wiener Psychoanalytiker und Pädagoge Rudolf
Ekstein in die USA
Von Roland Kaufhold
"Als es mir im Sommer 1938 gelang zu
flüchten und ein neues Leben im Ausland zu
beginnen, war ich voller Angst und Wut.
Aller Widerstand war vergebens gewesen. Der
Kampf gegen den Faschismus, seit 1934
sogenannter illegaler Widerstand, war
verloren. Ich mußte weg, aber nicht nur als
Jude, sondern auch als Illegaler, als
Widerstandskämpfer. Ich war ein junger Mann
und versprach mir, ich würde nie wieder
zurückkommen, ich würde nie wieder Deutsch
sprechen. Deutsch war für mich die Sprache
der Unterdrücker, der Hakenkreuzler."
|
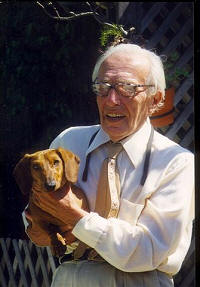
©
Daniel Benveniste |
Diese Erinnerungen an seine
50 Jahre zurückliegende Vertreibung aus Wien
stammen von Rudolf Ekstein, einem der
bedeutendsten Pioniere der
Psychoanalytischen Pädagogik (s. Kaufhold
1993, 2001, Wagner 2002). Vorgetragen hat er
sie 1987 auf dem großen Wiener Kongress
"Vertriebene Vernunft" (Ekstein 1987, S.
472), an welchem Ekstein gemeinsam mit
seinen aus Wien vertriebenen Berufskollegen
und Freunden Bruno Bettelheim, Ernst
Federn und Else Pappenheim
teilnahm. Bei seiner Emigration aus Wien war
der junge, von Sigmund Freud und
Siegfried Bernfeld psychoanalytisch
geprägte Intellektuelle 26 Jahre alt. Alles
musste er hinter sich lassen: Seine Sprache,
seine Heimat, seine Freunde, seine
politischen Überzeugungen, seine Familie –
der größte Teil seiner Familie wurde von den
Nationalsozialisten ermordet. 1936 hatte
Rudolf Ekstein seine Promotion zum Thema
"Zur Philosophie der Psychologie" an der
Wiener Universität noch abzuschließen
vermocht, am 6.3.1937 machte er sein
Rigorosum. Ein Jahr später, im Sommer oder
Herbst 1938, floh er aus Wien, zuerst nach
England, dann in die USA, wo er am
22.
Dezember 1938
ankam - und die seine zweite
Heimat werden sollte.
Der 70. Jahrestag seiner
Ankunft in den USA: ein Anlass, sich an das
Leben und Wirken dieses charmant-kreativen
"Wieners mit amerikanischem Pass", so seine
ironische Selbstbeschreibung, zu erinnern.
Rudi Ekstein verstarb vor gut drei Jahren in
Los Angeles (s. Kaufhold 2005).
Der Rudi aus Los Angeles
"Ich bin´s, der Rudi aus Los
Angeles." Eine typische Bemerkung für Rudolf
Ekstein, den liebenswert-optimistischen
Pionier der Psychoanalytischen Pädagogik.
Mit diesen Worten stellte sich Rudolf
Ekstein dem damaligen österreichischen
Bundeskanzler Franz Vranizky vor, als er
1992 anlässlich des Ottokringer 1. Mai-Zugs
auf der Ehrentribüne Platz nahm. Damals war
er bereits 80 Jahre alt, und immer noch
reiste er regelmäßig, für gut zwei Monate,
als Gastprofessor und Supervisor von Los
Angeles nach Wien und Salzburg, gelegentlich
auch in die Bundesrepublik. 1961 war er
erstmals wieder privat nach Wien gereist,
und 1970 wurde er offiziell als Gastredner
der Freud-Vorlesung der Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung (WPV)
eingeladen.
Seitdem ist er, gemeinsam mit
seiner griechischstämmigen Frau Ruth, nahezu
jährlich nach Wien gereist, im Oktober 1995
erhielt er von der Wiener Universität ein
Ehrendoktorat – anlässlich dessen Verleihung
an der Wiener Universität antisemitische
Töne zu vernehmen waren. Jeweils rechtzeitig
zum 1. Mai kam er an, und kehrte dann wieder
vor dem 4. Juli, dem amerikanischen
Unabhängigkeitstag, nach Los Angeles zurück.
Diesen Festtag verbrachte er im Kreis seiner
amerikanischen Freunde, darunter zahlreiche
jüdischen Emigranten aus Österreich, in
seinem Haus in Los Angeles, Santa Monica. In
der 10-Millionen-Stadt leben etwa 400.000
Juden.
Jugend und Studium der
Freudschen Psychologie
Geboren wurde Rudolf Ekstein
am 9.2.1912 als Kind jüdischer Eltern im
Wien Sigmund Freuds, das ihn prägte, und
zwar in der im 9. Bezirk gelegenen Nußgasse.
Der Vater war Buchhalter, die Mutter starb
bald nach seiner Geburt. Als Kleinkind wurde
er daher der Obhut einer katholischen Frau
übergeben, die er als liebevolle
"Ersatzmutter" in Erinnerung hatte. Und doch
vermittelte sie ihm früh das Bewusstsein
seiner "Andersartigkeit": "Rudi, a so schena
Bua bist. Möcht ma gar nett glaubn, dass d’
a Jud bist", bemerkte sie gelegentlich.
In einem Gespräch mit
Herlinde Koelbl (1989, S. 57) kennzeichnete
Ekstein seine Einstellung zum Judentum
später so: "Mein Vater hatte eine gewisse
Beziehung zum Judentum. Er hat als kleiner
Bub im Tempel im Chor gesungen. Meine eigene
Beziehung zum Judentum war schon recht
abstrakt. (...) In der Schule hatten wir
dann jüdischen Religionsunterricht. Als
Siebzehnjähriger habe ich eine Matura-Arbeit
über "Soziale Probleme bei den Propheten"
geschrieben. Dabei habe ich versucht, eine
marxistische Erklärung des Wirkens der
Propheten zu geben. In Wien waren wir damals
alle Sozialisten und haben uns nicht um die
Religion des einen oder anderen gekümmert."
60 Jahre nach dieser
Abiturarbeit fügte er hinzu: "Ich glaube,
die Sorgen, die wir heute haben, werden auch
die Sorgen der nächsten jüdischen Generation
sein. In dieser Hinsicht sehe ich keine
wirkliche Veränderung. Jeder von uns weiß,
dass wir in einer gefährlichen Welt leben.
Jeder Tag belehrt uns, dass immer noch
Aggression und Gewalt regieren, daran wird
sich noch lange Zeit nichts ändern. (...)
Als ich sechzehn Jahre alt und Sozialist
war, hatte ich einen zionistischen Freund.
Wir beide stritten uns unaufhörlich. In
einem Schulaufsatz schrieb ich, dass sich
weder Zionismus noch Sozialismus in ihrer
reinen Form jemals verwirklichen lassen
werden. Aber ich fügte hinzu, dass etwas
anderes viel wichtiger sei. Wenn man ein
anständiger Mensch ist, müsse man eine
Utopie haben. Man brauche Zielvorstellungen,
auch wenn in der Zeitung nur
Schreckensnachrichten stünden. In diesem
Sinne bin ich Utopist geblieben. Alles, was
Sie in meinem Haus sehen, sind aufgelesene
Bruchstücke von Utopie." (in: Koelbl 1989,
S. 59, Kaufhold 2001, S. 99)
Eksteins Interesse für eine
Verbindung zwischen Pädagogik und
Psychoanalyse wurde durch ein frühes
Erlebnis geprägt: Nach einem mehrmonatigen
Krankenhausaufenthalt musste er als
13-jähriger aufgrund der Vorstellung eines
Lehrers die Schule verlassen. Sein Vater
stand jedoch hinter ihm und ließ ihn weiter
zur Schule gehen. Diese Erfahrung, dass sich
auch schwierige Aufgaben bewältigen lassen,
wenn man Unterstützung erhält, begleitete
ihn nun auf seinem weiteren Lebensweg: Er
hatte sich aufgelehnt, wegen einer
Erkrankung ungerecht behandelt zu werden,
und wurde in kurzer Zeit der beste Schüler
der Klasse. Er gab schwächeren Kindern
Nachhilfe und engagierte sich für
benachteiligte Kinder. Sein Berufswunsch
stand fest: Er wollte Lehrer werden
– ein besserer Lehrer als
derjenige, der ihn die Klasse hatte
wiederholen lassen.
Zeitgleich begeisterte er
sich für den Sozialismus, ein Engagement,
dem er bis ins hohe Alter treu blieb.
Ekstein engagierte sich in der
sozialdemokratischen Falken-, Mittelschüler-
und Studentenbewegung. Er identifizierte
sich mit Max Adler wie mit
Siegfried Bernfeld, der der jungen
psychoanalytisch-pädagogischen
Reformbewegung entscheidende Impulse
geliefert hatte. Bereits als junger
Psychoanalytiker hatte Bernfeld (1892-1953)
in Wien und später auch in Berlin große
Wertschätzung gefunden. Er war im Mai 1918
Assistent von Martin Buber beim
österreichischen Jugendtag und wurde im
gleichen Jahr Präsident der jüdischen Jugend
Österreichs sowie Herausgeber der
Zeitschrift Jerubbaal. 1919 hatte er
gemeinsam mit dem Psychoanalytiker
Wilhelm Hoffer – der ebenfalls in der
zionistischen Bewegung engagiert war – das
Kinderheim Baumgarten gegründet, ein
pädagogisches Modellprojekt, in dem 240
jüdische Kriegswaisen betreut wurden. Für
Bernfeld war dies der Mikrokosmos einer
modernen jüdische Erziehung, ein "erstes
Experiment, psychoanalytische Prinzipien auf
die Erziehung anzuwenden", wie Anna Freud
bemerkte (vgl. Kaufhold 2008a).
Eine der bereits von Bernfeld formulierten
grundlegenden Ideen der durch den Faschismus
ins Exil vertriebenen, somit
historisch-kulturell entwurzelten
Psychoanalytischen Pädagogik formulierte
Ekstein folgendermaßen:
"Bernfeld spricht davon, daß
der Erzieher gegen zwei Grenzen der
Erziehung ankämpfen muß, die kaum zu
meistern sind. Da ist nun die Grenze der
Gesellschaftsordnung, die es dem Erzieher
unmöglich macht, sein Ziel zu erreichen.
Dann spricht Bernfeld über die zweite
Grenze, das Unbewußte des Kindes, ein
Hindernis, das der Erzieher nicht überwinden
kann. Es ist, als ob der Erzieher gegen zwei
Feinde ankämpfen müsse: die ungünstige
Ordnung oder gar Unordnung der Gesellschaft
und die Hindernisse des Unbewußten im
Kinderleben." (Ekstein 1973, in Kaufhold
2001, S. 122)
Oder, mit anderen Worten
formuliert: Nur der Pädagoge, der sowohl die
gesellschaftlich vorgegebenen als auch die
durch seine eigene Biographie, sein eigenes
Unbewusstes gesetzten Grenzen nüchtern
anzuerkennen vermag, der seine eigenen
Ideale immer wieder mit den konkreten
Rahmenbedingungen seines sozialen Feldes zu
verbinden vermag, kann auf Dauer seelisch
gesund und kreativ im pädagogischen Feld
arbeiten.
Wie für viele jüdische
Reformpädagogen, die damals nach Palästina
emigrierten, blieb Bernfeld auch für
Ekstein ein Vorbild, an dem er sich
zeitlebens orientierte und an dessen Wirken
er in zahlreichen englisch- und
deutschsprachigen Publikationen erinnerte
(s. Kaufhold 2001, S. 120-124, S. 295-298,
Kaufhold 2008): "Der Siegfried Bernfeld war,
was soll ich sagen, eine Art frecher
Revolutionär", so Ekstein in einem Interview
im Jahre 1992 (Kaufhold 2001, S. 274). Und:
"Der eindrucksvollste psychoanalytische
Schriftsteller war für mich Siegfried
Bernfeld" (Oberläuter 1985, S. 244).
Ekstein hatte in Wien Psychologie studiert
und begeistert die Schriften von Sigmund
Freud, Siegfried Bernfeld, August Aichhorn,
Wilhelm Hoffer und Anna Freud gelesen. Er
besuchte den neugegründeten Ausbildungskurs
für Psychoanalytische Pädagogik und begann
seine analytische Ausbildung bei Eduard
Kronengold. Zugleich nahm er Kontakt zu
konkreten pädagogisch-psychoanalytischen
Projekten auf.
Politischer Widerstand und Kampf im
Untergrund
Der Jude Rudolf Ekstein war
intensiv im antifaschistischen Widerstand
gegen die Nationalsozialisten engagiert
gewesen, zuerst bei den sozialistischen
Mittelschülern, den "Roten Falken" und den
Kinderfreunden, dann bei der Arbeiterpartei.
Nach den Februarkämpfen 1934 trat der
22-jährige aus Protest gegen die
zögerlich-unentschlossene Haltung der
Mehrheitssozialdemokraten aus der
Arbeiterpartei aus und dem illegal
operierenden Kommunistischen Jugendverband (KJV)
bei: "Man hat mit der Phantasie gelebt, man
müsste siegen und dann die andere Partei
vernichten. (...) Wir glaubten an volle
Macht" (Oberläuter 1985, S. 85, Kaufhold
2001, S. 101) beschrieb Ekstein 50 Jahre
später die damalige Situation. Der
psychoanalytisch geschulte Rudolf Ekstein
war an der Verteilung von Flugblättern und
der theoretischen Schulung der Mitglieder
engagiert, hielt Vorträge über die
"Grundlagen des Marxismus" und nahm an
"illegalen" Wehrübungen im Wienerwald teil.
Einer seiner engen Freunde war damals
Christian Broda, der spätere
österreichische Justizminister. Dieser bat
ihn in den 1960er Jahren vergeblich, er möge
doch nach Wien zurückzukehren. Eksteins
Familie war nicht zu diesem Schritt bereit.
Aus dem Kreis der Wiener Psychoanalytischen
Pädagogik ist später einzig
Ernst Federn nach Wien
remigriert.
1937 veröffentlichte Ekstein in einer
Untergrundzeitung einen von Wilhelm Reichs
Gedankengut beeinflussten Aufsatz zur "Sexualpolitik
des Faschismus", in welchem er sich für
eine sexuelle Aufklärung und Befreiung
einsetzte. Ekstein wurde – vergleichbar dem
tragischen Schicksal Wilhelm Reichs (s.
Fallend/Nitzschke, 1997) – 1937 (!) aus dem
Kommunistischen Jugendverband
ausgeschlossen. Er erlebte diesen Ausschluss
als "ein merkwürdiges Schicksal, daß man
mehr von den eigenen (Leuten)
rausgeschmissen wird, als von den anderen."
(Oberläuter 1985, S. 37) Nach einer
anfänglich optimistischen Phase wurde ihm
die Gefährdung Österreichs zunehmend
bewusster: "Es war Leuten wie mir ziemlich
klar, daß wir gegen eine Verlustsituation
ankämpften. Aber man hat ja nicht aufgeben
können, nicht?" (Oberläuter 1985, S. 33).
Und: "Damals lebten wir schon in einer Zeit,
in der man nicht recht wußte, wie lange man
noch in Österreich leben kann, bis man
flüchten muß. Werde ich mit dem Doktorat
fertig werden?" (Ekstein 1992, S. 127).
Nach mehrmaligen Festnahmen
und einem mehrwöchigen Gefängnisaufenthalt
floh Ekstein im Sommer oder Herbst 1938 über
Belgien und England – wo er am 27.10.1938
noch einmal Anna Freud traf – in die USA. Er
nahm zwei Koffer voller Bücher mit, darunter
elf Bände der "Zeitschrift für
Psychoanalytische Pädagogik", Bernfelds
"Sisyphos" und Thomas Manns "Über den
kommenden Sieg der Demokratie", ein
"kleines, aber unvergeßliches Büchlein" (Ekstein).
Diese Bücher hat Ekstein zeitlebens
aufbewahrt. Er zeigte sie voller Stolz
seinen zahlreichen europäischen Besuchern,
denn sie waren für ihn der geistige Besitz
seiner ersten Heimat, ein Symbol des
Widerstands, der inneren Ungebrochenheit und
der psychischen Kontinuität.
Das Glück seiner Emigration
sollte die Tiefe seines (auch privaten)
Verlustes jedoch nicht verdecken.
Gegenüber Koelbl (1989, S.
57) hob er hervor: "Die einzige Person, die
ich retten konnte, war mein Vater. Mein
Onkel und seine katholische Frau sind in
Wien krank und ohne Verpflegung zugrunde
gegangen. Alle anderen mir bekannten
Verwandten – mit Ausnahme von zwei älteren
Damen, die ich noch getroffen habe – sind
umgekommen. Ich weiß nicht, wo."
New York, Boston und Los Angeles
Eksteins weiterer beruflicher
Weg in den USA sei hier (s. Kaufhold 2001)
nur kurz skizziert: Er ließ sich zunächst in
New York nieder und erlangte, durch
Vermittlung einer
Flüchtlingshilfeorganisation, bei New
Hampshire eine Stelle als Lehrer. In dieser
Flüchtlingsorganisation waren amerikanische
Kollegen tätig, die einige Jahre zuvor nach
Wien gekommen waren, um die junge
psychoanalytisch-pädagogische
Aufbruchbewegung vor Ort kennen zu lernen
(vgl. Kaufhold 2003). Zwei Jahre lang
arbeitete er dort, weitgehend unentgeltlich,
und vermochte in der Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen seine Englischkenntnisse zu
verbessern. Schrittweise vermochte er sich
so in seine ihm noch sehr fremde, neue
Heimat einzuleben, sich seelisch neu zu
orientieren. In dieser Anfangszeit wurde der
jüdische Flüchtling und Widerständler, der
selbst nur mit großem Glück der Schoah
entronnen war, von starken Schuldgefühlen
gepeinigt: "Man lebte in den ersten Monaten
immer mit dem entsetzlichen Schuldgefühl,
dass man selbst gerettet ist und andere
Leute umkommen lässt", erinnerte er sich
Jahrzehnte später in einem Interview mit dem
Wiener Dokumentationsarchiv für Widerstand
DÖW.
Wenige Wochen nach seiner
Ankunft veröffentlichte Rudolf Ekstein in
einer amerikanischen Fachzeitschrift seinen
ersten englischsprachigen Aufsatz, in
welchem sich sein ungebrochenes
pädagogisch-politisches Engagement sowie
seine Hoffnung auf das demokratische Amerika
widerspiegelte: "A refugee Teacher Looks
on Democratic and Fascist Education".
Der Emigrant Ekstein bemerkt:
"So sehr wir uns auch
bemühten, in meinem kleinen Land in
Mitteleuropa den Faschismus zu verhindern
und die Demokratie wiederherzustellen – wir
hatten keinen Erfolg. Es mag daher abwegig
erscheinen, wenn ein Flüchtling nach dem
Untergang der Freiheit in Österreich über
demokratische und faschistische Erziehung in
Amerika schreibt, dieser Hochburg der
persönlichen Freiheit und der Hoffnung der
gesamten fortschrittlichen Welt. Wir wenigen
Glücklichen aus einer unüberschaubaren
Anzahl von Flüchtlingen und Gefangenen
müssen unser Versagen eingestehen. Es ist
uns nicht gelungen, in unserer Heimat die
Kultur, die Glaubensfreiheit, die Freiheit
der politischen Meinung (...) zu
verteidigen." (Ekstein 1994, S. 138) Und er
endet mit den Worten: "Ich bin sehr
glücklich darüber, an einer amerikanischen
Schule zu arbeiten, und ich bin besonders
froh darüber, dass diese Schule ein
Interesse an fortschrittlicher Erziehung
hat. (...) Ich werde mein Bestes geben, um
den Weg der Demokratie zu gehen. (...) Meine
Hoffnung ist Amerika!" (in: Kaufhold 2001,
S. 107f.)
Ekstein absolvierte dann in
Boston eine Ausbildung als social worker
und beendete bei dem Wiener Emigranten
Eduard Hitschmann seine Lehranalyse. Von
1947 bis 1957 leitete er an der legendären
psychoanalytischen Menninger Foundation
ein Forschungsprojekt für psychotische
und sogenannte Grenzfallkinder. Durch diese
wissenschaftliche und
pädagogisch-therapeutische Tätigkeit
erlangte er in der internationalen
Fachöffentlichkeit hohes Ansehen. Seine
Forschungsergebnisse fasste Ekstein
(gemeinsam mit R. Wallerstein) in dem Buch "The
teaching and learning of Psychotherapy"
(1958) zusammen. Als seine zehnjährige
Tätigkeit bei der Menninger Foundation
beendet war, berichtete sogar die lokale
Tageszeitung darüber: "Ekstein to Leave
Menningers Soon". Von 1958-1978 setzte
Ekstein dann an der Reiss-Davis Klinik
in Los Angeles seine
psychoanalytisch-pädagogische Tätigkeit
sowie die Zusammenarbeit mit Lehrern und
Sozialarbeitern fort. Ekstein wurde von
einer Vielzahl amerikanischer
psychoanalytischer Institute ausgezeichnet.
Seine aus der klinischen
Praxis erwachsene Produktivität war enorm.
Sie umfasst ca. 500 Studien und Rezensionen.
1963 erschien der Beitrag "Psychoanalyse und
Erziehung - Vergangenheit und Zukunft", die
Publikation, in welcher erstmals nach dem
Krieg in deutscher Sprache an die
Vernichtung der Psychoanalytischen Pädagogik
durch den Nationalsozialismus erinnert
wurde; 1966 publizierte Ekstein in den USA
seine Forschungen zur kindlichen Psychose in
dem Buch "Children of Time and Space, of
Action and Impulse: Clinical Studies on the
Psychoanalytic Treatment of Severely
Disturbed Children"; 1969 erschien der
psychoanalytisch-pädagogische Sammelband "From
Learning for Love to Love of Learning";
1973 kam auf deutsch endlich das Buch "Grenzfallkinder"
heraus, eine Sammlung von Arbeiten zur
Milieutherapie mit psychisch schwerkranken
Kindern. 1976 folgte auf englisch "In
Search of Love and Competence"; 1994 in
deutscher Sprache eine Auswahl der
klinischen und pädagogischen Studien
Eksteins (Wiesse 1994). 1985 (Oberläuter)
und 2001 (Kaufhold) wurden umfangreiche
biografisch-werktheoretische Studien über
sein Wirken publiziert.
Freundschaft mit Bruno
Bettelheim
In jenen Jahren wurde
Bruno Bettelheim der engste Freund und
Kollege Eksteins, mit dem er nach einem
Forschungsaufenthalt in Israel Mitte der
1960er Jahre dessen legendäre Kibbuzstudie
"Die Kinder der Zukunft" (Bettelheim 1969)
liebevoll-kritisch diskutierte. Ihre enge
Freundschaft und Zusammenarbeit ist in ihrem
Briefwechsel dokumentiert (in: Kaufhold
1994; s. Kaufhold 2001, 2003a).

Rudi Ekstein (li), seine
Frau Ruth, Bruno Bettelheim
@
Roland Kaufhold, Psychosozial-Verlag
Dem alten und kranken
Bettelheim bot er 1989 an, in seinem Haus zu
wohnen.
Bettelheim, dem posthum in vielfacher
Hinsicht sehr viel Unrecht angetan worden
ist (s. Ekstein 1994, Kaufhold 1993, 2001,
2003a, Fisher 2003), zog dieses Angebot
nicht ernsthaft in Erwägung. Er nahm sich im
Januar 1990 das Leben, eine Tat, die auch
als späte Reaktion auf seine elfmonatige
Gefangenschaft in Dachau und Buchenwald
verstanden werden kann.
Kurz zuvor hatten Ekstein und Bettelheim
noch ein letztes dokumentiertes Gespräch
über ihr Leben sowie die Geschichte der
Psychoanalyse geführt (Bettelheim/Ekstein
1994). Eksteins Erinnerungsbeitrag "Mein
Freund Bruno (1903-1990).
Wie ich
mich an ihn erinnere" an
Bettelheim (Ekstein 1994),
sein gemeinsames Interview mit Ernst Federn
über Bettelheim (Kaufhold 1993a) wie auch
der publizierte Briefwechsel zwischen beiden
(in Kaufhold, 1994) gehören für mich zu
Eksteins anrührendsten Beiträgen.
Ein Besuch in seinem Haus in
Los Angeles hinterlässt tiefe Erinnerungen,
die auch 13 Jahre später in mir nicht
verblassen: Es war ein beeindruckendes
österreichisch-amerikanisches Museum zur
Geschichte der Psychoanalyse, ein Zeugnis
der vertriebenen europäischen Kultur. Eine
Begegnung mit Rudi Ekstein bildete immer
einen Anlass für köstliche, anrührende
Anekdoten. Daniel Benveniste, ein
früher in San Francisco und heute in
Caracas, Venezuela tätiger Psychoanalytiker,
hat mir nach Rudi Eksteins Tod eine für
Eksteins Persönlichkeit kennzeichnende
Episode erzählt:
"In 1995 I brought Rudi and
his wife to San Francisco where he delivered
a public lecture on his reminiscences of
psychoanalysis in Vienna. There were three
other speakers in the symposium, which I had
organized, and I prepared signs in the
parking lot to reserve spaces for their
cars. At the end of the event I asked my
friend and colleague, Dr. Jeff Sandler, if
he could give the Ekstein’s a ride to their
hotel. He readily agreed and afterward told
me that on their way out of the parking lot
Rudi saw the sign again that read 'This
Space Reserved for Rudolf Ekstein' and he
asked Jeff to stop and take the sign for
him. Rudi’s wife, exasperated with him,
cried out, 'Rudi! Where are you going to put
a thing like that?' (Remember his house is
full of diplomas and honorary degrees.) Rudi
paused a moment and said, 'Over my bed!'"
Am 18.
März 2005 ist Rudi Ekstein von uns gegangen.
Zehn Tage später, am 1.4.2005, verstarb
seine Ehefrau Ruth, mit der er seit 1942
verheiratet war. Sie hinterlassen zwei
Kinder, Jean und Rudolf, die beide in den
USA als Lehrer arbeiten, sowie ein
Enkelkind. In der Los Angeles Times erschien
am 23. März ein Nachruf, in welchem unter
anderem eine Aussage Eksteins über die enge
Freundschaft mit Bettelheim zitiert wird: "We
always had a wonderful time together.
I treasure every hour. (...)
Neither of us was a ‘yes’ man. If you have a
friend who always agrees, for what do you
have the friendship?"
Wir haben Rudi Ekstein, der
aus einer untergegangenen,
märchenhaft-nostalgisch verklärten Ära
stammte, sehr viel zu verdanken. Unsere
Erinnerung an diesen lieben, charmanten,
kreativen, wienerisch-nostalgischen,
unverbesserlich optimistischen Mann wird in
uns lebendig bleiben.
In Wien, dies bleibt noch
nachzutragen, erinnert heute das
psychoanalytisch-pädagogische
Rudolf Ekstein
Zentrum an sein
jahrzehntelanges unermüdliches Wirken. Sein
umfangreicher Nachlass wird in einer am
Institut für Bildungswissenschaft, NIG
(Universitätsstraße 7, 1010 Wien)
angeschlossenen Bibliothek aufbewahrt und –
hoffentlich - auch aufgearbeitet.
Dieser Nachruf wurde der
TRIBÜNE. Zeitschrift zum Verständnis des
Judentums, 44. Jahrgang, Heft 174, Nr.
2/2005, S. 92-96 entnommen und für diese
Publikation überarbeitet und erweitert. Wir
danken dem
Tribüne-Verlag herzlich für die
Nachdruckrechte.
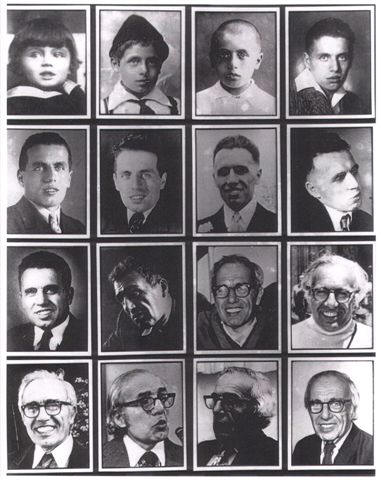
©
Daniel Benveniste
Literatur
Benveniste, D. (1992):
Siegfried Bernfeld in San Francisco. Ein
Gespräch mit Nathan Adler. In: Fallend/
Reichmayr (Hg.) (1992), a.a.O., S. 300-315.
Benveniste, D. (1998): A
bridge between psychoanalytic worlds: a
dialog with Rudolf Ekstein, Psychoanalytic
Review, 85 (5), October 1998, S. 675–96.
Bettelheim, B. & Ekstein, R.
(1994):
Grenzgänge zwischen den Kulturen.
Das letzte Gespräch zwischen Bruno
Bettelheim und Rudolf Ekstein. In: Kaufhold,
R. (Hg.)
(1994), S. 49-60.
Ekstein, R. (1936): Zur
Philosophie der Psychologie. Eine
philosophische Untersuchung in Anschluß an
Th. Ziehens "Die Grundlagen der
Psychologie". Dissertation, Wien.
Ekstein, R. (1939/1994):
Demokratische und faschistische Erziehung
aus der Sicht eines Lehrers und Flüchtlings
– Oktober 1939. In: Wiesse, J. (Hg.) (1994):
S. 138–151.
Ekstein, R., & Motto, E. L.
(1963): Psychoanalyse und Erziehung –
Vergangenheit und Zukunft. Praxis der
Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie, 12
(6), S. 213–233.
Ekstein, R. (1966): Children
of Time and Space, of Action and Impulse:
Clinical Studies on the Psychoanalytic
Treatment of Severely Disturbed Children.
New York.
Ekstein, R., & Motto, R. L.
(1969): From learning of love to love of
learning.
New York.
Ekstein, R. (1973):
Grenzfallkinder.
München.
Ekstein, R., & Cooper, B.
(1973a): Der Einfluß der Psychoanalyse auf
Erziehung und Unterricht. In: Ammon, G.
(Hg.) (1973): Psychoanalytische Pädagogik.
Hamburg, S. 35–55.
Ekstein, R. (1973b): Dialog
über Sexualität: Distanz gegen Intimität.
In: Ammon, G.
(Hg.) (1973):
Psychoanalytische Pädagogik.
Hamburg, S. 124–137.
Ekstein, R. (1976): In Search
of Love and Competence.
New York.
Ekstein, R. (1987): Die
Vertreibung der Vernunft und ihre Rückkehr.
In: Stadler, F. (Hg.) (1987): Vertriebene
Vernunft I. Emigration und Exil
österreichischer Wissenschaft 1930–40.
München-Wien, S. 472–477.
Ekstein, R., Fallend, K., &
Reichmayr, J. (1988): "Too late to start
life afresh".
Siegfried Bernfeld auf dem
Weg ins Exil. In: Stadler, F. (Hg.) (1988):
Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil
österreichischer Wissenschaft 1930–40.
Wien-München, S. 230-241.
Ekstein, R. (1989): Grußwort
anläßlich des 10jährigen Bestehens des
Vereins für psychoanalytische Sozialarbeit
e.V., psychosozial 12, Heft 37, S.
13–17.
Ekstein, R. (1992):
Philosophiestudieren in den dreißiger
Jahren. In: Fischer, K. R., & Wimmer , F. M.
(Hg.) (1992): Der geistige Anschluß.
Philosophie und Politik an der Universität
Wien 1930–1950, Wien.
Ekstein, R. (1994):
Mein
Freund Bruno (1903-1990). Wie ich mich an
ihn erinnere. In: Kaufhold, R. (Hg.) (1994):
Annäherung an Bruno Bettelheim, S. 87-94
(Beim Autor für 12 € erhältlich).
Ekstein, R., & Fisher, D. J.
(1994a): Offener Brief an »Newsweek«. In:
Kaufhold (Hg.) (1994): S. 300–302.
Fallend, K./Nitzschke, B.
(Hg.) (2002):
Der 'Fall' Wilhelm Reich. Beiträge zum
Verhältnis von Psychoanalyse und Politik.
Giessen.
Fisher, D. J. (2003):
Psychoanalytische Kulturkritik und die Seele
des Menschen. Essays über Bruno
Bettelheim unter Mitarbeit von Roland
Kaufhold et. al. Gießen
(Psychosozial-Verlag).
Kaufhold, R. (Hg.)
(1993):
Pioniere der Psychoanalytischen Pädagogik:
Bruno Bettelheim, Rudolf Ekstein, Ernst
Federn und Siegfried Bernfeld.
psychosozial Heft 53 (I/1993), 16.
Jg.
Kaufhold, R. (1993a): Zur
Geschichte und Aktualität der
Psychoanalytischen Pädagogik: Fragen an
Rudolf Ekstein und Ernst Federn. In:
Kaufhold (Hg) (1993), S. 9–19.
Kaufhold, R. (1994): Material
zur Geschichte der Psychoanalytischen
Pädagogik: Zum Briefwechsel zwischen Bruno
Bettelheim und Rudolf Ekstein. In: Kaufhold
(Hg.) (1994):
Annäherung an Bruno
Bettelheim. Mainz (Beim Autor für 12 €
erhältlich).
Kaufhold, R. (Hg.)
(1999):
Ernst Federn: Versuche zur Psychologie des
Terrors. Material zum Leben und Werk von
Ernst Federn. Gießen
(Psychosozial-Verlag).
Kaufhold, R. (2001):
Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für die
psychoanalytisch-pädagogische Bewegung,
Gießen (Psychosozial-Verlag).
Kaufhold, R. /Lieberz-Groß,
T. (Hg. 2001a): Deutsch-israelische
Begegnungen, psychosozial Nr. 83,
Heft 1/2001.
Kaufhold, R. (2003):
Spurensuche zur Geschichte der die USA
emigrierten Wiener Psychoanalytischen
Pädagogen, in: Aichhorn, T. (Hg.) (2003):
Geschichte der Wiener Psychoanalytischen
Vereinigung I. 1938 - 1949, Luzifer-Amor,
16.
Jg., Heft 31, 2003, S. 37-69.
Kaufhold, R. (Mthg.) (2003a):
"So können sie nicht leben" - Bruno
Bettelheim (1903 – 1990). Zeitschrift für
Politische Psychologie 1-3/2003.
Koelbl, H. (1989): Rudolf
Ekstein. In: Koelbl, H. (1989): Jüdische
Porträts. Frankfurt/M., S. 57-60.
Oberläuter, D. (1985): Rudolf
Ekstein - Leben und Werk. Kontinuität und
Wandel in der Lebensgeschichte eines
Psychoanalytikers. Wien-Salzburg.
Pelinka, P. (1992): Der rote
Rudi. In: Falter, 27/1992, S. 10f.
Wagner, R. (2002):
Psychoanalytische Pädagogik – ein Gespräch
zwischen Roland Kaufhold und Rolf Wagner. In:
"Fragen und Versuche" Nr. 100, Juli
2002 (Zeitschrift der Freinet-Pädagogen).
Wiesse, J. (Hg.)
(1994): Rudolf Ekstein und
die Psychoanalyse. Göttingen.
--> haGalil-Themenschwerpunkt Bruno
Bettelheim
Anmerkungen:
Privatarchiv von Roland Kaufhold, s.
Kaufhold 2001, S. 274.
Persönliche Mitteilung von Daniel Benveniste
per e-mail, 31.3.2005. |