|
Randständiger Antiheld:
Daniel Haws jüdische Comicfigur "Moishe Hundesohn"
Von Andreas Disselnkötter
Aus:
TRIBÜNE, Zeitschrift
zum Verständnis des Judentums, Heft 183, September 2007
Comicfiguren erfreuen sich in Deutschland zunehmender
Beliebtheit. Wurden hierzulande bislang vor allem ausländische Autoren
gelesen, so beginnt sich seit einigen Jahren eine deutschsprachige
Comic-Szene zu etablieren, die in allen Medien präsent ist. Dazu gesellt
sich seit über einem Jahr ein kleiner Hund mit Hut und Schlips, der eine
Ente namens Ruth mit sich führt und Moishe Hundesohn heißt.
Erfunden hat ihn der Hamburger Allroundkünstler und
Theatermacher Daniel Haw. Seiner Figur wird nachgesagt, Deutschlands erste
jüdische Comicfigur zu sein. Ob dies zutrifft, ist nicht leicht zu klären,
denn wer vermag die Produktion von mehrteiligen Bild-Folgen bis in die
letzten Winkel jüdischen Lebens zu überblicken. Bei einer ersten
internationalen Bilanz jüdischer Comicwelten mit dem Titel "Mit
Superman fing alles an" (1) war keine zweite Figur zu sichten. Ein
Comic mit jüdischen Themen aus Deutschland war allenfalls durch die
Zeichnerin
Elke Steiner
vertreten. Seit 2001 hat sie, auch gemeinsam mit dem populären israelischen
Schriftsteller Edgar Keret, mehrere Comics zur deutsch-jüdischen Geschichte
veröffentlicht.
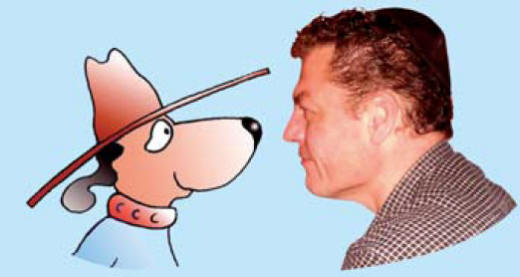
Lange sind die Zeiten vorbei, in denen Comics als
"abstumpfend, verrohend und das geistige Leistungsvermögen zersetzend"
betrachtet wurden, so noch 1979 das verbreitete "Sachwörterbuch der
Literatur" von Gero von Wilpert. Inzwischen situiert man den Vorläufer der
Comics bei Wilhelm Busch oder gar bei mittelalterlichen Bilderbogen.
Spätestens nach 1945 waren Comics auch in Deutschland nicht nur
Kinderlektüre, sondern ein eigenständiges Medium, das sich auch politischer
Themen wie Marx und Mao annehmen kann. Zusammen mit dem vor kurzem
entdeckten ersten deutschen Sprechblasencomic "Ein Bubenstreich" (1894 in
den "Nürnberger Lustigen Blättern") verzeichnen die einschlägigen
Datenbanken über 88.000 Einzeltitel, die bis auf wenige Ausnahmen nach 1945
erschienen sind. Auch gesellschaftliche "Tabuthemen" wie die Shoah werden in
gezeichneter Form behandelt, insbesondere Art Spiegelmanns "Maus", der den
Comic als seriöses Medium der Auseinandersetzung mit der Shoah etabliert
hat.
Inzwischen erschienen auch hierzulande einige Nachfolger wie
Joe Kubert, Will Eisner, Pascal Croci und Osamu Tezuka,(2) deren ästhetische
Ausformung der Thematik sehr heterogen ist. Will Eisner, Sohn jüdischer
Emigranten in New York, schuf langjährige Serien wie "Spirit", der 1940
begann und erst 1952 endete. Hier entstand der erste Superheld ohne
Superkräfte, der jeden Verbrecher zur Strecke brachte und den Frauen (fast)
immer widerstand. Der 2005 87-jährig verstorbene Eisner bereitete mit
waghalsigen Perspektivenwechseln auch die Underground-Comics von Robert
Crumb vor.
Es besteht also kein Grund, sich immer wieder für die
Beschäftigung mit Comics zu entschuldigen. Eckart Sackmann gibt daher seit
2005 das Jahrbuch für deutsche Comicforschung heraus, in dem Übergänge zu
Pop-Art und modernen Formen der Medialisierung besondere Beachtung finden.
Selbst in den USA waren noch bis vor kurzem jüdische Zeichner, die sich der
Bandbreite jüdischer Themen angenommen haben, kaum bekannt. Wer weiß schon,
dass die Comicfigur "Batman" von dem Juden Bob Kane erschaffen wurde, wer
kennt den Autor und die Hintergründe der "Superman"-Geschichte (1938) von
Jerry Siegel und Joe Schuster, die auch als Antwort auf den
Nationalsozialismus im Medium des Comic-Heftes gelesen werden kann. Darauf
hat der US-amerikanische Schriftsteller Michael Chabon aufmerksam gemacht.
In seinem Roman "Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier &
Clay" (3) werden die Bedeutung und Funktion von Comics thematisiert. Es
beginnt mit der Flucht des neunzehnjährigen Juden Josef Kavalier in einem
Sarg aus dem besetzten Prag nach Brooklyn. Dort wird er von einer Tante
aufgenommen, deren Sohn Samuel Klayman – ein Comicfan – ihn für die neuen
Superheldencomics begeistert. Zusammen erfinden sie die Comicfigur
"Eskapist", einen König der Ausbrecher. Sie finden auch einen Verleger und
das Comic-Heft wird zu einem großen Erfolg. Monat für Monat kämpft der
Eskapist in Übersee gegen die Nazis.
Die Erfinder von "Superman" haben es ebenso wie andere
jüdische Zeichner außerhalb Deutschlands bis in die 1970-er Jahre vermieden,
jüdische Themen und Figuren zu gestalten. Es ist leicht einsehbar, dass dies
vor allem wirtschaftliche Gründe hatte: Die Gojim in Gestalt weißer und
heterosexueller Männer ließ sich einfach besser verkaufen.
Nach ersten Erfolgen von Zeichnern, die sich randständiger
jüdischer Themen annahmen, begannen große Verleger Golem-Figuren,
verschiedenste Typen von Rabbinern und Israelis in ihr Programm aufzunehmen.
In den Serien tauchten zunehmend auch Frauen auf, zu denen etwa die
Mossad-Agentin "Rose" gehört. Bislang scheint es so, als bliebe es bei
diesen insgesamt sehr stereotypen Figuren und Darstellungsweisen. Zu groß
sind vermutlich die Hemmungen bei Verlegern, die ganze Bandbreite von Themen
einer Minderheit aufzunehmen. Dazu würde dann auch ein neuer "Superman"
gehören, der eben Jude ist und sein Judentum lebt. Woche für Woche
präsentiert sein Erfinder Daniel Haw zum Schabbat eine neue Geschichte. Sie
kann über das Internet-Portal "haGalil" eingesehen werden und umfasst eine
zumeist zwei- bis vierteilige Abfolge von Bildern, also eine Art Kurz-Strip.
Die Teilbilder sind vertikal angeordnet, so dass die Betrachter – je nach
Bildschirmgröße – von oben nach unten scrollen kann, um alle Zeichnungen zu
sehen.
Daniel Haw entwickelt mit seinen Figuren Moishe Hundesohn und
der Ente Ruth dialogisch einen teils witzigen, teils ironischen Kommentar zu
politisch-kulturellen Ereignissen. Dass dahinter aber einer steckt, der ein
genauer Beobachter der deutschen Gesellschaft ist, zeigen solche Strips wie
"Moishe
Hundesohn und die deutsche Koalitionsfähigkeit". Nicht die Probleme
der Berliner Politik stehen hier im Blickpunkt, sondern die seltsamen
Allianzen zwischen den Neonazis und antizionistischen bzw. antisemitischen
Teilen der deutschen Linken. Die Beziehungen zwischen Juden und Nicht-Juden
stehen ebenso auf dem Prüfstand wie die
Wirkungslosigkeit der UNO-Truppen im Nahost-Konflikt. Da beugt sich
ein übergroßer Blauhelm-Soldat zu den ebenfalls kriegstauglich
eingekleideten Moishe Hundesohn und Ruth herab. Milde lächelnd konstatiert
er: "So, mein Kleiner, nimm mal Dein Quietscheentchen und lauf zu Mama!
Jetzt sind die Profis dran! Wir haben ja alles im Griff! Die Hisbollah hat
versprochen, mit dem Raketenquatsch aufzuhören – Ehrenwort unter Militärs!
Alles Paletti! – Also hübsch die Pfoten stillhalten, klaro?!" Im zweiten
Bild wendet sich Moishe zu Ruth und sagt: "Na, Quietscheentchen, dann ist ja
alles glatt koscher! Und ich Schmock dachte schon, die Hisbollah will Israel
vernichten und das jüdische Unkraut ausrotten! Aber wenn die ganze
Terrorbande versprochen hat, friedlich zu sein, dann lass uns nach Hause
gehen und lecker Bagel knabbern!" Die Banalisierung und Generalisierung
einstmals nur antisemitisch codierter Schimpfwörter zeigt Haw in der
Schulhofszene.
Kanaksprak – die Mischsprache deutsch-türkischer und deutsch-arabischer
Jugendlicher – und Jiddisch verbinden sich vor dem Hintergrund der
Hindenburgschule zu einem Gestus universaler Beschimpfung. Den Ausweg bietet
nur noch New York.

Besondere Abneigung haben die Figur – und ihr Schöpfer – für
die Aktivitäten christlicher Würdenträger, doch da versagt das Medium des
Comic. Hier muss Tacheles geredet werden: Als evangelische und katholische
Geistliche im Frühjahr 2006 nach Israel reisten, provozierten sie die
israelische Öffentlichkeit und auch die jüdische Gemeinschaft in Deutschland
mit teilweise abstrusen Bemerkungen. Daniel Haw lässt seine Figur ein
Briefgedicht "In
geistlicher Friedensmission" schreiben, das die Kehrseiten und die
Grenzen des von christlicher Seite so gern gelobten christlich-jüdischen
Dialogs aufzeigt:
"Es zogen in geistlicher Friedensmission / aus Teutschland
der Bischöfe Delegation / ins Heilige Land. Dort beteten sie / und beugten
in Yad Vashem das Knie. / Die Frage nach kollektiver Schuld / ertränkten sie
in kirchlicher Huld. / [. . .] Sie hörten das neue "Juda verrecke!", /
gezischelt aus sicherem Verstecke. / [. . .] Und huldvoll lächelnd in rotem
Talar / durchschritten sie weihevoll Ramallah. / Da stößt es aus christlich
empörter Brust / bischöflich, zu aller Muslime Lust: / Dies ist die jüdische
Tyrannei! / (ein Bischof weinte sogar dabei) / [. . .] Das Ghetto sind wir!
/ Wir werden bedroht von islamischer Wut, / in winzigem Land mit großem Mut.
/ Uns mordet man meuchlings an jeglichem Tag, / auch wenn das ein Bischof
nicht hören mag! / [. . .] Was wisst denn ihr von Ghetto und Not? / Wo
fanden eure Familien den Tod? / Oh, ihr würdigen Herren, hier hört ihr mich
flehen: / Wer Augen im Kopf hat, der sollte auch sehen! / Oh, ihr Bischöfe
Teutschlands, ich flehe euch an, / lest einmal die Zeitung so dann und
wann!".
Es ist die erkennbare Absicht Daniel Haws, über das Medium
des Comics zu irritieren, gewohnte Sichtweisen infrage zu stellen, den
Finger in Wunden zu legen oder einfach nur komisch zu sein. So etwa, wenn
"Schweinefleisch" als beliebtes Dauerthema jüdischer Witze in den
Vordergrund rückt. Für Nicht-Juden – auch solche, die nicht christlich sind
– hält Daniel Haw viele Unannehmlichkeiten bereit. In "Der
Undankbare" bricht eine ausgemachte Philosemitin in Gestalt einer
übergroßen Blondine zuletzt in Tränen aus, als sie sich vor Augen führt,
dass die Juden "ein Volk des Leidens" seien. Moishe Hundesohn versucht, sie
mit einem Witz wieder aufzubauen: Er handelt von einem Rabbi, dessen Frau
ein Verhältnis mit einem Ministranten hatte. Dazu quakt und lacht die Ente
fast schadenfroh, doch die Blondine wirkt eher befremdet und leicht erbost
über so viel Unvermögen, ihren doch emphatisch gemeinten Gefühlsausbruch zu
berücksichtigen. Es wird deutlich, dass es vor allem die nicht-jüdischen
Deutschen sind, die leiden. Durch die bloße Präsenz von Juden versinken sie
in einem abstrusen Gemisch von Schuldgefühl, Selbstanklage und Mitleid für
die Juden als ewige Opfer.
Der "Vater" von Moishe Hundesohn hat die Beobachtung gemacht,
dass manche jüdischen Themen für Nicht-Juden oft interessanter sind als für
Juden. Dieser Befund bezieht sich auf seine Arbeit am eigenen Theater in
Hamburg, dem "Schachar" ("Morgenröte", gegründet 1998). Das Publikum weiß
neben der allerorten praktizierten Folklore in Form vom Klezmer auch witzige
und ironische Beiträge zu schätzen, wenn sie sich mit dem unbedingten
Versöhnungswillen der nicht-jüdischen Deutschen vereinbaren lassen. In "Shylock
– verschenkt: Über das jüdische Element in der deutschen Kultur" (5)
bilanziert Haw seine Erfahrungen am Theater. "Sobald ich Komödien aus
eigener Feder aufführe, die mit Selbstironie – Strenge, groteske
Gefühlsbetontheit und Familiengläubigkeit des Judentums persifliere – ernte
ich stets großen Beifall und Anerkennung. Erzähle ich die Geschichte eines
"arischen" Mädchens, das in einem Jugend-KZ ihr Heimatland zu hassen lernt,
fragen mich besorgte oder zornige Lehrer, wo denn das ›versöhnende Element‹
bliebe".
Die Erneuerung jüdischer Kultur in Deutschland erweist sich
für ihn als "romantische Illusion". Auch deshalb, weil sich nach
erfolgreichen Jahren der Theaterarbeit bis in die Behörden hinein eine
zunehmende Ablehnung der jüdischen Theaterkultur verfestigte. Es folgten
Drohungen, er möge doch das Hamburger Publikum mit seinem Jugend-KZ-Drama
"Die Hölle der Mädchen " verschonen und die mit dem Drohbrief geschickten
Präservative zur endgültigen Beendigung seiner "Fortpflanzungslinie"
verwenden. "Da allerdings verließ mich auch mein jüdischer Humor und ich
verschloss der Stadt Hamburg unser Theaterportal".(6)

Begonnen hatte Haw Ende der 1990er Jahre. Er wollte einen
unabhängigen und in jeder Hinsicht "neutralen Raum" jüdischer Theaterkultur
etablieren, der für Juden und Nicht-Juden offen sein sollte. Auf der Suche
nach seinem Ensemble an der Hamburger Universität hatte er mit einem Plakat
jüdische Kolleginnen und Kollegen sowie "alle Bastarde" gesucht, die mit ihm
Pioniere sein wollten. Bei aller Verbitterung und dem Gefühl, dass
"gemeinsame emotionale Kulturerlebnisse" von der deutschen Politik und
Wirtschaft nicht erwünscht sind, blieb für Daniel Haw doch eines erhalten:
"Um nicht die Nerven und meinen Optimismus zu verlieren, tat ich, was
unserer jüdischen Seele eigen ist: ich suchte verzweifelt nach dem Humor in
der ganzen Katastrophe. Und tatsächlich wollte es mir temporär gelingen, dem
[…] Zustand eine gewisse Tragikomik abzugewinnen".
Auf der
Homepage des
Malers, Autors, Regisseurs, Schauspielers und Komponisten Haw ist
die Comicfigur Moishe Hundesohn von zentraler Bedeutung. Sie prangt auch auf
T-Shirts und Tassen. Ihr selbst so benannter "Papa" versichert der TRIBÜNE,
dass es weitere Geschichten geben wird, jeden Freitag. Die frühere Homepage
des Theaters "Schachar" steht weiterhin, aber stumm, im Internet. Sie
signalisiert der Stadt Hamburg ihr Versäumnis, aber auch ihre Chance, das
erste jüdische Theater Hamburgs wiederzubeleben. Inzwischen deutet das
liebevolle und bisweilen auch zärtliche Verhältnis zwischen Moishe Hundesohn
und der Ente Ruth an, dass es auch in schlechten Zeiten eine Perspektive
gibt.
Mehr von Moishe
Hundesohn
Anmerkungen:
(1) Im Jahr 2005 in der Berliner Galerie Neurotitan im Haus Schwarzenberg,
Kuratorin der Ausstellung war die Kulturhistorikerin Katja Lüthge, siehe:
http://www.hagalil.com/archiv/2005/06/comic.htm
(2) Joe Kubert: Yossel, 19. April 1943. Eine Geschichte des Aufstands im
Warschauer Getto. Ehapa-Verlag, Stuttgart 2005;
Will Eisner: Das
Komplott. Die wahre Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion,
mit einer Einführung von Umberto Eco. Deutsche Verlagsanstalt, München 2005.
Pascal Croci: "Auschwitz". Ehapa-Verlag, Stuttgart 2005; Osamu Tezuka:
"Adolf. Mord in Berlin". Carlsen Verlag, Hamburg 2005.
(3) Michael Chabon: Die unglaublichen Abenteuer von Kavalier & Clay. Roman.
Aus dem Amerikanischen übersetzt von Andrea Fischer. Kiepenheuer & Witsch,
Köln 2002.
(4)
http://www.israeli-art.com/satire/moishe.htm
(5) In:
http://www.hagalil.com/archiv/2007/06/kultur.htm vom 13.6.2007.
(6) Seither gastiert das "Studio Schachar" an vielen Bühnen Deutschlands. |