|
 |

Avi Primor
»...mit
Ausnahme Deutschlands«
Als Botschafter Israels in Bonn
[Bestellen]
|
VI.Teil
Bonner Begegnungen
Die ersten Bonner Beamten, denen ich begegnete, waren nicht etwa solche aus
dem Auswärtigen Amt. Sie waren überhaupt keine Bundesbeamten, unterstanden
vielmehr der Regierung von Nordrhein-Westfalen, dem Bundesland, in dem Bonn
liegt. Es handelte sich um meine künftigen Leibwächter sowie den Polizeichef
und einige seiner Mitarbeiter. Letztere nahmen mir Fingerabdrücke ab und
machten Lichtbilder – vorsorglich, wie sie erklärten, für den Fall einer
Entführung. »Sie kriegen alles als Souvenir zurück«, sagten sie, »wenn Sie
Deutschland wieder verlassen. Hoffentlich benötigen wir’s nicht.«
Die mir als »Israel-Kommando« vorgestellte
Leibwache sollte fortan ständig um mich sein. Für mich war das nichts
Ungewohntes, schon früher war ich von Sicherheitsbeamten umgeben und hatte
jahrelang mit den Einschränkungen gelebt, die ein solcher Schutz mit sich
bringt. Über mögliche emotionale Reaktionen darauf, daß es deutsche
Polizisten waren, die von nun an für meine Sicherheit sorgen sollten, konnte
ich gar nicht erst lange nachdenken. Ich lernte sie einfach als ungemein
sympathische, liebenswürdige und auch gebildete junge Männer kennen, zu
denen man Vertrauen, womöglich sogar ein freundschaftliches Verhältnis
entwickeln konnte.
Tatsache ist, daß sie sich als meine
treuesten Deutschlehrer erwiesen. Denn mein Ehrgeiz, die bisher erworbenen
Sprachkenntnisse zu vervollkommnen, möglichst unter erfahrener Anleitung,
stieß bald auf zeitliche Schwierigkeiten. Gerade in Bonn etabliert, hatte
ich zwar Verbindungen zu einer bekannten, hervorragenden Lehrerin
aufgenommen, Rosemarie Toscha, die seit Jahrzehnten Deutschunterricht an der
amerikanischen Botschaft gibt. Doch da stellte sich auch schon die
Zeitfrage: Wie oft konnte ich, neben allen dienstlichen Verpflichtungen,
Unterricht nehmen? Zweimal pro Woche? Nur selten. Einmal? Auch das nicht
immer und regelmäßig.
Die Unmöglichkeit, einen verbindlichen
Zeitplan aufzustellen, hat mit meiner häufigen Abwesenheit von Bonn zu tun.
Sie wiederum hängt unvermeidlich mit der für mich überraschend stark
dezentralisierten Struktur der Bundesrepublik zusammen. Natürlich wußte ich,
daß Deutschland eine Föderation ist, eine echte Föderation mit
Sonderbefugnissen der einzelnen Länder und gesetzlich verankerten
Traditionen, die jeweils nur hier anzutreffen sind. Was mir zunächst aber
unbekannt war, jedenfalls in dieser Dimension, ist die weitläufige
Verteilung von Bundesbehörden und solchen Einrichtungen, die dem Bund
unterstehen, über die gesamte Republik, von Medienzentralen oder wichtigen
Wirtschaftsgremien ganz abgesehen. Institutionen wie die Notenbank, das
Bundesverfassungsgericht oder der Bundesgerichtshof befinden sich nicht am
Regierungssitz, wie es etwa in Frankreich der Fall wäre. Zahlreiche
Veranstaltungen, die ich besuchen muß, finden deshalb außerhalb von Bonn
statt.
Ob ich will oder nicht, die vielen Reisen
ziehen meinem Deutschstudium bei Frau Toscha enge Grenzen. Dafür lerne ich
mehr und mehr das Land kennen. Außerdem genieße ich es, mich mit meinen
Sicherheitsbegleitern zu unterhalten. Die Aufmerksamkeit, mit der sie meine
Reden, die ich immer frei halte, bei allen nur möglichen Gelegenheiten
verfolgen, gilt den Fehlern, die mir unterlaufen. Sie haben sichtlich Spaß
daran, sie zu notieren und mir hinterher zu erklären, während ich mir wie
ein Schüler Notizen mache. Ihre Kritik ist freimütig. Anders als Zuhörer,
die mir zu schmeicheln meinen, wenn sie mein »flüssiges« oder »fehlerloses«
Deutsch loben, halten sie sich mit pauschalen Komplimenten zurück und äußern
sie nur, wenn sie glauben, Grund dazu zu haben. »Heute gab es mehr Fehler,
recht schlimme sogar, die Sie nicht wiederholen sollten«, sagen sie, wenn
sie mich ertappt haben. Oder: »Diesmal waren Sie gut, kaum Fehler!«
Wenn ich irgendwo öffentlich reden muß, bitte
ich meine Schutzengel um Beistand – ganz sicher ist man nie, trotz aller
Wachsamkeit. Aber auch harmlos-komische Vorfälle lassen sich nicht
ausschließen. Als ich einmal in einem der neuen Bundesländer auf einer
größeren Veranstaltung in einem entsprechend weiträumigen, dicht gefüllten
Saal sprach, waren meine Sicherheitsleute wie gewöhnlich dabei. Einer hatte
sich an die Wand gelehnt und machte sich während der Rede Notizen – ein
Zeichen, daß mich auf der Rückfahrt die üblichen Korrekturen erwarten
würden. Am Ende, als sich der Saal leerte, kam eine ältere Dame zu mir. Sie
wirkte besorgt und fragte, ob ich keine Angst vor Verfolgungen der Polizei
hätte. Ich verneinte, warum sollte ich? »Vielleicht macht es Ihnen nichts
aus, weil Sie Botschafter sind«, meinte sie daraufhin, »aber wer weiß, was
uns passieren wird ...« Als ich sie bat, sich näher zu erklären, erfuhr ich
den Grund ihrer Befürchtungen: »Was Sie nicht wissen, wissen wir: Die
Geheimpolizei hat vorhin, als Sie sprachen, alle Anwesenden aufgeschrieben
...«
Nicht allein das Verhältnis zu meiner
Leibwache ist gut. Gleich, ob höhere Beamte, ob Abgeordnete im Bundestag, ob
Parteichefs, Minister oder Mitglieder von Landesregierungen – im Umgang mit
allen, bis hin zum Bundeskanzler und zum Bundespräsidenten, bin ich von
Anfang an fast ausnahmslos auf entgegenkommendes Wohlwollen gestoßen. Immer
wieder heben meine Gesprächspartner die guten Beziehungen der Bundesrepublik
zu Israel hervor, die denkbar beste Voraussetzung für meine Arbeit und
meinen Aufenthalt überhaupt. Außenminister Kinkel etwa hat sich gleich
mehrfach in diesem Sinn geäußert – »Sie müssen doch in Deutschland glücklich
sein!« –, und Bundeskanzler Kohl, den ich im Juni 1995 auf seinem zweiten
Staatsbesuch in Israel begleitete, meinte gar, mein Posten in Deutschland
sei so ideal, daß sich Geld dafür eigentlich verbiete. »Bekommt er denn ein
anständiges Gehalt von Ihnen?« fragte Kohl – er wies auf mich – bei einem
privaten Essen im Haus von Shimon Peres, dem Gastgeber. »Ja«, sagte Peres,
»das beste, das wir bieten können.« Kohl darauf: »Das ist ein Fehler. Sie
sollten ihm überhaupt nichts zahlen, er sollte Ihnen etwas geben, für solch
ein Amt sollte man nicht auch noch Geld bekommen, umgekehrt müßte es sein!«
Ich will nicht behaupten, daß der Kanzler damit völlig unrecht hatte. Aber
ich bin dankbar, daß Shimon Peres seinen Ratschlag nicht angenommen hat ...
Am 26. November 1993, nach ersten Kontakten
mit Beamten des Auswärtigen Amts, empfing mich Bundespräsident von
Weizsäcker zur Überreichung meines Beglaubigungsschreibens. Gewöhnlich nimmt
der Präsident an einem bestimmten Vormittag die Schreiben von mehreren
Botschaftern entgegen, in einer vorher festgelegten Abfolge, in der die
Botschafter einander nicht sehen: Erst wenn der eine die Villa Hammerschmidt
verlassen hat, folgt der nächste, während die an der Zeremonie beteiligten
Deutschen im Hintergrund bleiben. Als die Reihe an mir und der offizielle
Teil vorüber war, nahm der Präsident mich am Arm und ging mit mir ins Freie,
wo außer vielen Fotografen und Journalisten auch Kameraleute vom Fernsehen
warteten. Ich sei der einzige an diesem Morgen, der Fotografen und
Presseleute angelockt habe, sagte Richard von Weizsäcker. Für die
Amtskollegen habe es nur den offiziellen Fotografen gegeben, keine Medien.
»Das kommt daher«, erklärte er, »daß Israel noch immer ein interessantes und
empfindliches Thema für uns ist. Mehr eigentlich als sämtliche Großmächte.
Wir freuen uns, daß Sie unter uns sind.«
Diesen Satz habe ich von ihm noch öfter
vernommen, auch später, als er ins Privatleben zurückgekehrt war. Richard
von Weizsäcker dachte dabei weniger an mich. Was er ausdrücken wollte – ich
empfand es immer als eine von Herzen kommende Ehrung –, war einfach die
Freude, daß es in Deutschland heute einen Botschafter Israels gibt.
Es war das sechste Mal in meiner Laufbahn,
daß ich eine derartige Zeremonie erlebte. Was sonst ein feierlich
erhebendes, freudig erwartetes Ereignis gewesen war, verursachte diesmal,
noch bevor es begonnen hatte, einige Beklemmung: die Ehrenformation
deutscher Soldaten, dann die alte, von einem Musikzug gespielte Melodie von
»Einigkeit und Recht und Freiheit«, die in meinen Ohren wie »Deutschland,
Deutschland über alles« klingt – wie würde mir da zumute sein? Tatsächlich
habe ich mit der deutschen Nationalhymne immer noch Probleme. Auch der
Wohlklang von Joseph Haydns Melodie hilft mir nicht über den Eindruck
hinweg, daß dem »Deutschlandlied«, in der NS-Zeit immer und immer wieder
gesungen und gespielt, noch etwas vom Machtwahn des Hitler-Reiches anhängt.
So gut wie keine Hemmungen empfand ich
dagegen im Umgang mit Repräsentanten der Bundeswehr oder Angehörigen des
Verteidigungsministeriums. Wenn es sie am Anfang überhaupt gab, dann löste
sich die Befangenheit bald durch sachliche Zusammenarbeit und ausgezeichnete
persönliche Beziehungen. 1994, ein Jahr nach meiner Akkreditierung, empfing
ich Klaus Naumann, den Generalinspekteur der Bundeswehr, zum Abendessen.
Anlaß war der Besuch des Oberbefehlshabers der israelischen Streitkräfte,
General Ehud Barak. Da zufällig meine Schwiegermutter bei uns Urlaub machte,
saß auch sie mit am Tisch. Als die Gäste gegangen waren, fragte ich sie, die
Auschwitz-Überlebende, ob sie in Gegenwart des höchsten deutschen Offiziers
viel an die Vergangenheit hatte denken müssen. »Natürlich«, antwortete die
rüstige alte Dame, »viel habe ich gedacht. Auch, daß solch ein Abend nicht
mal im verrücktesten meiner Lagerträume hätte vorkommen können. Aber ich
weiß nicht, welche Vorstellung wäre wohl wahnsinniger gewesen: ich bei
Tisch, während meine Tochter Gastgeberin des deutschen Oberbefehlshabers
ist, oder die andere: daß wir einen General haben, den Anführer einer sieg-
und ruhmreichen Armee, der sich mit seinem deutschen Kollegen an einen
gedeckten Tisch setzt, wie gute Freunde.« Und wie immer, wenn etwas sie
stark bewegte, seufzte sie: »Ach, wenn meine Mutter das hätte erleben können
...«
Es waren übrigens Matrosen der Bundesmarine,
die anläßlich meiner Akkreditierung als Ehrenformation vor der Villa
Hammerschmidt angetreten waren. Die beiden Nationalhymnen, zuerst die
israelische, dann die deutsche, hörte ich, aufrecht stehend, mit einem dem
Ernst dieses Augenblicks teils angemessenen, teils widersprechenden Gefühl.
Erinnerungen an ähnliche Momente, an die Geschichte dieses Landes und an die
meines eigenen, Gedanken an die vor mir liegenden Aufgaben, die Frage, ob
ich sie zum Wohl der Beziehungen Israels zu Deutschland bewältigen würde –
alles das mischte sich mit dem Wissen um die Sympathie, die mir bisher
entgegengebracht worden war. Fotos, die mich an der Seite Richard von
Weizsäckers in der Villa Hammerschmidt zeigen, verraten etwas vom eigenartig
lähmenden Gefühl, das mich in diesen Minuten beschlich. Es verschwand erst,
als der Präsident mich zu einem Gespräch zur Seite nahm.
Daß ein Botschafter, nachdem er sein
Beglaubigungsschreiben überreicht hat, zuerst dem Außenminister des
Gastlandes einen Antrittsbesuch abstattet, ist eine der festen
internationalen Regeln der Diplomatie. Ich sah da keine Probleme, geriet
aber doch unfreiwillig in Schwierigkeiten, als ich mich bei Klaus Kinkel im
Auswärtigen Amt angesagt hatte. Ich war, wie es sich gehört, pünktlich. Ein
Beamter, der mich empfing, deutete an, es gebe leider eine Verzögerung, der
Minister habe mit einem unerwarteten Gast zu tun. Ich versuchte, meine
Situation zu erklären – eigentlich hätte ich viel Zeit, wenngleich nicht
unbegrenzt, denn in einer, spätestens in eineinhalb Stunden müsse ich zum
Frankfurter Flughafen, wo Shimon Peres, unser Außenminister, zu einem
Zwischenstop landen werde. Peres wollte mich dort treffen, der Termin ließ
sich nicht verschieben.
Ich wartete also. Die Zeit verstrich, und als
ich schon entschlossen war, mich um einen neuen Termin zu bemühen, stand ich
doch noch, mit vielen Entschuldigungen empfangen, dem Außenminister
gegenüber. Er wußte, daß ich in Frankfurt erwartet wurde, bestand aber
darauf, mich zu sehen. Der Empfang könne allerdings nur kurz sein, sagte er,
er wolle mich nicht lange aufhalten, mir nur sagen, wie sehr er sich freue,
einen neuen israelischen Botschafter in Deutschland begrüßen zu können, wie
gut die Beziehungen zwischen beiden Ländern seien, welche Sondernatur dieses
Verhältnis habe und auch künftig haben werde. Alsdann wünschte er mir viel
Glück und Erfolg für meine Mission in Deutschland. »Und jetzt bitte kein
Wort, gehen Sie schnell zu Ihren Leuten und fahren Sie nach Frankfurt. Aber
bitte vergessen Sie nicht, Shimon Peres sehr herzlich von mir zu grüßen. Auf
Wiedersehen, Herr Botschafter!«
Ich hatte kaum ein Wort gesagt. Draußen auf
dem Korridor wandte ich mich an Theodor Wallau, zu jener Zeit noch Bonner
Ministerialdirektor, heute Botschafter in Israel, der mich begleitete:
»Finden Sie nicht auch, daß meine Vorstellung beim Außenminister und das
Gespräch ausführlich waren und höchst interessant?« »Doch«, sagte Wallau,
»ich werde gleich einen detaillierten Bericht schreiben ...«
So begann mein Verhältnis zu Außenminister
Kinkel fast unverhofft heiter. Danach war es, ebenso unerwartet, Turbulenzen
mit wechselnder Heftigkeit ausgesetzt, bis es in eine immer engere,
vertrauensvollere Zusammenarbeit überging. Sie schloß Mißverständnisse
ebensowenig aus wie Verstimmungen, die sich daraus ergaben. Kritisch wurde
es, ohne mein Zutun, nur einmal. Daß daraus kein ernsthaftes Zerwürfnis
entstand, war vor allem Kinkels aufrichtigem, ohne Umschweife direktem Stil
zu danken.
1994, ich war zur Behandlung in einem
Krankenhaus in Israel, lud Shimon Peres Bundesminister Kinkel zur Teilnahme
an der Zeremonie anläßlich der Unterzeichnung des Friedensabkommens mit
Jordanien ein. Turnusgemäß war der deutsche Außenminister damals auch
Vorsitzender des Ministerrats der Europäischen Union, denn Deutschland hatte
die Präsidentschaft inne. Nach den Bundestagswahlen von Koalitionsgesprächen
voll in Anspruch genommen, lehnte Kinkel zunächst ab, aber es war dann noch
einmal Peres, der ihn in einem Telefongespräch doch noch zur Reise in den
Süden Israels überreden konnte. Dort, an der Grenze zu Jordanien, sollte das
Abkommen feierlich unterzeichnet werden.

Mit Ministerpräsident Jitzhak Rabin im
Kanzlerbungalow in Bonn, 29. März 1995.
Kinkel kam also, war aber nicht wenig
überrascht, als er entdeckte, daß auf der Ehrentribüne kein Platz für ihn
reserviert war. Man bedeutete ihm, die Tribüne sei ausschließlich
regierenden Staatsoberhäuptern vorbehalten, Männern wie König Hussein von
Jordanien, US-Präsident Clinton und dem israelischen Premier Jitzhak Rabin.
Kinkel war zunächst verblüfft, denn immerhin war er nicht nur als deutscher
Außenminister, sondern auch als Vorsitzender des EU-Ministerrats gekommen
und opferte kostbare Zeit. Er fügte sich aber und nahm – was blieb ihm
anderes übrig – im Publikum Platz. Um so verärgerter reagierte er dann, als
von der Ehrentribüne aus nach den Regierungschefs auch der russische
Außenminister Kosyrew das Wort ergriff. Außerdem sprach, als ranggleicher
Israeli, Shimon Peres.
Daß der deutsche Außenminister, noch dazu als
Vorsitzender des EU-Ministerrats, sich zu Recht düpiert sah, stand außer
Frage. Doch was war zu tun, um die Angelegenheit möglichst elegant zu
bereinigen? Eine Woche später, in einem Gespräch mit Peres noch vor meinem
Rückflug nach Deutschland, kam mir eine – wie ich glaubte – rettende Idee.
Ich schlug Peres vor, in einer Geste des guten Willens eigens nach
Deutschland zu reisen, wann immer es Kinkel passe. »Verbinden Sie den Besuch
möglichst nicht mit anderen Terminen«, riet ich. Auch müßte Peres nach dem
Gespräch mit dem deutschen Amtskollegen Bonn sofort verlassen, es durfte
nicht der Eindruck einer mehr zufälligen Begegnung entstehen. Peres stimmte
zu und gab mir grünes Licht.
Als ich sie ihm unterbreitete, war Kinkel von
der Besuchsidee unseres Außenministers offensichtlich bewegt. Noch einmal
machte er seiner Enttäuschung über die letzte Israelreise Luft und erklärte,
weshalb er auch nachträglich nicht die Art und Weise akzeptieren könne, in
der man bei der Feier in der israelischen Wüste mit ihm umgegangen sei. Er
nannte Einzelheiten und äußerte einige sehr vertrauliche Gedanken. Peres’
Vorschlag aber, nach Bonn zu kommen, mußte er gleichwohl ablehnen – so
erfreut er darüber war, er sah einfach keine Zeit für den Besuch. Gegen Ende
des Gesprächs bat Kinkel mich, Shimon Peres auszurichten, er werte dessen
Absichten als vollendete Tat.

Mit PLO-Chef Jassir Arafat anläßlich
der Verleihung des Deutschen Medienpreises ’95 in Baden-Baden, 23.
November 1995.
Waren damit alle Probleme gelöst? In
Wirklichkeit begannen sie erst. Am nächsten Montag, auf dem Flug zur
Ministerratssitzung in Brüssel, auf der es unter Teilnahme von Peres und
Arafat um Nahost-Probleme gehen sollte, erreichte Klaus Kinkel die
Mitteilung seiner Botschaft in Israel, der von mir nach Jerusalem geschickte
Bericht über unser letztes Gespräch sei in einer israelischen Zeitung
veröffentlicht worden, einschließlich der sehr persönlichen Details, die
Kinkel mir anvertraut hatte. Das war ein handfester Skandal, zumal es nur
zwei Personen gab, an die ich den Bericht adressiert hatte. Des deutschen
Außenministers erste – lautstarke – Reaktion vor seinen Mitarbeitern war:
Mit Primor spricht man nicht mehr.
Als er in Brüssel Shimon Peres traf, machte
Kinkel aus seinem Zorn keinen Hehl. Er folgte Peres auf einem Korridor,
ergriff ihn am Arm und empörte sich, während Peres ruhig blieb, die Erregung
des deutschen Außenministers aber durchaus verstehen konnte. Peres sah schon
bald danach gewisse Chancen für ein Versöhnungsgespräch, doch sollte es noch
vier Wochen dauern, bis sich der Sturm halbwegs gelegt und Kinkel sich
überwunden hatte, Bundespräsident Herzog auf seiner ersten offiziellen Reise
nach Israel zu begleiten. Aus Budapest kommend, traf er eine Stunde nach dem
Präsidenten auf dem Flughafen Ben Gurion ein. Peres war mit Roman Herzog zum
offiziellen Empfang schon nach Jerusalem vorausgefahren. So war es an mir,
Kinkel zu begrüßen, den ich seit der Affäre um meinen Bericht nicht mehr
gesehen hatte.
Noch im Auto, in dem außer ihm und seiner
Gattin auch Hans Blohmeyer-Bartenstein, Gesandter der deutschen Botschaft in
Israel, saß, ließ Kinkel seinem Unmut über alles Geschehene freien Lauf.
Mittlerweile wisse er allerdings, sagte er, daß nicht ich schuld an der
Veröffentlichung unseres Gesprächs sei. Der Ton wurde ruhiger, und wir
verabredeten uns zu einem Essen in meiner Bonner Residenz. Die Dinge rückten
allmählich wieder ins Lot.
Kinkels von einem Teil der deutschen Presse
attackierter »rauhbeiniger« Stil hat immerhin den Vorteil, daß man bei ihm
weiß, woran man ist. Er ist nach meinem Eindruck alles andere als
nachtragend. Mißhelligkeiten, Streit und Ärgernisse, wenn sie ausgestanden
sind, interessieren ihn nicht mehr. Typisch dafür ist seine Reaktion auf
einen Vorfall, der sich im Frühjahr 1996 ereignete.
Israel wurde damals von einer Reihe extrem
grausamer Terroranschläge heimgesucht. Trotz des Wahlkampfes für seine
Partei in drei Bundesländern, der seine Zeit und Kräfte stark beanspruchte,
ließ Kinkel sich von mir nicht nur über das Geschehen in Israel informieren,
er wollte auch wissen, wie er helfen könne. Das Ergebnis war, daß er zwei
Tage später nach Israel zu einem Treffen mit Ministerpräsident Peres und
Außenminister Ehud Barak flog. Vorgesehen war auch eine Begegnung mit Jassir
Arafat in Gaza. Ich begleitete den Bundesminister, blieb aber in Jerusalem,
als er nach einem Empfang bei Peres in einem Wagenkonvoi nach Gaza fuhr. Auf
der Rückfahrt, kurz vor Mitternacht, geschah es dann: Israelische Soldaten
an der Grenze stoppten die Kolonne, und Kinkel mußte mit seiner Begleitung
etwa eine dreiviertel Stunde am Straßenrand warten – in einer Gegend, in der
sich Fuchs und Hase Gutenacht sagen. Endlich kam die Erlaubnis zur
Weiterfahrt. Die Grenzposten hatten offenbar keine Anweisung erhalten, die
Wagen ungehindert passieren zu lassen.
Miryam Shomrat, die Protokollchefin, war in
heller Aufregung, als sie mir am nächsten Morgen von dem Vorfall berichtete.
Um dessen Peinlichkeit zu mildern, schlug ich Außenminister Barak vor, das
Gespräch, zu dem er Klaus Kinkel erwartete, sofort mit einer nachdrücklichen
Entschuldigung für das nächtliche Vorkommnis zu beginnen. So geschah es
auch. Kinkel reagierte trotzdem gereizt, doch als die beiden Außenminister
sich anschließend der Presse stellten und Barak abermals Anstalten machte,
die Schuld an Kinkels langem Grenzaufenthalt auf seine Schultern zu nehmen,
unterbrach ihn der deutsche Kollege: »All dies haben wir schon besprochen
und abgeklärt, das ist kein Thema mehr.« Dann ging er zu wirklich aktuellen
Fragen über. Davon gab es mehr als genug.
Kinkels pragmatische Sicht der
Nahost-Problematik hindert ihn nicht, sich in den Beziehungen zu Israel
besonders zu engagieren. So wie es keine bloße Geste war, daß er während
seines nur sechzehnstündigen Besuchs mit Opfern der jüngsten Terroranschläge
im Krankenhaus sprach und medizinische Hilfe anbot, so selbstverständlich
ist es für ihn, daß er, falls notwendig, jederzeit für mich erreichbar ist.
Ähnliches ließe sich über das Verhältnis zwischen meinen Mitarbeitern und
dem Bonner Außenministerium im allgemeinen sagen.
Verständnis also, Entgegenkommen und die
Bereitschaft, mir am Anfang meiner Mission jede nur erdenkliche
Unterstützung zu geben und das Einleben zu erleichtern – was konnte ich mehr
erwarten? Nachdrücklich wie selten habe ich diese Zuwendung von seiten
Richard von Weizsäckers empfunden, doch auch bei Roman Herzog, dem
Nachfolger, durfte ich von Anfang an einer besonderen Aufgeschlossenheit für
meine Arbeit sicher sein. Das erste Mal begegnete ich ihm noch in seinem Amt
als Präsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe. Der Tag meines
Besuchs, Wochen vorher vereinbart, war ausgerechnet derjenige nach dem
unglücklichen Urteil im Fall des Neonazis Deckert: Wegen Verleugnung des
Holocaust und Verbreitung der »Auschwitzlüge« war Deckert zweimal
verurteilt, nach der Berufung aber vom Obersten Gerichtshof in Karlsruhe
freigesprochen worden.
Herzog sprach das heikle Thema gleich am
Anfang an. Ich möge nicht unangenehm überrascht sein, meinte er, wenn er mir
sage, er halte das letzte Deckert-Urteil für vertretbar: »Unser Problem ist,
daß wir keine befriedigende Gesetzgebung haben, um Verbrechen dieser Art zu
ahnden. Es fehlt ganz einfach ein Gesetz, das die Verleugnung des Holocaust
strafbar macht. Ich bin sicher, daß es zustande kommt, noch vor dem 23. Mai
dieses Jahres.«
Unser Gespräch fand im Februar 1994 statt.
Das von Herzog genannte Datum war das der Präsidentenwahl, jedermann wußte,
daß er für das höchste Staatsamt kandidierte. Er hätte vage auch von
allgemeinen Bemühungen um das Gesetzesvorhaben sprechen können, aber es war
Herzogs entschlossene Zielstrebigkeit, die mir den Eindruck vermittelte, wie
ernst er die Angelegenheit nahm. Tatsächlich war er noch vor Beginn seiner
Amtszeit, dem 1. Juli, als Vorsitzender des Ersten Senats am
Bundesverfassungsgericht im Wege der richterlichen Rechtsfindung mit der
Angelegenheit befaßt. Der Beschluß des Senats vom 13. April machte den Weg
zur strafrechtlichen Verfolgung der »Auschwitzlüge« frei. Am 20. Mai wurde
die entsprechende Gesetzesvorlage im Bundestag eingebracht, am 4. November
1994 wurde das Gesetz verkündet. Deutschland wurde damit zum ersten Land,
das die Shoah-Verleugnung klar unter Strafe stellt.
Daß Herzog noch im ersten Jahr seiner
Präsidentschaft Israel einen offiziellen Besuch abstattete, als erstem Land
außerhalb Europas, machte die Stärke seines Interesses am weiteren Ausbau
unserer Beziehungen deutlich. Schon vorher, nach der Wahl zum
Bundespräsidenten, aber noch vor dem 1. Juli, dem Tag seines Amtsantritts,
war er – außerhalb des Protokolls – zu einem Essen in unserer Residenz. Auch
dieser Besuch war offensichtlich mehr als eine bloße Höflichkeitsgeste. Sehr
bewegt hat mich Herzogs Anruf im März 1996, mit dem er mich zu einem
Gespräch einlud. Israel stand wieder einmal unter dem Schock einer Reihe von
Terroranschlägen. Er wolle sich nicht mit öffentlichen
Solidaritätsbekundungen zufriedengeben, auch nicht damit, daß er seinem
Amtskollegen in Israel in diesem Sinne schreibe, sagte der Bundespräsident.
Vielmehr verspüre er das Bedürfnis, über die Tragödien, die sich in Israel
abspielten, direkt auch mit dem Vertreter unseres Staats in Deutschland zu
sprechen.
Bundeskanzler Helmut Kohl empfängt neu
akkreditierte Botschafter nicht rein automatisch oder routinemäßig zu einem
Antrittsbesuch. Er bittet neue Botschafter erst dann zum Gespräch, wenn
dafür ein triftiger Grund vorliegt, ein Thema etwa, das für ihn von
unmittelbarem Interesse ist. Ich wußte natürlich viel über ihn und kannte
auch die Stelle in dem schon erwähnten Erinnerungsbuch unseres ehemaligen
Botschafters Meroz, die Kohl noch als damaligen Oppositionsführer vorstellt:
»Helmut Kohl ... unterstrich immer wieder gegenüber offiziellen israelischen
Besuchern der Bundesrepublik wie auch in Gesprächen mit mir, daß seine
Partei das Erbe Adenauers fortführe, das heißt, daß sie die traditionelle
deutsche ›Israel-Partei‹ sei.«
Erste Gelegenheit, den Kanzler zu sehen,
ergab sich schon bald nach meiner Akkreditierung. Ministerpräsident Rabin
war zu einem kurzen Besuch nach Bonn gekommen, so daß ich Zeuge des
Gesprächs war, das er mit dem deutschen Regierungschef führte. Das eine oder
andere Wort wechselte ich mit dem Kanzler am Rande offizieller
Veranstaltungen, zu einer längeren Unterhaltung aber kam es bei einem
Abendessen, das nach dem Festakt anläßlich des 250. Jahrestags der Gründung
der Rothschild-Dynastie in Frankfurt am Main stattfand, wenige Wochen
nachdem ich mein Amt angetreten hatte.
Kohl war Ehrengast dieser Veranstaltung. In
seiner Festrede erinnerte er nicht nur an Meyer Amschel Rothschild, den
Gründer der Dynastie. Er hob auch hervor, »welche enormen Energien, welche
demokratischen, welche schöpferischen Kräfte durch die Emanzipation der
Juden freigestellt wurden. Ich erinnere hier in Frankfurt vor allem an den
freiheitlichen Patriotismus eines Mannes wie Gabriel Riesser, des
Vizepräsidenten der Nationalversammlung in der Paulskirche.« Ebenso würdigte
der Kanzler das »einzigartige Aufblühen von Mäzenatentum, gemeinnützigen
Stiftungen und philanthropischen Einrichtungen, für die es gerade hier in
Frankfurt so viele grandiose Beispiele gibt. In diesem Engagement drückt
sich eine auf langer jüdischer Tradition beruhende Sozialethik aus, für die
Mildtätigkeit und Gerechtigkeit, Nächstenliebe und Bürgersinn untrennbar
zusammengehören.«
Beim Essen saß ich links vom Kanzler, rechts
hatten die beiden Chefs der Rothschild-Familie Platz genommen, James de
Rothschild aus England und Guy de Rothschild aus Paris. Da beide Ehrengäste
kein Deutsch sprachen und Helmut Kohls Fremdsprachenkenntnisse, wie man
weiß, im Schatten seiner staatsmännischen Talente und Verdienste stehen, war
ich – unter den Blinden ist der Einäugige König – mit meinem, wie ich fand,
noch recht unbeholfenen Deutsch an diesem Abend des Kanzlers fast alleiniger
Partner beim Tischgespräch.
Der Festakt in Frankfurt mit rund hundert
Angehörigen der weitverzweigten Rothschilds fand kurz nach einer CDU-Tagung
in Hamburg statt. Wie alle Botschafter in Bonn hatte auch ich eine Einladung
als Beobachter erhalten. Es war das erste Mal, daß ich den Kanzler in voller
Aktion erleben konnte. Die Zeichen standen damals nicht gut für die Union,
Meinungsumfragen – zehn Monate vor den Bundestagswahlen – deuteten auf einen
klaren Sieg der SPD. Entsprechend gedrückt war die Stimmung im Saal. Allein
bessere Umfrageergebnisse, schien mir, hätten wie ein Gegenmittel wirken
können.
Dann aber kam der Auftritt des Kanzlers.
Seine Rede vertrieb im Nu alle Sorgen, die Unsicherheit wich wie durch einen
Zauber, und immer wieder brandete Jubel auf – man hätte meinen können, die
Wahlen seien schon gewonnen. Ich habe die verwandelnde Kraft, die den
Stimmungsumschwung bewirkte, insgeheim bewundert, ohne sie recht zu
verstehen, dazu war mir Deutschland noch zu fremd. Der Bundeskanzler aber
faßte meine Eindrücke, von denen ich ihm am Frankfurter Rothschild-Abend
erzählte, nur wie eine Bestätigung auf. »Ich kann mir vorstellen«, sagte er,
»daß Sie Ihrer Regierung schon einen Bericht geschickt haben, in dem mit
großer Sicherheit dargelegt wird, daß Deutschland im Laufe des Jahres eine
neue Regierung bekommt und daß dies das Ende Kohls sein wird. Lassen Sie
sich nicht täuschen – wir werden die Wahlen gewinnen.«
Genauso kam es dann auch.
Was wäre Politik – und die Diplomatie als
Teil von ihr – ohne Gespräche oder wenigstens die Entschlossenheit und
Bereitschaft dazu? Gespräche aber erfordern Zeit, ebenso Geduld, wenn sie
sich bewähren und zum Ziel führen sollen.
Als ich mich im Juni 1994 zum ersten
offiziellen Gespräch beim Bundeskanzler anmelden ließ und um einen Termin
bat, hatten wir es sehr eilig, denn es ging um Israels Beziehungen zur
Europäischen Union. Ich bat um ein Gespräch von etwa zwanzig Minuten, aus
dem Kanzleramt aber verlautete: Sie werden vierzig Minuten haben.
Tatsächlich geblieben bin ich dann rund eineinhalb Stunden, und zwar nicht
gegen den Wunsch des Kanzlers. Er war es vielmehr, der die Zeit ausdehnte,
und vieles von dem, was er erzählte, ist mir erinnerungswürdig und von
einigem Wert.
Das Hauptthema war, wie gesagt, die
Europäische Union. Als er mein Anliegen zur Kenntnis genommen hatte,
erklärte Helmut Kohl, er würde sich in der EU als Motor für uns verwenden.
Eine engere Verbundenheit mit der Union liege im Interesse Israels, wenn es
denn auf zwei Beinen stehen wolle – das eine sei Amerika, auf das wir nicht
verzichten sollten, das zweite sei Europa in Gestalt der EU. Im übrigen,
fügte er hinzu, wäre es im Interesse Deutschlands und der Europäischen
Union, wenn Israel sich darin verankere.
Das lange Gespräch, das sich aus diesen
Gedanken ergab, bestärkte mich in der Überzeugung, daß sich auf Deutschland
große Hoffnungen setzen ließen. Die Angst, die immer noch, in Europa wie in
Israel, vor einem infolge der Wiedervereinigung allzu stark gewordenen
Deutschland umging, würde sich nur durch dessen feste Einbindung in die
europäische Völkergemeinschaft, eben in die EU, überwinden lassen.
Aus meiner Zeit in Brüssel wußte ich, daß die
deutsche Politik, die europäische Einigung betreffend, die aufrichtigste
war. Kohl bekannte sich in dem Gespräch mit mir zu dieser Geradlinigkeit:
»Heute weiß jeder in Europa, daß Helmut Kohl ehrlich und beharrlich und
vertrauenswürdig die Vereinigung Europas und die Teilnahme Deutschlands an
dieser Entwicklung vorantreibt. Es stellen sich nur manche die Frage: Was
passiert nach Kohl? Darf man davon ausgehen, daß die deutsche Politik in
bezug auf die EU auf jeden Fall dieselbe bleiben wird?« Der Kanzler räumte
ein, nicht immer ein »so verständnisvoller Europäer« gewesen zu sein wie
heute, »aber sobald man sich die Welt von dem Sessel aus anschaut, in dem
ich jetzt sitze, versteht man, daß es anders nicht sein kann. Ich verspreche
Ihnen, wer immer in Zukunft in diesem Sessel sitzen wird, er wird die Dinge
ebenso sehen wie ich.«
Kohls Beharrlichkeit in Sachen Europa und
europäische Einigung nötigte ebenso Respekt ab wie das Feingefühl und die
Geduld, die er auf diesem höchst steinigen Weg bewies. In seinem Verhältnis
zu England konnten sich diese Tugenden bewähren. Ende Oktober 1991,
anläßlich des zwanzigsten Jahrestags des Beitritts des Vereinigten
Königreichs von Großbritannien zur EG, erschien in »Le Monde« ein Beitrag
mit Auszügen aus den Erinnerungen französischer Unterhändler, die 1956 an
den Verhandlungen zu den römischen Verträgen teilgenommen haben, den
Gründungspapieren der EG. Der Franzose Jean-François Deniau schrieb:
»Nie hat der würdige Vertreter des
Vereinigten Königreichs während der Verhandlungen seinen Mund aufgemacht, es
sei denn, um sich seine Pfeife anzustecken. Endlich – eines Tages und zur
Überraschung aller Beteiligten bat er um das Wort, und das auch nur, um eine
kurze Abschiedsrede zu halten. Er sagte: ›Herr Vorsitzender, meine Herren,
ich möchte mich für Ihre Gastfreundschaft bedanken und Ihnen versichern, daß
sie ab heute beendet sein wird ... Ich habe mit Interesse Ihre Arbeit
verfolgt, und ich muß Ihnen sagen, daß der künftige Vertrag, von dem Sie
sprechen und den Sie die Pflicht haben zu entwerfen, a) keine Chancen hat,
jemals vollendet zu werden; b) wird er trotzdem vollendet, hat er keine
Chance, gebilligt zu werden; c) wird er gebilligt, hat er keine Chance, in
die Tat umgesetzt zu werden. Wäre es trotzdem so, würde er auf jeden Fall
für Großbritannien vollkommen inakzeptabel sein.‹« Deniau erwähnt auch die
öffentliche Erklärung eines britischen Ministers, der an den Verhandlungen
teilnahm, wonach der Plan zur Schaffung einer europäischen Gemeinschaft im
Grunde nichts anderes sei als das Werk von Besiegten. Unter denen habe
England nichts zu suchen.
Als die Gemeinschaft dennoch ins Leben
gerufen wurde, gründeten die Engländer die EFTA. Diese Organisation sollte,
so schien es, die EG nicht nur behindern, sondern schlicht überflüssig
machen. De Gaulle vertrat damals die Auffassung, England solle zwar
EG-Mitglied werden, doch möglichst erst am Ende des Vereinigungsprozesses,
der Lauf der Dinge werde sonst nur unnötig gestört.
Zu solchen Behinderungen kam es tatsächlich,
nachdem Premierminister Edward Heath sein Land in die Gemeinschaft
eingebracht hatte. Darüber hinaus sahen sich die Kontinentaleuropäer öfter
als einmal Verdächtigungen, mitunter auch haltlosen Beschimpfungen seitens
der britischen Medien ausgesetzt. Zielscheibe ihrer Attacken gegen den
Europagedanken ist besonders Bundeskanzler Kohl. Als ihn einmal jemand auf
die Arroganz der Engländer ansprach, winkte er gelassen ab: »Verstehen Sie
doch, daß die Engländer zwei Weltkriege gewonnen haben. Wie würden wir uns
aufführen, hätten wir zwei Kriege gewonnen?«
Als Jacques Chirac im Mai 1995 zum
französischen Präsidenten gewählt worden war, schien es so, als müsse man
sich um die weitere Entwicklung der europäischen Vereinigung sorgen. Chirac
galt nicht gerade als ein begeisterter Europäer, und von den
Spitzenpolitikern, die ihn umgaben, war bekannt, daß sie die Europäische
Union einschließlich des Maastrichter Abkommens mehr oder minder energisch
ablehnten. Auch ich teilte diese Sorgen, allerdings nur kurze Zeit. Schon
einen Tag nachdem er in seinem Amt bestätigt war, traf der Präsident sich
mit dem deutschen Bundeskanzler in Straßburg – ein, wie mir schien, gutes
Omen. Man darf vermuten, daß der Kanzler bei den zahlreichen Gelegenheiten,
die die beiden Staatsmänner seither zusammenführten, seinem französischen
Partner auch den Gedanken nahelegte, den er im Gespräch mit mir in seinen
Diensträumen äußerte, nämlich daß vom Stuhl der höchsten Verantwortung die
Welt anders aussieht. Die Vereinigung Europas jedenfalls ist für Frankreich
kaum weniger unerläßlich als für Deutschland.
Die Annäherung Frankreichs und Deutschlands
nach dem Krieg fand ihren Ausdruck nicht nur im Abschluß von Verträgen. Sie
ging einher mit dem Abbau von Vorbehalten, Vorurteilen und Haß in beiden
Völkern, erfolgte aber nur langsam, nachdem Adenauer und de Gaulle dazu die
ersten Schritte getan hatten, mit ihrer persönlichen Freundschaft als
Unterpfand. Das erste Mal empfing de Gaulle den deutschen Kanzler noch in
seinem Privathaus in Colombey-les-deux-Eglises. Als er ihn endlich auch in
Paris begrüßte, gab er dem Besuch den Glanz und die Würde einer
Staatsvisite, wie sie eigentlich nur Präsidenten zukommt. Das französische
Volk habe den Gast mit Freude und Begeisterung aufgenommen, erklärte de
Gaulle hinterher auf der Pressekonferenz – eine Behauptung, die angesichts
der leeren Straßen in Paris und in den übrigen Städten, die Adenauer besucht
hatte, zumindest übertrieben war. Darauf angesprochen, daß die meisten
Franzosen sich in Wirklichkeit jeder Freudensäußerungen enthalten hatten,
erwiderte de Gaulle: »Ich weiß, aber ich will den Franzosen allmählich
beibringen, sich an einen deutschen Besuch zu gewöhnen.«
Bei allen Zeichen der Entspannung, das
Verhältnis zwischen beiden Ländern blieb lange schwierig. Eine Tafel neben
dem Eingang des »Quartier Napoléon« im Norden Berlins, dem Sitz des
französischen Stadtkommandanten bis zum Abzug der Truppen aus ihrem Sektor,
wies darauf hin, daß Napoleon am 27. Oktober 1806, nach der Schlacht bei
Jena, Einzug in Berlin gehalten hat. Eine weitere Tafel, im Vorzimmer des
Kommandanten angebracht, nannte mit den zugehörigen Daten die Namen der
französischen Gouverneure, die damals, bis 1813, in Berlin militärische
Befehlsgewalt ausübten, angefangen von General Clarke, Duc de Feltre, bis
Marschall Augerau. Daran schlossen sich, als hätte es keine mehr als
hundertdreißigjährige Unterbrechung gegeben, die Namen der französischen
Stadtkommandanten seit 1945 an: General de Beauchesne, General Lanson,
General Ganeval – und so weiter.
Über die deutsch-französischen Beziehungen
und die Tatsache, daß sich relativ wenig Franzosen für Deutschland
interessieren, sprach ich mehrfach mit dem ehemaligen Premierminister Michel
Rocard. 1969, als ich als junger Diplomat nach Paris kam, war er
Vorsitzender einer kleinen linksradikalen Partei, die sich PSU (Parti
Socialiste Unifie) nannte. Israel gegenüber ausgesprochen ablehnend
eingestellt, hatte sie gerade den Kontakt zur dortigen, ebenfalls radikal
linken Partei »Mapam« abgebrochen, weil sie sie für zionistisch hielt. Daß
Rocard und seine Getreuen keine Verbindungen zur israelischen Botschaft in
Paris wünschten, war bei dieser betont schroffen Haltung fast
selbstverständlich, unser Botschafter jedenfalls bemühte sich vergeblich,
Rocard einen Antrittsbesuch abzustatten.
So kam es einer kleinen Sensation gleich, als
ich eines Tages einen Anruf der Journalistin Danielle Molho von »L’Express«
erhielt. Ob ich bereit wäre, fragte sie zu meiner Verblüffung, Michel Rocard
kennenzulernen. Die Gegenfrage, ob er denn meine Bekanntschaft machen wolle,
wies sie zurück: »Sonst hätte ich Sie nicht angerufen.« Auch mein Hinweis,
für einen Mann wie Rocard wären der Botschafter oder der Gesandte sicherlich
bessere Gesprächspartner als der Botschaftssprecher, fruchtete nichts.
»Nein«, sagte Danielle Molho, »Michel Rocard ist im Grunde überhaupt nicht
bereit, einen Vertreter Ihres Staates zu treffen, er will Sie persönlich
kennenlernen.« Angeblich war er bei einer Fernsehsendung auf mich aufmerksam
geworden.
Das Treffen kam in der Wohnung der
Journalistin zustande, und zwar unter bemerkenswert konspirativen Umständen.
Rocard konnte oder wollte es sich nicht leisten, mit mir in der
Öffentlichkeit gesehen zu werden, weshalb ich eine Viertelstunde vor ihm das
Haus betreten und eine weitere Viertelstunde nach seinem Weggang warten
mußte – alles war vorher genau verabredet. Wir aßen gemeinsam zu Mittag,
während Rocard mich mit Fragen über Israel und den Nahen Osten geradezu
bombardierte. Ich kam mir vor wie bei einem Verhör, antwortete aber so
sachlich und nüchtern wie möglich. Am Ende hatte ich den Eindruck, daß es
bei dieser Begegnung, die unter so merkwürdigen Bedingungen zustande
gekommen war, bleiben würde.
Doch nicht lange, da rief Frau Molho mich
wieder an. Rocard war daran gelegen, mich erneut zu sehen, unter gleich
geheimer Abschirmung wie das erste Mal. So geschah es auch. Alles, was ich
ihm letzthin erzählte, habe er genau prüfen lassen, erklärte er. »Zu meinem
Erstaunen erwies sich alles als richtig.« Mich erstaunte das nicht so, denn
Rocard war offensichtlich ein Opfer der syrischen Propaganda, kein Wunder
bei seinen engen Beziehungen zu Syrien, besonders zur Schwesterpartei der
PSU, der anti-israelischen Baath-Partei des Präsidenten Assad. Mehrmals
hielt er sich in Damaskus auf.
Mittlerweile überzeugt, daß ich ihm zur Lage
Israels nur nachprüfbare Tatsachen erzählte, legte Michel Rocard Wert
darauf, unsere Gespräche in der Folgezeit fortzusetzen. Er zog sich
allmählich von seiner Partei zurück und näherte sich den Sozialdemokraten
an. Für die Geheimhaltung unserer Treffen gab es keinen Grund mehr, um so
weniger, als er begann, nach Israel zu reisen und sich dort mit führenden
Politikern unseres Landes zu treffen. Einmal, 1976, begegnete ich ihm dort
wieder, als ich, inzwischen Regierungssprecher in Jerusalem, François
Mitterrand als Gast der damals regierenden Arbeiterpartei zu betreuen hatte.
In Mitterrands Begleitung war auch Michel Rocard. Wir freuten uns über das
Wiedersehen und verbrachten einen Abend allein, danach aber gab es für den
inzwischen in die hohe Politik Aufgerückten keinen besonderen Grund zur
Fortsetzung unserer Verbindung.
Erst zwölf Jahre später kam es dazu, als
Rocard zum Premierminister Frankreichs berufen wurde. Ich war damals
Botschafter in Brüssel und schickte ihm in einem persönlich gehaltenen Brief
Glückwünsche zum Amtsantritt. Tage später rief er an: »Sie sind in Europa,
ohne daß ich es wußte! Wir müssen uns unbedingt sehen.« Ich teilte den
Wunsch: »Aber diesmal erwarte ich, daß unser Treffen geheim bleibt.« Meine
Pariser Kollegen sollten sich nicht sorgen, ich könnte von Brüssel aus
versuchen, hinter ihrem Rücken Kontakte zur französischen Regierung zu
knüpfen ...
Getroffen haben wir uns im Schloß Matignon,
dem Sitz des Regierungschefs, am Morgen des französischen Nationalfeiertags.
Zu dieser Stunde konnte mich hier, wie Rocard es vorausgesagt hatte, niemand
vermuten. Wir frühstückten zusammen, und am Nachmittag saß ich mit meiner
Familie auf einer Tribüne an den Champs-Élysées, um mir die große
Militärparade anzusehen. Die Karten dafür hatte mir Rocard zukommen lassen.
Jahre später, von Bonn aus, übermittelte ich
Rocard Beobachtungen und Stellungnahmen zum deutsch-französischen
Verhältnis. Die Zurückhaltung, mit der er sie aufnahm, bestärkte mich in der
Meinung, daß die Kluft zwischen Deutschen und Franzosen trotz aller
offiziellen Freundschaftsbeteuerungen und aller wirtschaftlichen
Annäherungen noch recht groß ist, aus psychologischen Gründen. Bereitwillig
aber nahm Rocard meinen Vorschlag an, einmal nach Bonn zu kommen, um in
privatem Kreis mit prominenten deutschen Politikern alle anstehenden Fragen
freimütig zu erörtern, ohne Dolmetscher, Protokoll und Medienpräsenz. Es war
ein erfolgreicher, überaus fruchtbarer Abend. »L’Express« widmete bald
danach eine ihrer Ausgaben Deutschland und den deutsch-französischen
Beziehungen. Rocards Beitrag in diesem Heft unterstreicht nicht nur die
Notwendigkeit der weiteren Annäherung beider Länder, er betont auch, wie
wichtig für die Franzosen und die Deutschen der noch engere Zusammenschluß
Europas sei, unabweisbar für die Zukunft.
Als ich dann einen der deutschen Politiker
wiedertraf, die an dem privaten Treffen mit Michel Rocard teilgenommen
hatten, jenem Abend, an dem fast alle Gespräche um dieses eine Thema
kreisten, durfte ich zu meinem Anteil ein schönes Kompliment entgegennehmen.
Mein Gastland, meinte der Betreffende, müsse mir eigentlich eine
Auszeichnung verleihen für den Beitrag, den ich zugunsten der
deutsch-französischen Verständigung geleistet habe. Ich hatte jedoch eher
die für uns alle schicksalhafte Europäische Union im Sinn.
Seit dem ersten ausführlichen Gespräch bin
ich dem Bundeskanzler des öfteren begegnet. Besondere Anlässe dazu waren
natürlich Besuche hochrangiger israelischer Politiker wie Jitzhak Rabin oder
Shimon Peres. Einmal kam er sogar zum Abendessen in meine Residenz – zur
neugierigen Freude aller Kinder aus der Nachbarschaft, die vor der Tür
Schlange standen und um Autogramme baten. Auffallend – und bewundert von
meiner Frau, die ihn weniger kannte – waren die Liebenswürdigkeit und
Geduld, mit der er auf die Wünsche der Kinder einging.
Vermeintliche Belanglosigkeiten, zunächst
kaum beachtet, nehmen in der Politik aufgrund einer kaum mehr zu steuernden
Eigendynamik mitunter Dimensionen an, die das Verhältnis zweier Staaten
empfindlich stören können. Vielfach sind es die Medien, die solche
Entwicklungen auslösen. Anfang 1995 erschien in der »Frankfurter Allgemeinen
Zeitung« ein Artikel mit der Nachricht, die Bundesrepublik habe sich dank
ihrer guten Kontakte zu Iran bemüht, für Israel die Freigabe der sterblichen
Überreste israelischer Gefallener und die Rückführung eines verschollenen
Kriegsgefangenen aus dem Libanon zu erreichen. Der normale Zeitungsleser
mochte die Meldung mit Interesse, doch ohne besondere Hintergedanken zur
Kenntnis nehmen. In israelischen Journalistenkreisen aber interpretierte man
den FAZ-Artikel inhaltlich und der Sache nach sofort als eine Art Deckung
der Bonner Politik gegenüber dem Iran. Anders als Bonn setzt Jerusalem sich
wie die USA für einen Boykott des Iran ein. Humanitäre Hilfe der
Bundesrepublik als Kompensation für ihre von Israel und den Vereinigten
Staaten gleichermaßen ungeliebte Iran-Politik – das etwa waren die
Vorstellungen, die der Artikel hervorrief.
Nun ist nicht jede Meldung, die in den Medien
erscheint, ein Evangelium. Bei aller Wertschätzung ihrer öffentlichen
Funktionen in demokratisch regierten Staaten – ich war selber jahrelang
Pressesprecher – kenne ich die Schwachpunkte der Berichterstattung und die
Gefahren, die allein im Termindruck etwa bei der Herstellung von
Tageszeitungen liegen.
Als junger Diplomat war ich Zeuge eines
Gesprächs zwischen Außenminister Abba Eban und dem Chefredakteur einer der
größten israelischen Zeitungen, in dem es genau um diese Gefahren ging. Das
Treffen war vom Sprecher des Auswärtigen Amts als Versöhnungsversuch
arrangiert worden, nachdem Abba Eban den Journalisten öffentlich gerügt
hatte. Laut las der Minister aus der Mappe vor, die er eigens für dieses
Gespräch vorbereitet hatte – Falschmeldungen und Irrtümer des Blattes,
dessen Chefredakteur vor ihm saß. Der Zeitungsmann hörte die lange Litanei
ungerührt an. Am Ende fragte Abba Eban: »Haben Sie denn nichts dazu zu
sagen, bestreiten Sie etwa meine Zitate?« »Nein«, sagte der Angesprochene,
»ich gestehe, daß wir die Fehler, die Sie nannten, wirklich begangen haben.«
Der Minister: »Na also!« »Kein also«, erwiderte der Chefredakteur, »habe ich
denn jemals behauptet, eine wissenschaftliche Zeitschrift zu leiten? Ich
führe eine Tageszeitung. Eine Tageszeitung wird unter Druck und in kurzer
Zeit gemacht, in Hektik. Fehler lassen sich da nicht vermeiden.« Der
Minister schwieg daraufhin.
Eile und Terminnot spielten auch eine Rolle,
als ich einem Pariser Journalisten zu Informationen verhalf, die zum einen
nicht von mir stammten, zum anderen auf wundersame Weise zu ihrem Urheber
zurückfanden. Ich war, damals Sprecher unserer Botschaft in Paris, mit einem
Nachtzug von einem Skiurlaub in die Hauptstadt zurückgekehrt und vom Bahnhof
direkt ins Büro gefahren, um zu sehen, was sich während meiner Abwesenheit
auf dem Schreibtisch an Post und sonstigen Papieren angesammelt hatte. Kaum
hatte ich mich gesetzt, als das Telefon läutete. Am Apparat war der für
auswärtige Politik zuständige Redakteur des Magazins »Le nouvel
observateur«, Jean Pierre Joulin. Er wollte mit mir dringend, möglichst
sofort und natürlich auch möglichst ausführlich über den Nahen Osten
sprechen, der betreffende Artikel müsse ganz rasch in Druck, jede
Viertelstunde sei kostbar, ob er nicht gleich kommen könne. Daß ich eine
Woche lang wie von der Welt abgeschnitten, im Urlaub ohne Zeitungen und
Radio gewesen war, irritierte ihn nicht, er bestand darauf, mich noch an
diesem Morgen zu sprechen. Ich gab nach, leichtsinnigerweise.
Denn während ich noch überlegte, woher ich
mir neueste Nahost-Informationen beschaffen sollte, von Leuten in der
Botschaft oder aus Berichten, die sich auf dem Schreibtisch stapelten – viel
Zeit war ohnehin nicht mehr –, blätterte ich in israelischen Zeitungen, die
ebenfalls auf dem Tisch lagen. Mein Blick fiel auf einen Artikel eines
bekannten israelischen Journalisten, Zeev Schiff von »Ha’aretz«. Ich las den
Beitrag bis zum Schluß – und da stand mein Besucher auch schon vor der Tür.
Was konnte ich ihm sagen? In meiner Ratlosigkeit habe ich ihm einfach, ohne
die Quelle zu nennen, erzählt, was ich kurz zuvor gelesen hatte. Er fand das
alles ungemein interessant, machte sich eifrig Notizen, bedankte sich und
ging.
Ein paar Tage später entdeckte ich in »Le
nouvel observateur« Joulins Artikel. Die Gliederung, die Abfolge der
Informationen, der Wortlaut der Formulierungen – alles glich, fast bis aufs
Haar, Zeev Schiffs Beitrag in »Ha’aretz«, nur daß dieser Text in Französisch
erschienen war und unter anderem Namen. Irgendwie war mir die Sache
peinlich, herzhaft lachen aber mußte ich, als mir, wieder einige Tage
darauf, in einer der neuesten Ausgaben von »Ha’aretz« ein Bericht ihres
Pariser Korrespondenten Eli Maissi vor Augen kam. Der Artikel entpuppte sich
als getreue Kopie dessen, was Joulin den Lesern von »Le nouvel observateur«
zur Lage im Nahen Osten mitgeteilt hatte. Niemand bei »Ha’aretz« hat den
Bumerang bemerkt, der unversehens und sozusagen durch die Hintertür in das
Blatt zurückgekehrt war.
Eine weniger belustigende Erfahrung mit Jean
Pierre Joulin, Anfang der siebziger Jahre, hätte mich warnen sollen. Er
wollte nach Israel und bat mich unter anderem, für ihn ein Interview mit Ben
Gurion zu arrangieren. Ich hatte Ben Gurion 1970 während der Feierlichkeiten
anläßlich des Todes von de Gaulle erlebt, wußte in etwa um den angegriffenen
Gesundheitszustand des Zweiundachtzigjährigen und glaubte, Joulin vor allem
auf die nachlassende Konzentrationsfähigkeit des alten Herrn aufmerksam
machen zu müssen. Joulin nahm das wortlos zur Kenntnis, reiste ab und
schrieb nach der Rückkehr in seiner Zeitung, wie übel es ihm in Israel
ergangen sei, vor allem im Umgang mit Regierungsbehörden. Schon deren
Sprecher in Paris habe im Hinblick auf die Meinungsverschiedenheiten Ben
Gurions mit der derzeitigen Regierung und um ihn unglaubwürdig zu machen,
den ehrwürdigen Staatsmann indirekt verunglimpft. Eine kleine
Ungeheuerlichkeit, doch sie richtete gottlob keinen Schaden an.
Auch der besagte Artikel in der FAZ hat
letztlich kein größeres Unheil verursacht. Er bot jedoch, wie gesagt,
Ansatzpunkte zu sehr unterschiedlichen Auslegungen, die wiederum Stoff genug
bargen, um die deutsch-israelischen Beziehungen zu belasten, zumindest wenn
man sich auf eine bestimmte Version versteifte. Der erste, der das zu spüren
bekam, war Joachim Bitterlich, der engste außenpolitische Berater des
deutschen Kanzlers. Als der Artikel erschien, hielt er sich in Jerusalem
auf. In Zusammenhang mit der Meldung mußte er persönliche Angriffe über sich
ergehen lassen – ausgerechnet er, der sich stets mit größter Einfühlsamkeit
und dem ganzen Einsatz seiner Person bemüht hat, die deutsch-israelischen
Beziehungen zu entwickeln und zu vertiefen. Bitterlich führte ein Gespräch
mit Ministerpräsident Rabin, das die Medien sofort zum Anlaß für alle
möglichen Spekulationen nahmen. Man ging so weit zu behaupten, Rabin
persönlich habe eine Kampagne gegen Deutschland entfacht.
Noch ehe sich die Krise deutlich abzeichnete,
geschweige denn handfeste Formen gewann, sorgte man sich bereits um ihre
möglichen Auswirkungen auf den Fortgang des Friedensprozesses im Nahen
Osten. Monate vorher, am 17. Oktober 1994, war ich von Bonn im Auto
unterwegs zur Schmerzbehandlung in einem Krankenhaus, womit ich eine
kleinere Operation, die in Israel stattfinden sollte, vor mir herschob. Es
war der Tag nach den Bundestagswahlen. Noch während der Fahrt erreichte mich
ein Anruf von Shimon Peres aus Amman, der Hauptstadt Jordaniens. Peres
interessierte zunächst der Wahlausgang, vor allem, ob Helmut Kohl wieder
Kanzler sei.
Dann kam er auf den eigentlichen Grund des
Anrufs zu sprechen, das Friedensabkommen mit Jordanien, über das er gerade
in Amman verhandelte. Es gebe noch ein Hindernis, sagte er, nämlich das
Problem der gemeinsamen Wasserversorgung mittels neu zu errichtender
Stauseen und Entsalzungsanlagen, Einrichtungen, die internationale
Investitionen in beträchtlicher Höhe erforderten. Für ihn, Peres, käme
allein schon aufgrund seines Einflusses auf die Gremien der Europäischen
Union als engagierter Förderer dieser Projekte, die gleichermaßen auf eine
Unterstützung der regionalen Entwicklung wie auf die Festigung des
Friedensprozesses hinausliefen, niemand anders in Betracht als der deutsche
Kanzler. Ich solle sofort klären, ob von seiten Kohls mit einer positiven
Behandlung dieser Frage zu rechnen sei. Peres wollte in Amman bleiben, bis
meine Antwort eintraf. Ich mußte also, schmerzgeplagt, schleunigst zurück.
Die Antwort kam noch am selben Tag. Der
Wahlsieger hatte gewiß anderes zu tun, als sich – vierundzwanzig Stunden
nach seinem Erfolg – mit Nahost-Problemen zu befassen, doch Kohl
signalisierte umgehend seine grundsätzliche Bereitschaft, sich unserer
Belange mit Nachdruck anzunehmen; die endgültige Antwort würden wir nach
genauer Prüfung unserer Pläne und nach den noch erforderlichen Gesprächen
mit der Europäischen Kommission erhalten. Der unterbrochenen Fahrt ins
Krankenhaus stand nun nichts mehr im Wege.
Nachdem Experten von allen Seiten unser
Vorhaben erörterten und die Kommission grünes Licht gegeben hatte, kam es am
15. März 1995 in Bonn zu einem abschließenden Gespräch mit dem Kanzler. Der
Termin, lange vorher vereinbart, nahm keine Rücksicht auf die Verstimmung,
die mittlerweile aufgrund des FAZ-Artikels in Israel wie in Deutschland
spürbar geworden war. Außer dem damals noch amtierenden Außenminister Peres
war auch der jordanische Kronprinz Hassan nach Bonn gekommen. Peres hatte
die atmosphärische Eintrübung des deutsch-israelischen Verhältnisses im
Sinn, als er, noch bevor er sich zum Kanzler begab, vor Journalisten in
einem beruhigenden und versöhnlichen, auf Ausgleich bedachten Ton äußerte:
Die Bundesregierung habe sich auf ausdrücklichen Wunsch Israels um die
Freigabe von Gefallenen und Vermißten beim Iran bemüht, dafür gebühre ihr
Dank.
Weil die übrigen Gesprächsteilnehmer –
Kronprinz Hassan, Außenminister Kinkel und Europa-Kommissar Manuel Marin –
noch nicht eingetroffen waren, hatte Peres Gelegenheit, sich kurz mit dem
Kanzler zu unterhalten, der ihn sehr freundlich empfangen hatte. »Ich hoffe,
Sie haben mitbekommen, was ich den Journalisten heute morgen erklärte«,
sagte Peres. Der Kanzler bejahte, aber: »Sie, Shimon, sind doch ein Freund,
mit Ihnen habe ich keine Probleme.« Peres versicherte, Ministerpräsident
Rabin werde öffentlich wiederholen, was er, Peres, den Journalisten gesagt
habe, Rabin habe es ihm telefonisch zugesagt. »Ich werde es glauben, wenn
ich es sehe«, erwiderte Kohl. Darauf Peres wieder: »Ich meine es im Ernst,
ich habe heute morgen mit Rabin gesprochen.« »Wie gesagt, lieber Shimon«,
wiederholte der Kanzler, »ich werde es glauben, sobald ich es sehe.« Das
anschließende Gespräch über die Wasserversorgung Jordaniens verlief so, als
gebe es zwischen Rabin und Kohl nicht den geringsten Meinungsunterschied.
Vollends hatte auf beiden Seiten die Vernunft
gesiegt, nachdem Jitzhak Rabin überraschend, wie aus einem plötzlichen
Entschluß, dem Kanzler einen Besuch abstattete. Die Weichen dafür stellten
Joachim Bitterlich und ein Freund des israelischen Ministerpräsidenten, der
Unternehmer Jekutiel Federmann. Rabin traf am Abend des 29. März in Bonn
ein. Ich fuhr sofort mit ihm zum Kanzler-Bungalow, wo wir zum Abendessen
erwartet wurden. Von einer gespannten Stimmung war schon am Anfang nichts zu
spüren, schon die Tatsache, daß beide Staatsmänner so kurzfristig und
außerhalb des Protokolls ein Treffen verabredet hatten, konnte als gutes
Vorzeichen gelten. Am Ende des Abends waren nicht nur restliche
Meinungsverschiedenheiten ausgeräumt und eine Reihe anderer Themen erörtert,
Rabin hatte sich auch in ein ihm bis dahin unbekanntes Getränk verliebt: in
deutsches Weizenbier. Der Bundeskanzler versorgte ihn damit fortan
regelmäßig, bis zum tragischen Tod Rabins Anfang November 1995.
Fünf Monate vor jenem Unglückstag, im Juni,
hat Rabin den deutschen Bundeskanzler noch auf israelischem Boden begrüßt.
Es war ein alles in allem gelungener und erfolgreicher Besuch, harmonisch
und von der persönlichen Wertschätzung getragen, die beide füreinander
empfanden. Das rundum positive Ergebnis dieser Reise war um so höher
einzuschätzen, als Kohls erster Aufenthalt in Israel, 1984, wie ich mehrfach
schon vor meiner Ankunft in Bonn hörte, eher zwiespältige Eindrücke
hinterlassen hatte. Diesmal, nach der offiziellen Verabschiedung in
Jerusalem, rief er mich im Bus, der ihn und seine Begleitung zum Flughafen
brachte, zu sich, sprach über einzelne Ereignisse und Begegnungen der
voraufgegangenen Tage und vertraute mir in einem Moment dieses persönlichen
Rückblicks an, mit welcher Sympathie er Rabin sah. »Jitzhak Rabin«, sagte
er, »ist der erste israelische Premierminister, vor dem ich überhaupt keine
Hemmungen habe.« Dazu mußte man wissen, daß der Kanzler während seiner
langen politischen Laufbahn fast allen israelischen Regierungschefs begegnet
war.
Es war dann auch mehr als bloße Hochachtung
vor einem Staatsmann und lag auch jenseits aller protokollarischen
Notwendigkeiten, daß außer dem Kanzler und dem Bundespräsidenten zahlreiche
weitere deutsche Politiker Jitzhak Rabin nach seiner Ermordung die letzte
Ehre erwiesen und zu den Beisetzungsfeiern nach Israel kamen. Unter den
Trauergästen in Jerusalem waren auch der Vizekanzler und Außenminister, die
Bundestagspräsidentin, die Oppositionsführer der SPD und der Grünen, der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident sowie, nicht zuletzt, der
Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland. Rabins Tod hinterließ
bei ihnen wie in der gesamten deutschen Öffentlichkeit die traurige
Gewißheit eines nicht nur für Israel schmerzlichen Verlusts.
Das Programm, das Bundeskanzler Kohl als
Staatsgast Israels im Juni 1995 erwartete, sah nicht nur Begegnungen mit
hochrangigen Persönlichkeiten aus Staat und Regierung vor. Der Kanzler hatte
zunächst gezögert, als ich ihm eine entsprechende Namensliste überbrachte
und vorschlug, einen Abend auch im Kreis deutschsprachiger israelischer
Intellektueller zu verbringen. Die Gründe seiner anfänglichen Bedenken habe
ich nie erfahren, womöglich stellte er sich vor, Universitätsprofessoren,
bekannten Schriftstellern, Dichtern und Künstlern, die sich zum Teil mit dem
Holocaust befaßten, Fragen beantworten zu müssen, zu denen er, der
promovierte Historiker und Vorsitzende der »deutschen Israel-Partei«, schon
unzählige Male unmißverständlich Stellung genommen hatte. Dabei war gerade
dieser Abend ein besonders gelungener. Man inspirierte sich gegenseitig: Der
Kanzler erfuhr viel über Israel aus einer Sicht, die den Politikern fremd
war, und den Intellektuellen wurden, manchen zum ersten Mal, die Grundzüge
der deutschen Innen- und Außenpolitik erläutert.
Das gedrängte Programm, das der Bundeskanzler
bei seinem zweiten Staatsbesuch zu absolvieren hatte, sah für das Gespräch
mit dem damaligen Oppositionsführer Benjamin Netanjahu nur eine halbe Stunde
vor. Ich wartete im Jerusalemer King-David-Hotel auf ihn, den ich seit der
gemeinsamen Arbeit im Außenministerium gut kannte. Als er gekommen war, bat
er mich, ihm etwas über Kohl zu erzählen: »Was interessiert ihn, wie kann
man mit ihm reden?« Wir begaben uns in die Nähe des Gesprächszimmers, mein
Angebot aber, an der Unterredung teilzunehmen, wehrte er ab – er sei, sagte
er, kein Regierungsvertreter wie ich, er stehe für eine andere Partei, für
die Opposition, man dürfe da nichts vermischen. Als dann aber Joachim
Bitterlich die Tür öffnete und Netanjahu einzutreten bat, nahm er mich am
Arm: »Doch«, sagte er, »komm mit!«
Die ersten zehn Minuten vergingen, wie
üblich, mit dem Austausch von Höflichkeiten. Ziemlich unvermittelt dann
wollte der Kanzler von dem Besucher wissen, was er vom Frieden im Nahen
Osten halte. »Was soll ich sagen?« antwortete Netanjahu. »Was immer ich
sagen werde, Sie werden es nicht glauben. Man hat uns zu Feinden des
Friedens gestempelt, zu Leuten, die Krieg wollen. Ich persönlich wurde als
Faschist verleumdet, schlimmer noch: als Neufaschist!«
Der Kanzler lächelte. Auch er habe, deutete
er an, früher derart unqualifizierte Angriffe ertragen müssen. Während die
Zeit drängte, beteuerte Netanjahu den Friedenswillen der Likud-Opposition.
Von Anfang an habe sie sich für das Abkommen mit Jordanien eingesetzt und im
Parlament klar dafür gestimmt. Er selber sei nach Jordanien gefahren und vom
König empfangen worden, eigens um zu bekräftigen, wie entschieden Likud den
Frieden unterstütze – nicht anders als der Kanzler selbst, der sich ja in
dieser Sache ebenfalls engagiere. Das Gespräch, bei diesem Thema auch mit
bestem Willen nicht in ein paar Minuten zu beenden, schloß mit der Einladung
an Netanjahu zu einem Deutschlandbesuch in absehbarer Zeit.
Monate später, im Oktober 1995, traf er in
Bonn ein. Mir kam in den Sinn, wie Kohl sich im Juni auf der Busfahrt von
Jerusalem zum Flughafen über Netanjahu geäußert hatte: »Kommt er doch einmal
an die Macht, dann wird er nach meiner Überzeugung die gleiche Politik
betreiben wie Rabin, trotz allem.« Und, nach einer Pause: »Weil er, wenn er
es nicht tut, scheitern wird, und dazu ist er zu klug.«
Konsequent stellte Helmut Kohl im Bonner
Gespräch denn auch den Friedensgedanken über alle aktuellen Notwendigkeiten.
Er ermutigte Netanjahu und erläuterte seine Vorstellungen an einem greifbar
nahen Gegenstand, indem er auf das Miniaturmodell einer kunstvoll verzierten
Kanone hinter seinem Schreibtisch wies. Kohl erzählte die Geschichte des
Originals, mit dem es tatsächlich eine besondere Bewandtnis hatte.
Im Jahr 1524 in Koblenz gegossen und fünf
Meter lang, diente die Kanone der Stadt lediglich als Zierde. Nie ist aus
ihrem Rohr auch nur eine einzige Kugel abgefeuert worden. Ob es das Alter
war oder der schöne Reliefschmuck, Napoleon jedenfalls ließ das Prunkstück,
nachdem er Koblenz erobert hatte, nach Paris bringen und dort aufstellen.
Generalfeldmarschall von Moltke, in den sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts Chef der Koblenzer Garnison, erinnerte sich des Raubs, als
seine Truppen 1870 die französische Hauptstadt besetzten. Er sorgte für die
Rückkehr der Kanone, ein halbes Jahrhundert später jedoch, 1918, als
Deutschland kapitulierte und Koblenz abermals eine französische Besatzung
hatte, entführte man sie erneut nach Paris. Die Anordnung dazu kam vom
Befehlshaber der am Rhein stationierten Franzosen, Giscard d’Estaing. Das
Hin und Her wiederholte sich 1940, nach der Niederlage Frankreichs, und
1945, als das Dritte Reich am Boden lag.
Weder Adenauers gutes Verhältnis zu de Gaulle
noch das nicht weniger freundschaftliche, das Bundeskanzler Helmut Schmidt
zum französischen Staatsoberhaupt Valerie Giscard d’Estaing unterhielt, Sohn
jenes Offiziers, der nach dem Ersten Weltkrieg ihren Abtransport befohlen
hatte, vermochten etwas am Schicksal des Beutestücks zu ändern. Präsident
Mitterrand, kein Militarist, erst recht kein Trophäenjäger, zeigte sich
dagegen sofort zur Herausgabe bereit, als Helmut Kohl ihn darum bat.
Mittlerweile aber gehörte die Kanone zu den Beständen des Militärmuseums im
Invalidendom – sie dort herauszuholen und an ihren ursprünglichen Platz in
Deutschland zurückzuschicken, hätte den sofortigen Rücktritt des gesamten
Museumsvorstands bedeutet, hoher Armeeoffiziere im Ruhestand. Eine Lösung
zeichnete sich erst ab, als Mitterrand während eines Kanzlerbesuchs in Paris
die alten Herren zu einem Privatessen einlud, an dem auch Kohl teilnahm.
Er habe nach jenem Abend durchaus nicht
geglaubt, daß es ihm gelungen sei, die prominenten Armeepensionäre von der
Rechtmäßigkeit seines Wunsches zu überzeugen, sagte der Kanzler. Um so
überraschter sei er am nächsten Tag gewesen: François Mitterrand teilte ihm
mit, die alten Herren hätten gegen die Rückführung nach wie vor stärkste
Einwände, nähmen jedoch Abstand von ihrem Beschluß zur Demission. Damit war
die größte Hürde überwunden. Bald durften die Koblenzer sich wieder an ihrem
alten Besitz erfreuen.
»Sie haben von der Kanone, als sie
zurückgekehrt war, zwei verkleinerte Nachbildungen gießen lassen«, sagte der
Kanzler. »Die eine steht hier, die andere haben sie Präsident Mitterrand
angeboten. Ähnlich könnte man auch bei anderen Konflikten verfahren.«
Netanjahu war so beeindruckt, daß er die
Geschichte später, auf der Pressekonferenz nach dem Besuch beim
Bundeskanzler, den in Bonn arbeitenden israelischen Korrespondenten
erzählte. Er kenne, sagte er, keine schönere Friedensgeschichte als diese.
Präsident Weizmans Rede vor dem Bundestag im
Januar 1996 hat viele bewegt. Den meisten Zuhörern im Plenarsaal war
Betroffenheit anzumerken, so sehr, daß dahinter fast die Wirkung der Worte
zurückblieb, mit denen Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth den Staatsgast
empfangen hatte. Das war bedauerlich, um so mehr, als sie, seit vielen
Jahren um Versöhnung und Verständigung zwischen Deutschen und Juden,
zwischen Israel und der Bundesrepublik bemüht, in ihrer Eingangsansprache
einen dem Ernst der Stunde angemessenen Ton traf. Schade auch, daß Weizman
die Worte, die sie in Hebräisch an ihn richtete, nicht unmittelbar vernahm –
die Simultanübersetzung, die der Präsident über Kopfhörer verfolgte,
unterschlug sie sozusagen.
Weizman wußte, daß die Bundestagspräsidentin
zu den ersten gehörte, die Israel die Furcht vor der deutschen
Wiedervereinigung zu nehmen suchten. Im Sommer 1990, der Einigungsvertrag
war noch nicht unterschrieben, besuchte sie gemeinsam mit Sabine
Bergmann-Pohl, der Präsidentin der damals noch existierenden
DDR-Volkskammer, Jerusalem. Repräsentierte jede der beiden Damen ein halbes
Deutschland? Oder waren beide schon Vorbotinnen eines ganzen? Fest steht,
daß man ihnen viel Sympathien entgegenbrachte. Wieder einmal bestätigte sich
die Bedeutung persönlicher Begegnungen, gleich, ob spontan oder länger
geplant, ob offiziell oder außerhalb des Protokolls. Politik wird in
gewissem Sinne erst interessant durch die Menschen, die sie machen.
Das galt – und gilt – selbstverständlich auch
für meine Tätigkeit. Glücklicherweise war keine lange Anlaufzeit nötig, um
mir nicht nur über die innenpolitischen Verhältnisse in Deutschland ein Bild
zu machen. Dazu standen mir alle erdenklichen Informationsquellen zur
Verfügung. Wichtiger waren die persönlichen Eindrücke aus Gesprächen mit
jenen Frauen und Männern, die gestaltend in diese Verhältnisse eingriffen.
Aufschlußreich in dieser Hinsicht waren
Begegnungen mit Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt und mit Rudolf Scharping,
dem SPD-Vorsitzenden und einstigen Gegenspieler von Helmut Kohl. Schmidt
empfing mich zum Antrittsbesuch in seinem Büro im Bundeshaus. Die
Unterhaltung, so hochinteressant wie selten – oft sah ich danach den auch
heute einflußreichen Politiker nicht mehr –, drehte sich zunächst um
weltpolitische Themen. Dann kamen wir auf die nächsten Bundestagswahlen zu
sprechen und damit auf Scharping und dessen Chancen, Kohl als Kanzler
abzulösen. »Wird er im nächsten Jahr gewählt«, sagte Schmidt, »werden wir
auf jeden Fall einen recht guten Kanzler haben.« Scharping sei am Vortag bei
ihm gewesen. Schmidt wies in meine Richtung: »Er saß dort, wo Sie jetzt
sitzen.« Scharping müsse sich allerdings vordringlich für Außenpolitik
interessieren, vor allem für Frankreich, das sei Deutschlands wichtigster
Partner, gefolgt von den USA. Dann zählte Schmidt drei Staaten auf, Israel
war auch darunter.
Einen Monat später traf ich Rudolf Scharping
im Bahnhof Rolandseck bei einem Konzert. Zu meiner Überraschung wußte er,
daß ich bei Helmut Schmidt gewesen war, er verriet auch, wieso: »Ich war
einen Tag vor Ihnen da. Schmidt sagte: ›Auf dem Stuhl, auf dem du gerade
sitzt, wird morgen der israelische Botschafter sitzen.‹ Das war das
Stichwort, von da an sprachen wir auch über Außenpolitik. Ich müsse mich
damit dringend beschäftigen, meinte er, und nannte mir vorrangige
Ländernamen, unter anderen auch Israel.«
Vor den Wahlen dürfte der Kanzlerkandidat
kaum Zeit gefunden haben, sich ausführlich mit Israel zu befassen, wohl auch
nicht unmittelbar danach. In direkten Augenschein nehmen konnte er, dessen
Interesse an unseren Problemen bis dahin eher zurückhaltend gewesen war, die
reale Situation unseres Landes mitten im nahöstlichen Spannungsfeld erst
Ende Oktober 1995. Auf dieser Israelreise, seiner ersten, habe ich ihn
begleitet. Er wirkte wie verwandelt – lebhaft, aufgeschlossen, voller
Wißbegierde. Niemand konnte auch nur im entferntesten ahnen, daß er der
letzte ausländische Politiker sein würde, der Jitzhak Rabin noch am Leben
sah.
Wer stets ein Ohr hat für Israel, immer und
unermüdlich bereit, sich unserer Probleme anzunehmen, ist Scharpings
Parteifreund Johannes Rau, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Einmal
mußte ich auf ihn anläßlich einer Preisverleihung die Laudatio halten. Um
die Rede vorzubereiten, ließ ich von Mitarbeitern sämtliche Unterlagen
zusammentragen, die Auskunft über Raus langjähriges Wirken für unser Land
geben, Zeitungsberichte, Briefe, alle möglichen Dokumente – am Ende war es
ein dreißig Zentimeter hoher Stapel von Papieren, der auf dem Arbeitstisch
lag. Ihn im einzelnen durchzusehen, hätte viel Zeit und Mühe gekostet. Ich
nahm das Konvolut einfach mit und zeigte es den Festgästen: »Ein dickes Buch
würde nicht reichen, all das festzuhalten, was Johannes Rau für uns getan
hat.« Das war kaum übertrieben.
Der Humor dieses liebenswürdigen Mannes ist
unwiderstehlich. Außer vielen Anekdoten beweist das ein Foto von einer
Veranstaltung mit Johannes Rau als Redner. Es zeigt mich unter den Gästen im
Parkett mit einem so herzhaften Lachen, wie ich mich niemals zuvor habe
lachen sehen. Und wenn Rau mit Ignatz Bubis zusammentrifft, dem Vorsitzenden
des Zentralrats der Juden in Deutschland, dann biegen sich beide bald vor
Heiterkeit, ein Duo geistvollen, ausgelassenen Humors.
Beim Gedanken an das heutige Bündnis 90/Die
Grünen fiel mir immer wieder die Anekdote von jenem Amerikaner ein, der
verlangte, man solle ihn nicht mit Tatsachen verwirren, sobald er sich eine
feste Meinung gebildet habe. Oder ich dachte an eine andere Geschichte, eine
selbsterlebte, aus der Zeit des US-Präsidenten Reagan. Um die Reise eines
unserer führenden Politiker nach Washington vorzubereiten, saßen wir mit
rauchenden Köpfen in dessen Büro. Wir tauschten Meinungen aus, erteilten
Ratschläge, übertrafen uns gegenseitig in der Sorgfalt unserer Analysen,
alles nur des Gesprächs im Weißen Haus und der Dinge wegen, die dabei für
Israel auf dem Spiel standen. Hinterher erwiesen sich alle Sorgen, selbst
noch so beiläufige Vorbereitungen, als völlig überflüssig. Sobald er das
Gespräch mit dem Präsidenten begonnen hatte, erzählte uns der Rückkehrer,
stellte sich heraus, daß Ronald Reagan die Menschheit in zwei Teile schied,
ganz einfach, wie in einem Western-Film: in die »Guten» und in die »Bösen«.
Israel hatte das Glück, für Reagan unter den »Guten« zu rangieren.
Detaillierte Erläuterungen unserer Situation hätten nur gestört – wir
genossen automatisch und im voraus die Unterstützung des amerikanischen
Präsidenten.
So etwa, nur umgekehrt, stellte ich mir,
bevor ich sie kannte, die Grünen vor. Aus ihrer Sicht, dachte ich, müßten
die unterlegenen Palästinenser die »Guten« sein, die Israelis die »Bösen«.
Ich wußte, das Muster war allzu einfach, um als Modell für irgendwelche
Diskussionen zu dienen, andererseits hatte ich die Grünen als eine Israel
gegenüber sehr kritische Partei in Erinnerung, hartnäckig und selbstgerecht
in der Argumentation, auch derart voller Vorurteile, daß jeder sachliche
Meinungsaustausch schon im Vorfeld scheitern mußte.
Dann aber saß ich Joschka Fischer gegenüber,
dem Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Er, der Israel in den letzten
Jahren mehrfach besucht hat, auch mit anderen Funktionsträgern seiner
Partei, besitzt nach meinem Eindruck nicht nur eine erstaunliche
Sensibilität für die Probleme unseres Landes, er weiß sich auch in das
Verhältnis der Juden zu ihrer Vergangenheit zu versetzen. Die verstärkte
Dialogbereitschaft der Grünen hat sicherlich viel mit der Wende der
israelischen Politik seit 1992 zu tun, als die Arbeiterpartei wieder an die
Macht kam, doch wäre das nur ein Aspekt. Israel hat sich geändert, die
Grünen auch. Statt wie früher Lektionen zu erteilen, zeigen sie Verständnis,
sogar Solidarität. So war denn auch das Zusammentreffen Fischers mit dem
PLO-Vertreter in Deutschland, Abdallah Frangi, das in meiner Residenz
stattfand, ein Zeichen der Bereitschaft, die Situation im Nahen Osten
möglichst umfassend und differenzierter zu betrachten als noch in den
achtziger Jahren.
Außerhalb der Gespräche über Fragen der
deutsch-israelischen Finanz- und Wirtschaftsbeziehungen, für die er eine
unentbehrliche Rolle spielt, traf ich Theo Waigel zum ersten Mal in
Jerusalem. Es war im August 1994, als der Bundesfinanzminister die Arbeit in
Bonn für etliche Tage ruhen ließ und mit seiner Familie Urlaub in Israel
machte. Sein Ferienquartier lag in Eilat am Roten Meer, doch war ein Tag
auch für Jerusalem reserviert, wo ich an einer Botschafterkonferenz
teilnahm. Von Bonn aus über seinen Aufenthalt verständigt, konnte ich Waigel
damals trotz des rein privaten Charakters seiner Reise und dank des
wundersamen Zufalls, daß sie alle im Lande waren, nicht nur ein Gespräch mit
seinem israelischen Kollegen Avraham Schochat, sondern auch – völlig
unprotokollmäßig – Begegnungen mit Ministerpräsident Rabin und Außenminister
Peres vermitteln. Sogar ein Mittagessen mit Jerusalems ehemaligem
Bürgermeister Teddy Kollek, an dem auch Waigels Familie teilnahm, ließ sich
rasch und unkompliziert arrangieren.
Gut zwei Jahre später zählte Waigel mit
seiner Frau zu den Gästen eines offiziellen Essens, zu dem meine Frau und
ich in die Botschaft geladen hatten. Wir waren völlig ahnungslos, daß
ausgerechnet an diesem Abend ein Sportereignis ersten Ranges, dem halb
Deutschland entgegenfieberte, über die Bildschirme ging: das
Vorentscheidungsspiel um die Fußball-Europameisterschaft zwischen
Deutschland und England.
Als das Essen aufgetragen wurde, lag eine
eigentümlich erwartungsvolle Spannung in der Luft. Sie galt nicht unbedingt
der Speisenfolge. In der spürbar gelösten Stimmung bei Tisch wagte aber
niemand, den eigentlichen Grund lauter anzudeuten, als hinter vorgehaltener
Hand. Immerhin wurde, das Spiel lief bereits, nach dem »möglichen Stand der
Dinge« gefragt. Theo Waigel war es endlich, der, als die Tafel aufgehoben
und der Kaffee serviert wurde, den Bann brach, indem er sich höflich und in
sichtlichem Einvernehmen mit den übrigen Gästen erkundigte, ob es gestattet
sei, sich für das augenblickliche Torverhältnis zu interessieren.
Die Antwort erübrigte sich. Wir gingen alle
in einen Nebenraum, wo ein Fernseher stand. Und hier nun,
aufgeräumt-fröhlich, begann der eigentliche Abend, ein deutscher
Fußballabend mit Weizenbier, das die israelische Gastgeberin, meine Frau,
kredenzte. Zu dem Spiel mit Verlängerung und Elfmeterschießen als Höhepunkt
hörten wir Kommentare wie: »Na, Junge, tu doch endlich was!« oder: »Beweg
dich! Steh um Gottes willen nicht so rum!«
Es war schon spät, als die Gäste sich in
bester Laune verabschiedeten: »Herr Botschafter, wir danken Ihnen für diesen
unvergeßlichen Abend!«
Deutschland hatte das Spiel gegen England
gewonnen, Deutschland kam ins Finale.
Unsere Erfahrungen mit der Politik der
DDR-Regierung, die erst gegen Ende ihres Bestehens ihre betont unfreundliche
Haltung gegenüber Israel aufgab, gehören fast schon der Geschichte an.
Dennoch warf diese Politik auch nach der Vereinigung noch ihre Schatten. Es
gehört zur Logik jeder Konfrontation, daß sie Nachwirkungen hinterläßt,
Spuren des Mißtrauens, die sich auch durch noch so wohlmeinende Gesten nicht
einfach auslöschen lassen, auch wenn die Ursachen beseitigt oder, wie im
Fall der DDR, durch Entwicklungen weltpolitischer Größenordnung sozusagen
über Nacht null und nichtig geworden sind.
Vor diesem Hintergrund war das Angebot des
Vorsitzenden der PDS im Bundestag, Gregor Gysi, und einiger Kollegen, mit
uns in einen Dialog einzutreten, ein verheißungsvolles Zeichen. Daß an einem
Treffen mit der PDS-Gruppe außer mir auch Abdallah Frangi teilnahm, dürfte
Gysi und seinen Parteifreunden den Versuch des direkten Kontakts mit einem
Vertreter des Staates Israel erleichtert haben. Es war der Anfang eines
Meinungsaustausches, wie ich ihn in Bonn ständig auch mit anderen Parteien
führe, bemerkenswert aber doch insofern, als ich gleich zu Beginn des
Gesprächs von den Bemühungen Gysis und anderer erfuhr, die
Honecker-Regierung von ihrem Kurs gegenüber Israel abzubringen.
Es ist sicherlich kein Ruhmesblatt in der
Geschichte der DDR, daß ihre Regierungen den jüdischen Anteil am Widerstand
gegen Hitler lange verschwiegen und die deutschen Opfer der Judenverfolgung
einer Kategorie zugerechnet haben, zu der sie in Wirklichkeit nur zu einem
geringen Teil gehörten. Die sozialistische Zwecklüge von der
»Arbeiterklasse« und ihren Toten, unter die man alle Opfer, auch die des
Holocaust, zusammenfaßte, setzte deren Mehrzahl in bewußter Umkehrung der
Tatsachen mit Anhängern des Kommunismus gleich, so unsinnig, wie man sie
nachträglich zu proletarischen Helden machte. Im Grunde hat diese
»Umverteilung«, weil sie die Wahrheit grob verfälscht hat und allzu
vordergründige propagandistische Ziele verfolgte, sämtliche Nazi-Opfer
beleidigt, gleich, welchem Volk, welcher Religion, welchem Berufsstand oder
welcher Partei sie angehörten.
Dabei kannte die DDR-Führung die Wahrheit
genau. Viele ihrer Mitglieder waren selbst ehemalige Verfolgte. Die Jahre,
die sie in Lagern und Zuchthäusern oder in der Emigration verbrachten,
hätten sie zur Wahrheitstreue verpflichten müssen. Gerade sie, zumal
diejenigen unter ihnen, die im Widerstand mit Juden zusammengearbeitet
hatten, verfügten über detaillierte Kenntnisse über das Ausmaß des
Schreckens, das Hitler nicht nur in Deutschland, sondern im Krieg auch in
allen von deutschen Truppen besetzten Ländern über die jüdische Bevölkerung
gebracht hat. Unter seinem Vernichtungswillen haben sie mehr oder weniger
selber gelitten, und wenn nicht, dann kannten sie zumindest das erklärte
Ziel der Nazis, ein »judenfreies« Deutschland zu schaffen.
Wie erschreckend nah sie diesem Ziel waren,
zählt immer noch zu den beklemmendsten Erfahrungen meines Alltags. Nicht nur
Worte versagen vor den Abgründen des Wegs, der zur »Endlösung« führte. Oft
fehlt schon die Vorstellungskraft, um sich auch nur annähernd Details zu
vergegenwärtigen von dem, wofür es im Deutschen nur diesen schlichten,
einsilbigen Ausdruck gibt: Mord. Was hatte ich, fragte ich mich oft, in
einem Land zu suchen, in dem derartiges millionenfach geschehen konnte?   Nächster Teil
Nächster Teil
  Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Erschienen 1997 beim Ullstein-Verlag, Berlin
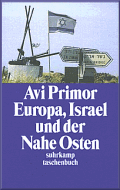


|