|
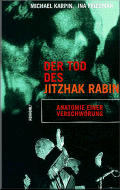
Michael Karpin und Ina Friedman:
Der Tod des Jitzhak
Rabin
- Anatomie einer Verschwörung
[BESTELLEN]
Die Hetzkampagne gegen Jitzhak Rabin in Israel
mochte noch so roh und schrill sein - verglichen mit der Kampagne in
den USA, die sich gemeinhin eines zivilen Umgangstons im politischen
Streit rühmen kann, konnte sie einem fast maßvoll vorkommen.
Aus Kapitel 5:
American Connection
Teil 2
Anfangs war es
nur ein feiner Riss
Michael
Karpin und Ina Friedman
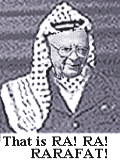 Colette
Avital, Israels Generalkonsulin in New York, verfolgte besorgt die
immer wildere Hetze gegen Israels Regierungschef Rabin und seinen
palästinensischen Partner Jassir Arafat. Die wachsenden
Feindseligkeiten, die nationalistisch-orthodoxe Kreise in den USA
gegen Israels Regierung schürten, dokumentierte sie die Ausfälle
gegen Jitzhak Rabin in einer Liste. Colette
Avital, Israels Generalkonsulin in New York, verfolgte besorgt die
immer wildere Hetze gegen Israels Regierungschef Rabin und seinen
palästinensischen Partner Jassir Arafat. Die wachsenden
Feindseligkeiten, die nationalistisch-orthodoxe Kreise in den USA
gegen Israels Regierung schürten, dokumentierte sie die Ausfälle
gegen Jitzhak Rabin in einer Liste.
In einem Bericht, den sie zwei Jahre nach dem
Händedruck Rabins und Arafats verfasste, listete sie die Namen der
Organisationen auf, die an der Offensive gegen die Osloer Verträge
beteiligt waren, darunter Americans für ein sicheres Israel, das
Weltkomitee für Israel, die Amerikanischen Freunde von Hebron,
Pro-Israel, Frauen in Grün, die Zionistische Organisation von
Amerika (ZOA), das Jerusalem Reclamation Project, das Central Israel
Fund-One Israel, Zo Artzenu, Yesha-One Israel Fund, Operation Kiryat
Arba, Operation Chizuk («Stärkung») und das Komitee für die
Bewahrung von Eretz Hakodesh (des Heiligen Lands).
 Am
meisten beunruhigte sie, schon wegen ihrer Mitgliederzahl und ihres
Einflusses, die orthodoxe Young-Israel-Bewegung. Am
meisten beunruhigte sie, schon wegen ihrer Mitgliederzahl und ihres
Einflusses, die orthodoxe Young-Israel-Bewegung.
Am 19. September
1993, nur sechs Tage nach dem historischen Händedruck auf dem Rasen
des Weißen Hauses, gab der Nationalrat von Young Israel bei einem
eilends einberufenen Treffen von Ostküstenrabbinern in New York -
ihre israelischen Kollegen waren über Satellit dabei - das Signal
zum Kampf gegen das Osloer Abkommen.
Young Israel
ist eine der mächtigsten Gruppierungen in der orthodox-jüdischen
Gemeinschaft Amerikas, mit etwa 20.000 Familien der Mittel- und
Oberschicht, die enge Verbindungen zu ähnlichen Kreisen in Israel
halten. Der rasch veröffentlichte Appell «für den Widerruf des
Osloer Abkommens» hatte einen unmissverständlich aufrührerischen
Unterton. Denn bei allen hartnäckigen Streitereien der politischen
Lager in Israel waren die Organisationen der amerikanischen Juden
bislang stillschweigend der Daumenregel gefolgt, in allen
Staatsangelegenheiten die jeweils gewählte Regierung Israels zu
unterstützen - oder zumindest nicht gegen sie aufzutreten. Das
Gelübde von Young Israel, das Osloer Abkommen zu bekämpfen,
spiegelte die Kluft im amerikanischen Judentum wider, die sich
zwischen der orthodoxen Gemeinschaft und den konservativen und
reformerischen Strömungen aufgetan und seit dem Sechstagekrieg
ständig verbreitert hatte.
Anfangs war es nur ein feiner Riß
gewesen, vorübergehend gekittet dank der Solidaritätswelle für
Israel, die durch das amerikanische Judentum lief, als im Mai 1967
der ägyptische Präsident Nasser seine Truppen zusammenzog und die
Straße von Tiran für Schiffslieferungen nach Israel sperrte. Mit
viel Energie betrieb man Spendenkampagnen. Tausende von Freiwilligen
wollten nach Israel fliegen und dort für die Reservisten
einspringen, deren Einberufung die Wirtschaft fast lahmgelegt hatte.
Das America-Israel Public Affair Committee (AIPAC), die wichtigste
pro-israelische Lobby in Washington, legte Überstunden ein, um die
Unterstützung von Wirtschaftsbossen und Kongreßmitgliedern für den
bedrohten Staat zu gewinnen, und bewies dabei erstmals seine
beeindruckende Stärke. Als den amerikanischen Juden am Ende des
Juni-Blitzkrieges aufging, was für einen überwältigenden Sieg Israel
errungen hatte, waren sie ebenso begeistert wie die Israelis selbst.
Diese brüderlichen Gefühle wurden noch verstärkt durch ein
unterschwelliges Schuldempfinden: Als das Gespenst der Vernichtung
das letzte Mal aufgetaucht war, während des Holocaust, war es der
Führung der amerikanischen Juden nicht gelungen, ihre Regierung für
die Sache der europäischen Juden zu mobilisieren.
Die
orthodoxen Juden allerdings hatten noch einen dritten Beweggrund:
eine religiöse Erweckungsbewegung, die zugleich auch den Charakter
der national-religiösen Gemeinschaft in Israel selber veränderte. In
einem Artikel der von Young Israel herausgegebenen
Vierteljahresschrift Viewpoint (Winter 1993) beschrieb Rabbiner
Simcha Krauss von der New Yorker Gruppierung
Young Israel of Hillcrest
die Auswirkung des Sieges auf die orthodoxen Juden in den
Vereinigten Staaten einerseits und seine Bedeutung für die Menschen,
die ihn persönlich errungen hatten, andererseits.
«Für Rabin und
andere israelische Führer, die keinen Sinn für die spirituellen
Dimensionen unseres Vermächtnisses haben, war der Sieg im
Sechstagekrieg in Wahrheit nur ein militärischer. Das Land, das
damals befreit wurde, hatte für sie keine besondere Bedeutung. Für
jene von uns, die yirei shomayim (gottesgläubig) sind, war die
spirituelle Bedeutung des Sechstagekriegs überwältigend, und das
Land, das er uns eingebracht hat, hat unser Leben verändert. Nicht
nur hat es unseren Stolz, Juden zu sein, erneuert, sondern auch
Tausende von Juden dazu angeregt, sich auf die spirituelle Suche zu
machen und die Bewegung der B'alej Tschuwah (Rückkehr zur Religion)
in die Wege zuleiten.»
Nach der Eroberung (oder, laut Krauss,
«Befreiung») von Großisrael entwickelte sich eine enge Symbiose
zwischen den orthodoxen Lagern auf beiden Seiten des Ozeans. Die
Zahl der orthodoxen Touristen, die nach Israel fuhren, schnellte
ebenso in die Höhe wie die der Studenten, die für ein Jahr oder
länger an speziellen Jeschiwah-Seminaren teilnahmen. Tausende junger
orthodoxer Amerikaner siedelten sich in den besetzten Gebieten an,
und Stiftungen für national-religiöse Projekte - wie die JRP, der
Yesha-Rat und die Gemeinde von Hebron - konkurrierten mit den schon
etablierten Kampagnenorganisationen United Jewish Appeal und Israel
Bonds um die Gelder orthodoxer Spender.
Besuche von
israelischen Rabbinern und rechten Politikern in den USA taten das
ihre, um die amerikanischen Freunde auf Trab zu bringen. Besonders
gefragt für Vortragsreisen durch die orthodoxen Gemeinden war Ariel
Sharon, der einige Male von Yehiel Leiter vom Yesha-Rat begleitet
wurde. Dieser hatte das Organisationsbüro seiner Spendenkampagne
schon 1992 nach New York verlegt und berichtete im Dezember 1993,
man habe in den letzten anderthalb Jahren 1,5 Millonen Dollar an die
Siedler überwiesen. Rusty Moslow, der Präsident von Pro-Israel,
prahlte ebenfalls, daß die Antwort auf 160.000 Briefe, die man im
Gefolge des Osloer Vertrags verschickt hatte, «unerwartet gut»
gewesen sei. Andere Likud-Größen wie der ehemalige Ministerpräsident
Jitzhak Shamir, der Jerusalemer Bürgermeister Ehud Olmert und der
Likud-Vorsitzende Benjamin Netanjahu, traten ebenfalls den Weg durch
die Vortragssäle an.
Die Konkurrenz um amerikanische Gelder für die Siedlungen war so
groß, daß es unweigerlich zu häßlichen Konflikten kommen mußte. Im
Dezember 1993 zum Beispiel erhob Jack Avital, der Vizepräsident des
Weltkomitees für Israel, gegen Benjamin Netanjahu den Vorwurf, er
habe für den Yesha-Rat bestimmte 200.000 Dollar zum Abbau des
riesigen Likud-Schuldenbergs verwendet. Der Likud entgegnete, das
Geld sei für eine große Demonstration verwendet worden, die zusammen
mit anderen Gruppen im Gemeinsamen Führungsstab organisiert worden
sei - womit er freilich unabsichtlich preisgab, daß die Spenden aus
den Vereinigten Staaten halfen, die Hetzkampagne gegen Rabin zu
finanzieren.
Hier lag der Gegensatz, der sich dann zu einer
Kluft verbreitern sollte, zwischen der orthodoxen Gemeinschaft in
Amerika und den Konservativen und Reformern in Israel, ganz zu
schweigen von den zahllosen amerikanischen Juden, die sich keiner
religiösen Strömung zuordnen, doch ihre Identität als Juden
bewahren. Da letztere keine ideologischen oder institutionellen
Bande mit den entsprechenden israelischen Kreisen geknüpft hatten,
engagierten sie sich nicht so vehement und direkt für Israel wie die
orthodoxen Juden. Die jährlichen Umfragen des American Jewish
Committee zeigen diesen Unterschied. In der Befragung von 1995 z.B.
sagten 72% der Orthodoxen, sie fühlten sich Israel «sehr verbunden»,
verglichen mit 13% der reformerisch eingestellten Juden. Zwar
stellen die Orthodoxen nur etwa ein Zehntel der sechs Millionen
Juden Amerikas, die israelischen Orthodoxen hingegen ein Fünftel der
Gesamtbevölkerung, doch inspirieren und unterstützen sich die beiden
Gemeinschaften in hohem Maße. Ihr passionierter Glaube und nicht
ihre Zahl sorgte für ihren politischen Einfluß.
Die Gebietseroberungen von 1967 veränderten laut
Rabbiner Krauss das Leben der orthodoxen Juden in den Vereinigten
Staaten grundlegend. Doch es gab einen weiteren «Tag, der unsere
Welt verwandelt hat», den 13. September 1993, als das Osloer
Abkommen zwischen Israel und der PLO unterzeichnet wurde. Yaakov
Kornreich, ein Journalist, der für verschiedene orthodox-jüdische
Zeitschriften schreibt, hat unter ebendiesem Titel seine Eindrücke
und Gefühle beschrieben, als «ein Vertrag öffentlich besiegelt
wurde, der eines Tages das Leben jedes einzelnen Juden verändern
wird». Während andere Beobachter auf der ganzen Welt Rührung oder
Begeisterung darüber empfanden, daß sich einstige Feinde auf
friedliche Weise ein Land teilten, das Konflikte ein Jahrhundert
lang zerrissen hatten, dachte Kornreich ganz anders: «Wir sahen
erschrocken und ungläubig zu», erinnerte er sich, «sprachlos und
hilflos außen vor stehend, als die Heimat von 130000 Juden [in den
besetzten Gebieten] mit einem Federstrich vielleicht für immer
hergegeben wurde.»
Sechs Tage nach dem schicksalhaften Federstrich in
New York trafen die Rabbiner der Young-Israel-Bewegung zusammen und
antworteten auf den Schock mit einem Aktionsplan. Keiner machte den
Vorschlag, erst einmal abzuwarten, um zu sehen, ob Kornreichs
Befürchtung über das Schicksal der Siedler zutraf. Niemand dachte
daran, erst einmal Luft zu holen und dem Frieden eine Chance zu
geben. Mit der Unterstützung schlachterprobter Kämpfer wie Rabbiner
Herbert Bomzer aus Brooklyn führten der Präsident von Young Israel,
Chaim S. Kaminetzki, und Geschäftsführer Rabbiner Pesach Lerner die
Bewegung ganz im Sinne jener Mitglieder, die nach Israel emigriert
waren und Dutzende von neuen Gruppen in den besetzten Gebieten
aufgebaut hatten. Und Young Israel war nicht alleine. In den
amerikanischen orthodoxjüdischen Kreisen war man entschlossen, das
gerade unterzeichnete Osloer Abkommen mit allen Mitteln zu
bekämpfen: mittels Gebeten, Versammlungen, Demonstrationen,
Rundbriefen, Leserbriefen, Radio- und Fernsehsendungen und vor allem
mittels Druck auf Lokal- und Bundespolitiker. Dieser Mühsal hätte
man eigentlich das Prädikat «Graswurzelbewegung» in der besten
Tradition der amerikanischen Demokratie verleihen können, hätte sie
nicht voll blindem Haß das Ziel verfolgt, eine demokratisch gewählte
Regierung in einem 12000 Kilometer entfernten Land zu stürzen.
Am 13. Dezember 1993 vermerkte Colette Avital in
ihren Aufzeichnungen die ersten Demonstrationen von Aktivisten der
AntiOslo-Bewegung. 300 Leute hatten sich auf dem Times Square
versammelt, die meisten von ihnen mit Gebetskäppchen und Plakate
schwingend, auf denen es hieß: «Macht Israel nicht zu einem zweiten
Libanon» und «Jüdisches Blut ist nicht billig», während sie den
Reden von Rabbiner Abraham Hecht, des Parlamentariers Dov Hilkind,
des Stadtrats Anthony Wiener und des Geschäftsmanns Sam Domb
lauschten. Von Zeit zu Zeit stürmten Demonstranten auf die Straße
und blockierten den Verkehr auf dem Broadway, bis der Polizeikordon
sie zurückdrängen konnte. Die Demonstration wurde vom World
Committee on Israel getragen, unter Führung des inzwischen
verstorbenen Dr. Manfred Lehmann, der sie als «überparteilichen
Protest» bezeichnete, weil «die alten und etablierten jüdischen
Organisationen gelähmt» seien. Robert Friedman von der Village Voice
fiel ein junger Demonstrant im Parka auf, der die Mütze der New York
Ranger und eine Sonnenbrille trug. Warum er gekommen sei? «Rabin ist
schlimmer als Hitler. Hitler war ein Goi, der Juden getötet hat.
Rabin ist ein Jude, der Juden tötet. Rabin sollte umgebracht
werden.»
Damals war dies noch eine vereinzelte Stimme;
Rabbiner und andere führende Vertreter der orthodoxen Gemeinschaft
schreckten vor solch hanebüchenen Vergleichen noch zurück. Dennoch,
die Demonstration war ein Dammbruch. Zum ersten Mal ertönten Rufe
wie «Tötet Rabin» und tauchten Plakate mit den Worten «Rabin -
Verräter» in der Menge auf. In Israel erlebte man dies erst vier
Monate später.
Voll Zorn über eine derart unerhörte Sprache
beklagte sich Colette Avital direkt bei Malcolm Hoenlein, dem
Direktor des einflussreichen Präsidentenrats von zweiundfünfzig
großen jüdischen Organisationen. «Das ist verbale Gewalt», fauchte
sie und verlangte eine scharfe Verurteilung der Hasstiraden. «Das
ist ansteckend und muss im Keim erstickt werden.» Doch Avital war
nicht die einzige, die Hoenlein anrief. Die Leiter von Young Israel
und der ZOA, die von ihrem weit rechts stehenden Präsidenten Morton
Klein zu den Demonstrationen geführt worden war, setzten Hoenlein
unter Druck, er solle neutral bleiben. Selbst bekannte Verfechter
des Friedens rieten zur Zurückhaltung, da ein Protest den Aktionen
einer kleinen Minderheit weitere Aufmerksamkeit verschaffen würde.
Schließlich brachte Hoenlein seine Missbilligung zum Ausdruck - ohne
nennenswerte Wirkung...
>>> Fortsetzung
folgt:
Auf dem Weg zum 4.November:
Die Propaganda gegen Arafat
bereitete den Weg
für die Hetze gegen Rabin
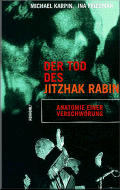 [Frühere
Kapitel] [Frühere
Kapitel]
Aus dem Buch von
Michael Karpin und Ina Friedman:
Der Tod des Jitzhak
Rabin
- Anatomie einer Verschwörung
[BESTELLEN]
Hebräische
Bücher:
Staat und
Gesellschaft
Nationalismus und rechte Gewalt:
Gott
führt Krieg
Der Mord an Rabin in den Augen eines israelischen
Linken...
hagalil.com
04-11-2004 |