|
Spurensuche:
Der jüdische Friedhof in Bad Wildungen
Zweimal im Jahr bietet Johannes Grötecke Rundgänge zur
jüdischen Geschichte in Bad Wildungen an. Einer führt durch die Altstadt, wo
früher viele Juden wohnten, der andere widmet sich ausschließlich dem
jüdischen Friedhof.
Kontakt für die
nächsten Termine
Johannes Grötecke hat dazu auch das Heft "Spurensuche"
herausgegeben, aus dem der nachfolgende Text zur Geschichte der Bad
Wildunger Juden zur Zeit des Nationalsozialismus entnommen ist. Das Heft
kann per Email beim
Autor bestellt werden. Außerdem erhältlich:
Juden und NS-Zeit in Bad Wildungen.
Ein Rundgang über den jüdischen Friedhof in Bad Wildungen
In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zogen dunkle
Wolken über Wildungen auf: Seit Mitte der 20er Jahre verzeichneten
rechtsextreme Parteien erste Wahlerfolge bei Reichstagswahlen. Vereinigungen
wie der Wikingbund oder die Ehrhardt-Brigade trieben ihr Unwesen. Eine
NSDAP-Ortsgruppe wurde hier bereits 1929 gegründet, und Nazi-Aktivisten wie
Joachim von Ribbentrop (später Reichsaußenminister) oder Roland Freisler
(später Vorsitzender des berühmt-berüchtigten Volksgerichtshofes) betrieben
lange vor der NS-"Machtergreifung" hier ihre Propaganda-Veranstaltungen. Die
Feindschaft zwischen Nazis und der Linken (Sozialdemokraten, v.a. aber
Kommunisten) und zwischen Nazis und Juden stieg an, wie es auch die
Geschichte der NSDAP-Ortsgruppe minutiös erzählt.
So endete denn auch die Epoche der trügerischen Idylle
zwischen Juden und Nichtjuden in Wildungen mit Beginn der NS-Zeit. Beispiele
für die systematische Verfolgung, Demütigung und Entrechtung sind: Juden
wurden in die sogenannte "Schutzhaft" genommen, ihnen wurden die
Gewerbescheine entzogen und das Schächten verboten; Schilder an den
Ortseingängen, an Arztpraxen und Geschäften verboten Juden den Zutritt; am
1. April 1933 wurden jüdische Geschäfte boykottiert, kurz zuvor einige Juden
zu einem demütigenden Umzug durch die Stadt gezwungen (einer soll einen
christliche Bauern durch unfaire Kreditgeschäfte in den Tod getrieben haben,
deshalb musste er ein Schild mit "Ich bin ein Mörder" tragen); Juden wurden
nachts von unbekannten Tätern überfallen, sie wurden mitsamt ihren
Vereinigungen von der Stadtverwaltung systematisch registriert. Mitte, Ende
der dreißiger Jahre durften jüdische Kinder nicht länger die Schule
besuchen. Juden durften nur noch zu festgelegten Tageszeiten in
vorgeschriebenen Geschäften einkaufen, der Zutritt ins Schwimmbad und zu
Kureinrichtungen war untersagt. Dass die Dr. Marc-Straße in Goecke-Straße
umbenannt wurde, weil Dr. Marc "ein jüdischer Mischling ersten Grades" sei,
zählt dabei eher zu den "kosmetischen" Maßnahmen (ebenso wurde die heutige
Brunnenstraße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt, die Friedrich-Ebert-Straße
hieß Hermann-Göring-Straße; Hitler, Göring und der Innenminister Frick
wurden zu Ehrenbürgern Wildungens ernannt).
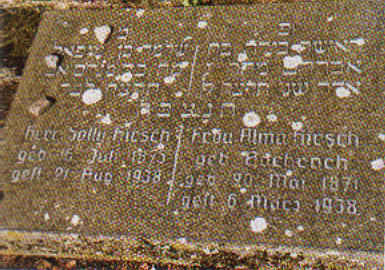 Ein
Beispiel für diese Zeit ist das Grab rechts des Eingangs von Sally Hirsch
(Bild rechts), der Ende der 20er Jahre für die Vereinigung "Handel und
Gewerbe" Stadtverordneter in Bad Wildungen und in den 30er Jahren zudem
Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war. Er betrieb ein Geschäft in der
Brunnenstraße 3 (heute Nr. 36) und starb (man sagt, auch aus Verbitterung
und Verzweiflung über die zunehmende Diskriminierung der Juden) am
21.8.1938, kurz vor der Pogromnacht. Es war und ist bis heute die letzte
Beerdigung auf dem hiesigen Judenfriedhof. Ein
Beispiel für diese Zeit ist das Grab rechts des Eingangs von Sally Hirsch
(Bild rechts), der Ende der 20er Jahre für die Vereinigung "Handel und
Gewerbe" Stadtverordneter in Bad Wildungen und in den 30er Jahren zudem
Vorsitzender der jüdischen Gemeinde war. Er betrieb ein Geschäft in der
Brunnenstraße 3 (heute Nr. 36) und starb (man sagt, auch aus Verbitterung
und Verzweiflung über die zunehmende Diskriminierung der Juden) am
21.8.1938, kurz vor der Pogromnacht. Es war und ist bis heute die letzte
Beerdigung auf dem hiesigen Judenfriedhof.
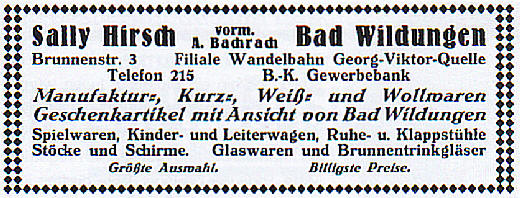
Anzeige im "Adreßbuch 1025 Bad Wildungen
Als Folge eben dieser Pogromnacht starben zwei Wildunger
Juden, nämlich der Fellhändler Julius Katz und der Viehhändler Max Marx. Die
letzten, noch vor Ort verbliebenen Juden wurden Ende 1939 nach Kassel
transportiert und dort kaserniert (Wildungen war jetzt also, so hieß das,
"judenfrei"). Von hier aus gingen 1941/42 die Deportationen in den Osten.
Etwa 50 Wildunger Juden kamen in den Konzentrationslagern um, nur drei
überlebten die Lager. 80 Juden flohen zuvor in deutsche Großstädte (wegen
der Anonymität) oder ins Ausland.
Wenn auch in jüngster Zeit wieder zunehmend jüdisches
Leben (durch etwa 100 sogen. "Kontingentflüchtlinge" aus Osteuropa) in
Wildungen einkehrt, bleibt festzuhalten, dass es lange Zeit nicht danach
aussah: Zwar gab es nach Kriegsende eine ca. 30 Mitglieder umfassende
Gemeinde, die v.a. aus us-amerikanischen Soldaten und sog. "displaced
persons" bestand, einen kleinen Betsaal im Hessischen Hof hatte, und deren
Vorsitzender Sally Zuckermann aus Grünberg war (noch 1952 wurden in einem
Lokal in der Hufelandstraße 15 jüdische Gottesdienste abgehalten); und auch
später lebten vereinzelt von außerhalb stammende Juden hier. Aber das waren
Ausnahmen, denn die Verfolgungen der NS-Zeit waren insgesamt derart prägend
und abschreckend, dass keiner der einstigen Wildunger Juden dauerhaft in
seine Heimatstadt zurückkehrte.


Max und Selma Hammerschlag
Ein dafür repräsentatives, in seinem Ausmaß schreckliches
Beispiel ist die Familie Hammerschlag, deren Grab sich in unmittelbarer Nähe
von Sally Hirsch befindet: Adolf Hammerschlag hatte ein Konfektionsgeschäft
in der Brunnenstraße 12 (heute Nr. 20) eröffnet, das seine Söhne Hermann und
Max übernahmen. Die Frau von Max namens Selma war eine Rot-Kreuz-Schwester.
Sie überlebte später das KZ Theresienstadt nur durch Zufälle und weil sie
sich als Krankenschwester "nützlich" erweisen konnte. Durch Flecktyphus
geschwächt, kehrte sie zwar nach Bad Wildungen zurück (Abb. 16). Als sie
aber dort erfuhr, dass ihr Mann in Buchenwald (wenige Tage vor der
Befreiung) und Sohn Edgar in Auschwitz ermordet wurde, brach für sie eine
Welt zusammen, Selma fragte sich, wie sie noch froh werden könne, wenn ihr
Liebstes (die eigene Familie) ihr für immer entrissen worden sei. Ein
bemerkenswerter Brief (erhältlich auch im Kur- und Altstadt-Museum) zeugt
von dieser, für Selma überaus schweren Zeit. Sie emigrierte 1947 in die USA
und verstarb 1963 in New York. Eine Gedenktafel auf dem Hammerschlag-Grab
erinnert an die verstorbenen "Märtyrer"- sie enthält eine Liste mit
folgenden Namen:
• Adolf Hammerschlag (1943 im KZ Theresienstadt
gestorben),
• Max Hammerschlag (1945 im KZ Buchenwald verstorben),
• Edgar Hammerschlag (wahrscheinlich im KZ Auschwitz verstorben, gilt als
verschollen),
• Hermann Hammerschlag (gilt als verschollen, Deportationsziel: Auschwitz),
• Irene Hammerschlag, geb. Vöhl (gilt als verschollen, Deportationsziel: KZ
Auschwitz),
• Inge Hammerschlag (gilt als verschollen. Deportationsziel: KZ Auschwitz),
• Käthe Wolf, geb. Hammerschlag (verschollen. Deportationsziel: KZ
Auschwitz),
• Meier Wolf (umgekommen im KZ Theresienstadt)
• Hans Wolf (verschollen. Deportationsziel: KZ Riga),
• Anita Wolf (verschollen. Deportationsziel: KZ Auschwitz; die Familie Wolf
stammte übrigens aus Marburg; Käthe Wolf war die Schwester
von Selma).
Der Schmerz in Selma lässt sich anhand der abschließenden
Inschrift nur erahnen: "In Liebe gewidmet von der einzig Überlebenden Selma
Hammerschlag, geb. Katz".
Solche Gedenktafeln gibt es mehrere auf dem Friedhof, sie
stammen also aus der Zeit nach 1945; beispielsweise auf dem Grab von Leopold
Külsheimer, der in der Brunnenstraße 36 (heute Nr. 61) ein Textilgeschäft
betrieb. Die Gedenktafel für seine Schwester Helene besagt: "gest. im Januar
1943 im KZ Theresienstadt". Ein weiteres Beispiel ist Isaak Samuel,
"umgekommen im KZ Riga als Opfer des Faschismus".
Sowohl für den Holocaust als auch für die Möglichkeit der
Emigration steht die Familie Baruch, die das zweite der bereits erwähnten
koscheren Hotels der Stadt führte. Dieses "Palasthotel" in der Brunnenallee
29 wurde von Joseph Baruch gegründet und von Berthold und Paula Baruch
übernommen. Ihr Grab befindet sich links des Eingangs, in der 3. Reihe. Die
Baruchs waren eine eher untypische jüdische Familie für Wildunger
Verhältnisse.
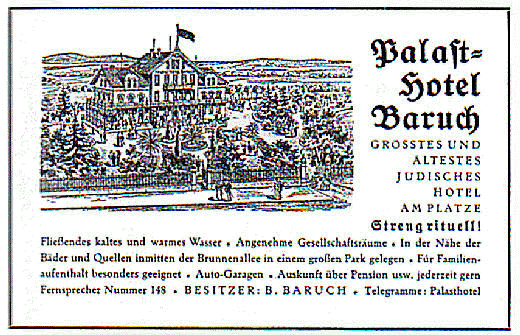
Anzeige im "Wegweiser für den Kurgast", 1926
Schon die Wohngegend, nämlich das Kurgebiet, unterschied
sie von den meisten ihrer Glaubensgenossen, die in der Altstadt wohnten. Der
Sohn von Berthold und Paula, Werner Baruch, nahm nach dem Abitur ein
Medizin-Studium in Würzburg auf. 1938 wurde er, 27-jährig, nach der
Pogromnacht für dreieinhalb Wochen in das KZ Buchenwald verschleppt. Danach
war für ihn klar, dass seine Zukunft außerhalb Deutschlands lag. Er
bereitete sich auf die
Ausreise vor, emigrierte 1939 nach Palästina und überlebte so den Zweiten
Weltkrieg. Er arbeitete zunächst in einem Kibbuz, war später Kellner und
betrieb schließlich ein eigenes kleines Cafe. Werner Baruch verstarb 1996 in
Haifa und hinterlässt zwei Kinder. Übrigens wurde aus dem Palasthotel 1948
vorübergehend ein Kurheim für ehemalige KZ-Häftlinge; heute befindet sich
dort die Verwaltung der Wicker-Kliniken. Die Eltern Werner Baruchs starben
1942 "als Märtyrer im KZ Riga" (so die Grabmalinschrift).
Stadtrundgang:
Juden und NS-Zeit in Bad
Wildungen
hagalil.com / 13-02-2005 |