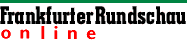
Zur gegenwärtige Zockerei um
Entschädigungszahlungen:
Gerechtigkeit - konkret
Listen
Von Matthias Arning / Frankfurter
Rundschau / 16.11.1999
Wer von Geld spricht, muss
nicht gleich auch mit Moral ankommen. Jenseits des Reichs des Guten wie des
Bösen geht es momentan allein um materielle Gerechtigkeit. Nur auf diesem
Terrain lässt sich jetzt noch über Entschädigungszahlungen an ehemalige
Zwangsarbeiter der deutschen Industrie reden.
Wer allein von moralischer
Verpflichtung spricht, stellt damit implizit die Forderungen nach
materieller Gerechtigkeit in Frage. Die Stiftungsinitiative der deutschen
Wirtschaft, gegründet vor neun Monaten von 16 potenten Konzernen,
akzentuiert immer wieder ihre moralische Verpflichtung, wenn Opfer des
nationalsozialistischen Programms "Vernichtung durch Arbeit" nicht
Wiedergutmachung, sondern Entschädigung verlangen - sie wollen mehr als fünf
Jahrzehnte nach dem Ende des Kriegs schlicht ihnen vorenthaltenen Lohn
bekommen. Mit Moral hat das jetzt primär wenig zu tun.
Die Redewendung von der moralischen
Verpflichtung zeigt jedoch immerhin an, dass Teile der Industrie das Thema
Zwangsarbeit inzwischen vor dem Hintergrund der Sammelklagen von NS-Opfern
in den USA und dem damit drohenden Imageschaden überhaupt als Thema
akzeptieren. Bis dahin sorgte das, was die Nürnberger Richter gleich nach
Kriegsende als systematisches "Sklavenarbeitsprogramm" angeprangert hatten,
zunächst einmal für Angst: Unmittelbar nach 1945 sorgten sich viele Deutsche
vor möglichen Racheakten derer, die in der benachbarten Fabrik etwa
Patronenhülsen für die deutsche Wehrmacht gestopft, auf dem Dorf bei
Erntearbeiten geholfen oder nach Luftangriffen in deutschen Städten Trümmer
weggeräumt hatten. Später trat an die Stelle der Angst die Ignoranz. Das
klang dann von Seiten der Industrie etwa so: Die SS drängte den Firmen für
die in den Krieg ziehenden Männer kurzerhand Zwangsarbeiter auf. Ein
Verweis, der den Managern spätestens mit Erscheinen einer Studie des
Historikers Hans Mommsen über Zwangsarbeit bei Volkswagen unmöglich geworden
ist: Mommsen belegte, dass Firmenchef Ferdinand Porsche selbst in Auschwitz
Arbeitskräfte hatte aussuchen lassen. Es gab in der deutschen
Kriegsproduktion keine Firmen, kaum Bauernhöfe und wohl nur wenige Kommunen,
die nicht bereitwillig Sklavenarbeiter nahmen, um ihren Betrieb
aufrechtzuerhalten.
Zwangsarbeiter ist nicht gleich
Zwangsarbeiter. Und entgegen landläufiger Vorstellung war nicht jeder
Zwangsarbeiter Häftling in einem Konzentrationslager. Zu den Zwangsarbeitern
gehören ebenso KZ-Häftlinge wie russische Kriegsgefangene, aus Polen auf
Landgüter Verschleppte und in so genannten Arbeits- und Erziehungslagern der
SS Inhaftierte. Insgesamt etwa zehn Millionen Menschen. Zehn bis 15 Prozent
von ihnen, kalkulieren Experten, leben heute noch. Und sie fordern für ihre
Arbeit Entschädigung. Auch im Namen der Toten, der vielen, die etwa den Bau
des Westwalls im Dienste deutscher Baufirmen nicht überlebt hatten. Warum
also sollte in einen Entschädigungsfonds nur für die Opfer eingezahlt
werden, die den Terror überstanden?
Der Lohn der Toten sollte
ursprünglich in einen Zukunftsfonds einfließen. Mit dessen Mitteln hätten
der Versöhnung gewidmete Projekte in Osteuropa möglich und brachliegende
Felder der Forschung urbar gemacht werden sollen. Dass davon inzwischen
keiner mehr spricht, zeigt die allmähliche Desillusionierung, die die
Verhandlungen mit der Industrie auf Seiten der Opfer begleitet. Sie
schraubten ihre Erwartungen in Relation zur Unnachgiebigkeit der Konzerne
runter.
Die Stiftungsinitiative beharrt bis
zur nächsten Verhandlungsrunde am heutigen Dienstag auf ihrem Angebot - vier
Milliarden Mark. Und keinen Pfennig mehr. Ihr Sprecher wird nicht müde, das
zu unterstreichen und mit dem Hinweis zu versehen, nicht einmal diesen
Betrag hätten die Konzerne zusammen. Die Summe verdeckt jedoch die wahren
Proportionen: In diesen Betrag rechnet die Initiative die Entschädigung für
so genannte Arisierungsgeschäfte mit ein, um am Ende dieses Jahrhunderts ein
für allemal einen Schlussstrich ziehen zu können.
Bis heute ist das Ausmaß der von den
Großbanken wie etwa auch von kleinen Schustern betriebenen "Arisierung"
nicht beziffert. Dagegen gibt es für Entschädigungszahlungen an frühere
Zwangsarbeiter inzwischen Anhaltspunkte, die zwei Konzerne selbst im Laufe
dieses Jahres geschaffen haben: Volkswagen und Siemens zahlen pauschal 10
000 Mark. Hochgerechnet auf eine Million Überlebende unter den
Zwangsarbeitern hätte die Industrie - die bislang zahlungsunwilligen
mittelständischen Unternehmen inklusive - mit der Bundesregierung zehn
Milliarden Mark aufzubringen, um die ihnen lästige Sache vom Tisch zu
bringen.
Am Ende muss doch von der Moral die
Rede sein. Abseits von Sammelklagen und Imageschäden hinterlässt die
gegenwärtige Zockerei bei vielen Bürgern dieser Republik ein Gefühl, das mit
Limousinen von Daimler-Chrysler und Sparkonten der Dresdner Bank gar nichts
zu tun hat. Es ist nichts anderes als Scham - den Opfern gegenüber. Denn die
brauchen schleunigst materielle Gerechtigkeit.
Deutsche
Unternehmen wollen sich aus ihrer Verantwortung für Zwangsarbeiter stehlen
Lothar Evers über den Entschädigungsstreit