 50
Jahre nach der Staatsgründung: 50
Jahre nach der Staatsgründung:
Kämpfer, Kibbuznik und KollektivHistadrut, Hagana und Kibbuz, die Grundpfeiler für die Gründung Israels,
sind morsch geworden
Von Gerold Büchner
Schon des Alters wegen ist er ein Vorfahr des modernen
Israel: Der Kibbuz Degania am Südzipfel des Sees Genezareth begeht in
diesem Jahr seinen 89. Geburtstag, während der Staat der Juden in diesen
Tagen den 50. Jahrestag seiner Gründung feiert. Nun würde zwar kaum ein
Kibbuznik behaupten, in der ältesten Kollektivsiedlung am See stehe die
Wiege der Nation; doch als sich 1909 fünf jüdische Landarbeiter
zusammentaten und auf den Äckern von Degania die ersten Furchen zogen,
bereiteten sie den Boden für das Wahrwerden einer Vision.
Ohne die
landwirtschaftlichen Pioniere und ihren Erfindungsreichtum wäre der
weite Weg vom Zionistischen Kongreß zu Basel 1897 bis zur
Unabhängigkeitserklärung 1948 kaum bewältigt worden. Die Kibbuzniks
gehören zum Gründungsmythos Israels wie die Gewerkschaft Histadrut und
die Verteidigungskräfte der Hagana. Der heutige Zustand dieser drei
Säulen der Staatsgründung zeigt aber auch, wie schnell Mythen
verblassen.
Die Vision hatten die Zionisten in Basel zu
Papier gebracht: die „Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten
Heimstätte in Palästina“ für das jüdische Volk. Wie aber sollte das
gehen – aus dem Nichts einen Staat gründen, ohne Nation und Territorium,
ohne bereits funktionierende Gemeinschaft im Land der Väter und der
Träume? Theodor Herzl suchte die Antwort in der großen Diplomatie. Am
liebsten wäre ihm ein Schutzbrief Kaiser Wilhelms II. für die
Kolonisierung gewesen. Aber Deutschland zeigte wie die anderen
Großmächte wenig Begeisterung für das zionistische Vorhaben. Zudem
geriet der Jischuw, die damals etwa 50 000 Menschen große jüdische
Gemeinde in Palästina, zunehmend in Bedrängnis. Die Siedlungen des
französischen Barons Rothschild waren kaum lebensfähig, auf den Feldern
arbeiteten immer mehr arabische Tagelöhner. Viele Juden wanderten ob der
Mißstände wieder aus oder in die Städte ab. „Noch ein wenig, und wir
sind verloren“, beschrieb der Lehrer Josef Witkin den Zustand des
Siedlungsprojekts zu Beginn des 20.Jahrhunderts.
„Ein verwegenes Unternehmen“
Im Todesjahr Herzls aber begann 1904 mit der zweiten
Alija (Einwanderungswelle) die Wende. Vor neuen Pogromen in Osteuropa
flohen Zehntausende Juden ins Gelobte Land. Die Neuankömmlinge, unter
ihnen der 19jährige
David Grien aus dem polnischen Plonsk, brachten außer
Aufbruchstimmung und meist sozialistischer Gesinnung nicht viel mit,
aber sie waren voller Tatendrang. Bis zum Ersten Weltkrieg verdoppelten
sie die Zahl der Siedlungen auf 40. Vor allem aber entstanden in diesen
Jahren aus Frust über hemmende Hierarchien und aus der Not die ersten
landwirtschaftlichen Kollektive. Wichtigster Grundsatz der Kibbuzim war
die „jüdische Arbeit“, was eine Beschäftigung billiger arabischer
Lohnkräfte ausschloß. Allein die jüdischen Pioniere sollten den Boden
beackern und von der Milchkanne bis zur Kindererziehung alles teilen, um
so die „neue Gesellschaft“ zu schaffen.

Die Kibbuzim, ein „verwegenes Unternehmen des jüdischen
Volkes“ (Martin Buber), legten den Grundstein für die Gemeinwirtschaft
in Israel. Als David Grien, der seinen Nachnamen inzwischen zu Ben
Gurion hebräisiert hatte, 1948 den Staat ausrief, lebte jeder zwölfte
jüdische Bürger in einem Kibbuz. Weit größer noch war die
Wirtschaftsleistung der Kollektive, die bis heute ein Drittel zur
landwirtschaftlichen Produktion beitragen. Allerdings leben in den 270
Kibbuzim nicht einmal mehr drei Prozent der israelischen Bevölkerung.
Mit der Zeit sind die hehren Grundsätze geschwunden: Heute werden
Lohnarbeiter angestellt, immer mehr Kibbuznikim verdienen ihr Geld
außerhalb der Siedlung. Das Verbot privaten Besitzes ist aufgehoben, in
den Speisesälen vieler Kibbuzim müssen die Mitglieder für ihr Essen
bezahlen. Aus dem sozialen Experiment ist eine fast normale Lebensform
geworden.
Histadruth
Ähnliches widerfuhr den Gewerkschaftern. Wie die
landwirtschaftlichen Kollektive stand auch die Histadrut bis zur
Staatsgründung und noch lange danach für die Verbindung von
Gemeinwirtschaft und Exklusivität: Offen für alle Juden und egalitär
nach innen, verschlossen für die Araber. Die 1920 gegründete Histadrut
übertrug das Prinzip „jüdischer Arbeit“ vom Feld auf die Fabrik. Die
Gewerkschaft baute unter dem britischen Mandat eigene Betriebe und
Kooperativen auf, gründete Schulen, eine Krankenversicherung, eine Bank
und sorgte für Bildung wie Ausbildung ihrer Mitglieder. Erster Chef der
Histadrut war Ben Gurion, der auch hier sein organisatorisches Talent
bewies: Bereits 1930 gehörten dem Verband, der schon damals weit mehr
als eine Gewerkschaft war, drei Viertel aller jüdischen Arbeiter in
Palästina an. Nicht zuletzt unterstand der Histadrut die kurz nach ihr
gegründete Hagana, der bewaffnete Selbstschutz der Siedler gegen
arabische Überfälle.

1948 wurde aus dem „Staat vor dem Staat ein Staat im
Staat“, wie es ein heutiger Histadrut-Funktionär beschreibt. Noch vor
wenigen Jahren war die Mehrzahl der Israelis organisiert, die
Rundum-Versorgung der Gewerkschaft reichte von Kulturveranstaltungen bis
zur Krankenbetreuung und Rentenzahlung. Der palästinensischen Minderheit
in Israel hingegen verwehrte die Histadrut bis in die sechziger Jahre
die Aufnahme; wenn schon die Arbeit nicht mehr allein „jüdisch“ war,
sollte zumindest die soziale Sicherheit Vorrecht der Juden bleiben. Der
Niedergang der Gewerkschaftsbewegung begann 1977, als nach 30 Jahren
sozialdemokratischer Herrschaft der rechte Likud an die Regierung kam.
Menachem Begin, zu Ben Gurions Lebzeiten dessen Erzrivale, kürzte die
Subventionen für gemeinwirtschaftliche Betriebe. Die um Krankenkasse und
Eigenbetriebe abgespeckte Histadrut hat heute nur noch einige
hunderttausend Mitglieder und ist eine „normale“ Gewerkschaft.
„Armee als Schule der Nation“
Dritter Grundpfeiler beim Aufbau des Staates war die
bewaffnete Verteidigungsorganisation, die Ben Gurion zwei Wochen nach
der Unabhängigkeit zur regulären Armee umwandelte. Nach gewaltsamen
Auseinandersetzungen zwischen Siedlern und Arabern war die Haganah 1921
von den Arbeitsparteien unter Federführung der Histadrut ins Leben
gerufen worden. Sie blieb trotz Abspaltungen radikaler Gruppen, die
Vergeltung für arabische Anschläge und offensiven Kampf gegen die
Mandatsmacht Großbritannien forderten, stärkste militärische Kraft der
Zionisten. Dazu trug auch ihre Verflechtung mit Histadrut und den
Kibbuzim bei: Pioniere gründeten Wehrsiedlungen, Kibbuzniks gehörten zu
den besten Kämpfern der Hagana.
Mit Hilfe der gewerkschaftlichen, militärischen und
kollektiv-bäuerlichen Organisation prägten die Linkszionisten unter Ben
Gurion das Aufbauwerk im Palästina der Mandatszeit und retteten ihre
Vorherrschaft in den jungen Staat. 50 Jahre Unabhängigkeit und fünf
Kriege gingen auch an den Streitkräften nicht spurlos vorüber. Sie waren
einst „Schule der Nation“, das größte Integrationsprojekt für Millionen
Neueinwanderer. Ausgerechnet der triumphale Sieg im Sechs-Tage-Krieg
1967 war Keim für inneren Zwist. Während in der einst von der Linken
beherrschten Armee die Zahl religiöser Soldaten wächst, wollen immer
mehr säkulare Jugendliche den Militärdienst umgehen. In der Bevölkerung
mehren sich außerdem Zweifel, welchen Sinn etwa die andauernde Besetzung
des Südlibanon oder der 1967 eroberten Palästinensergebiete haben soll.
Wieweit die Krise, in der die vorstaatlichen
Institutionen 50 Jahre nach der Staatsgründung stecken, eine
Normalisierung der Gesellschaft widerspiegelt, ist umstritten. Der
Historiker Benny Morris spricht von einer „generellen Bewegung des
Landes weg von der Ideologie“. Wichtig sei heute, „was gut ist für den
einzelnen, nicht für das Kollektiv“. Der Soziologe S. N. Eisenstadt
indes warnt davor, nach dem „Zerfall des Gesellschaftsmodells der
Arbeiterbewegung“ allzuviel Hoffung in die Entwicklung einer „normalen“
Nation zu setzen.
Unstrittig ist, daß sich Israels Gesellschaft von vielen
Anfangsgrundsätzen verabschiedet hat: Aus der Egalität wurde
Individualismus, aus gewerkschaftlicher Allmacht eine weitgehend freie
Marktwirtschaft, aus militärischer Geschlossenheit eine Debatte über
Verteidigungspolitik. Einer 50jährigen aber wird man wohl zubilligen,
daß sie das Erbe der Vorfahren auf Brauchbarkeit prüft.
SZ vom 02.05.1998
Visionen und Wirklichkeit:
Kibuz und
Moschaw
Der "Ansturm" der jüdischen Gemeinschaft in Eretz
Israel auf die Wildnis und die rasend schnelle Entwicklung der
israelischen Landwirtschaft fand zu einer Zeit statt, die voller
aufregender sozialer Experimente steckte, und die auch auf andere
Ebenen des israelischen Erlebnisses wirkte...
Visionen und Wirklichkeit:
Das
Ödland zum Blühen bringen
1867 reiste die erste Touristengruppe unter Leitung
von Thomas Cook ins Heilige Land. Zu der Gruppe gehörte der berühmte
amerikanische Schriftsteller Mark Twain, der durch das Land reiste
und über seine Erfahrungen in dem Buch "Reise ins Gelobte Land"
berichtete. Seine Beschreibung ist die eines Landes, das völlig
brach liegt...

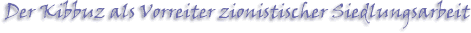
|