|
Ausgewählte Schriften:
Gustav Landauer
Die "Ausgewählten Schriften" Gustav Landauers (1870-1919)
behandeln seinen Internationalismus, seine Konzeption eines kommunitären
Anarchismus, seinen Antimilitarismus, sein Engagement in der Revolution
1918/19, seine Philosophie, sein Judentum und sein literarischen Schaffen.
Gustav Landauer war eng mit dem Sozialphilosophen Martin Buber und dem
Dichter Erich Mühsam befreundet.
Erstmals wird das Werk des libertären Kulturphilosophen und Initiators
bedeutender libertärer Projekte wie "Der Sozialist" und der "Sozialistische
Bund" in zahlreichen Bänden umfassend vorgestellt.
Eine jedem Band beigefügte biographisch-chronologische Zeittafel, ein
Überblick über Landauers Schrifttum sowie ausgewählte Sekundärliteratur
ermöglichen den ersten raschen Einstieg.
Band 1: Internationalismus. Hrsg., kommentiert, mit einer
Gesamteinleitung, einer Einleitung zu Band 1 und einem Personenregister
versehen von Siegbert Wolf. Lich/Hessen 2008:
Verlag Edition AV.
[Bestellen?]
Band 2: Anarchismus. Hrsg., kommentiert, mit einer
Einleitung und einem Personenregister versehen von Siegbert Wolf. Lich/Hessen
2009: Verlag Edition AV.
[Bestellen?]
Band 3: Antipolitik. Hrsg., kommentiert, mit einer Einleitung und einem
Namenregister versehen von Siegbert Wolf. Lich/Hessen 2010: Verlag Edition AV.
[Bestellen?]
Band 4: Nation, Krieg und Revolution.
Hrsg., kommentiert, mit einer Einleitung und einem Namenregister versehen
von Siegbert Wolf. Lich/Hessen 2011:
Verlag Edition AV. [Bestellen?]
Band 5: Philosophie und Judentum. Hrsg.,
kommentiert, mit einer Einleitung sowie einem Register versehen von Siegbert
Wolf.
Lich/Hessen 2012: Verlag Edition AV.
[Bestellen?]
Band 6.1 und 6.2: Literatur. Hrsg.,
kommentiert, mit einer Einleitung sowie einem Register versehen von Siegbert
Wolf. Lich/Hessen 2013: Verlag Edition AV.
[Bestellen?
- Band 6.1]
[Bestellen?
- Band 6.2]
Band 7: Skepsis und Mystik. Versuche im
Anschluss an Mauthners Sprachkritik. Textkritische Ausgabe. Hrsg.,
kommentiert, mit einer Einleitung sowie einem Register versehen von Siegbert
Wolf. Lich/Hessen 2011. [Bestellen?]
Band 8: Wortartist. Roman, Novelle, Drama,
Gedicht, Satire, Märchen, Übersetzung. Herausgegeben, mit einer Einleitung,
Kommentierungen und einem Namenregister versehen von Dr. Siegbert Wolf.
Illustrationen von Uwe Rausch. Lich/Hessen 2014. [Bestellen?]
Band 9: Birgit Seemann, „Mit den Besiegten“
Hedwig Lachmann (1865-1918) - Deutsch-jüdische Schriftstellerin und
Antimilitaristin. Überarbeitete u. aktualisierte Neuauflage. Lich/Hessen
2012. [Bestellen?]
"An Stelle des heutigen Staates und an Stelle des Weltstaates und der
Weltherrschaft wollen wir Anarchisten ein freies Gefüge der mannigfachsten,
einander durchdringenden, in tausend Farben spielenden
Interessenvereinigungen und Gruppen setzen. Die Anarchie ist kein fertiges
und totes Gedankensystem: die Anarchie ist das Leben der Menschen, die dem
Joche entronnen sind." (Gustav Landauer, 1895)
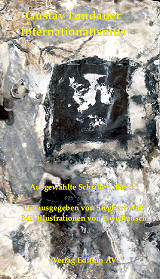 Band 1:
Internationalismus Band 1:
Internationalismus
[Bestellen?]
Gustav Landauers kommunitärer Anarchismus ist ein Aufruf an die gesamte
Menschheit und richtet sich daher nie ausschließlich an eine einzige Klassse,
Ethnie oder ideologische bzw. religiöse Glaubensrichtung. Neben seinen
ausformulierten Ansätzen einer grundlegenden Transformation der
Gesellschaft, in deren Mittelpunkt der Aufbau völlig neuer sozialer
Arrrangements im Verhältnis der Menschen untereinander und zur tierischen
und pflanzlichen Natur steht, hat seine globale Perspektive eine nachhaltige
Bedeutung für das Verständnis von Landauers Anarchismus.
Gustav Landauer war umfassend über soziale, vor allem anarchistische
Bewegungen weltweit informiert, von Russland, Italien, England und
Frankreich über Asien (Japan) bis nach Nord- und Lateinamerika (USA,
Mexico). Seine zahlreichen informativen, bis heute lesbaren Artikel –
Abhandlungen, Rezensionen, Protestschreiben, Vor- und Nachbemerkungen,
Übersetzungen, Gedenkaufsätze – belegen Landauers detaillierte Kenntnisse
über Entwicklungen, Organisationsstruktur und Publikationen innerhalb der
internationalen anarchistischen Bewegung, die ihn in die Lage versetzten,
jederzeit publizistisch zu intervenieren. Die Lektüre der in diesem Band
versammelten Artikel ermöglicht einen umfassenden Einblick in diese
Thematik. Eine biographisch-chronologische Zeittafel, ein Überblick über Landauers
Schrifttum sowie ausgewählte Sekundärliteratur ermöglichen einen ersten
raschen Einstieg. Eine Bibliographie mit den Primärquellen, den
Publikationen Landauers (Erstauflagen), seinen Übersetzungen (Buchausgaben)
und seiner Herausgebertätigkeit sind angefügt.
 Band 2: Anarchismus Band 2: Anarchismus
[Bestellen?]
"Die Aufgabe, die der Anarchismus vor allem unter den
deutschen Micheln zu erfüllen hat, ist in erster Linie: Individualitäten zu
erwecken, sie zum Bewusstsein ihrer selbst zu bringen, trotzige
Individualität des Geistes, des Charakters, des Temperamentes."
Seit den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts bemühte sich
Gustav Landauer (1870-1919) beharrlich, anarchistisches Gedankengut im
deutschsprachigen Raum bekannt zu machen. Anarchie bedeutete ihm nicht nur
keine Herrschaft von Menschen über den Menschen, sondern auch keine
Herrschaft äußerer Ziele, Zwecke und Sinngebungen über das Leben der
Menschen. Ausgehend von einem grundlegenden
Unbehagen an der sinnentleerten und nivellierenden Moderne, begriff
Landauer, dass Veränderungen allein im politischen und ökonomischen Bereich
ebensowenig ausreichen wie eine Revolution als einmaliger und
abgeschlossener Vorgang, um zu einer grundlegenden Regeneration der
Gesellschaft zu gelangen. Vielmehr bedürfe es einer tiefgreifenden
Revolutionierung der kulturellen, auch alltäglichen und privaten
Lebensbereiche und vor allem einer nachhaltigen Veränderung des Bewusstseins
der Menschen. Die Betonung auf das gesellschaftliche Miteinander aller
Kinder, Frauen und Männer und das Einüben völlig neuer sozialer Arrangements
sah er hierbei als entscheidend an. Konsequent forderte von den Menschen den
Austritt aus dem Staat, aus allen Zwangsgemeinschaften, den radikaler Bruch
mit den Überlieferungen des Privateigentums, der Besitzehe, der
Familienautorität, des Fachmenschentums sowie der nationalen Absonderung und
Überhebung. Die Betonung auf das Kulturrevolutionäre gehörte seitdem für
Landauer zum Grundstock seines föderativ-kommunitären Anarchismus.
Anarchie war für Landauer kein in die Zukunft verschobenes
Menschheitsprojekt, sondern jederzeit und über all dort möglich, wo Menschen
sich anders organisieren, sich anders zu einander verhalten, jenseits von
Staat, Kapitalismus und Großindustrialismus, und so nach den Prinzipien der
Gegenseitigkeit, Solidarität, Kooperation, Selbstbestimmung, freien
Assoziation und Föderation Herrschaft und Hierarchie für immer beseitigen.
"An Stelle des heutigen Staates und an Stelle des Weltstaates und der
Weltherrschaft [...] wollen wir Anarchisten ein freies Gefüge der
mannigfachsten, einander durchdringenden, in tausend Farben spielenden
Interessenvereinigungen und Gruppen setzen [...] Die Anarchie ist kein
fertiges und totes Gedankensystem: Die Anarchie ist das Leben der
Menschen, die dem Joche entronnen sind."
 Band 3: Antipolitik Band 3: Antipolitik
[Bestellen?]
"Wir finden, dass der Sozialismus keinen
schlimmeren Feind hat, als jegliche politische Macht; dass der Sozialismus
gerade die Aufgabe hat, eine soziale und öffentliche Ordnung herzustellen,
die alle politische Macht ablöst." Was verstand Gustav Landauer unter
Politik bzw. politischem Engagement? Politik bedeutete für ihn, gemäß dem
neuzeitlichen Verständnis, primär staatsbezogenes Handeln. Den Staat
beschrieb er sowohl als ein künstliches, autoritäres Gefüge, das einseitig
die Interessen der (Groß-)Wirtschaft und der Wohlhabenden vertritt, als auch
als "ein Verhältnis, [...] eine Beziehung zwischen den Menschen, [...] eine
Art, wie die Menschen sich zueinander verhalten; und man zerstört ihn, indem
man andere Beziehungen eingeht, indem man sich anders zueinander verhält.
Der absolute Monarch konnte sagen: ich bin der Staat: Wir, die wir im
absoluten Staat uns selbst gefangen gesetzt haben, wir müssen die Wahrheit
erkennen: Wir sind der Staat - und sind es so lange, als wir nichts anderes
sind, als wir die Institutionen nicht geschaffen haben, die eine wirkliche
Gemeinschaft und Gesellschaft der Menschen sind."
Gustav Landauer wollte den Menschen Auswege
aus der Anonymität und Isolation ihrer Lebensverhältnisse jenseits von
Individualismus und Kollektivismus im Verständnis von sozialer
Individualität in Gemeinschaft eröffnen. Hierbei war er nicht gewillt, bei
einer von ihm immer wieder eingeforderten Gesellschaftskritik stehen zu
bleiben. Vielmehr forderte er, aus dem Fundus anarchistischer Theorien
schöpfend, dazu auf, systemoppositionelle Haltung zu verbinden mit
konstruktivem, individuell und sozial verantwortlichem Handeln, um so die
libertäre Lebenswelt zu verwirklichen. Im Zentrum seines Denkens und
Handelns stand die Überzeugung, dass sich die Menschen in ihrem
gesellschaftlichen Engagement wiedererkennen müssen. Das Erstrebte, nämlich
die restrukturierte Gesellschaft, müsse bereits auf dem Weg dorthin deutlich
identifizierbar sein.
Die im vorliegenden Band 3 der "Ausgewählten
Schriften" Gustav Landauers abgedruckten Texte legen den Schwerpunkt auf
Geschichte und Programmatik des "Sozialistischen Bundes" (1908-1915). Sie
versammeln Landauers bedeutende, bis heute aktuelle Aufzeichnungen unter der
Überschrift "Wege in die Gemeinschaft" hin zu einer kommunitären,
föderalistischen Restrukturierung der Gesellschaft.
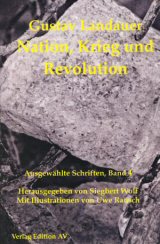 Band
4: Nation, Krieg und Revolution Band
4: Nation, Krieg und Revolution
[Bestellen?]
Gustav Landauers Verständnis von Nation
entwickelte sich in Abgrenzung zu Nationalstaatlichkeit, Nationalismus und
Ethnizität. Homogenität und Gleichmacherei im Rahmen bestehender
Nationalstaaten stellte er seine libertäre Konzeption von gegenseitiger
Hilfe, Gleichberechtigung und solidarischer Nachbarschaft entgegen. Staat,
der für ihn nicht anderes vorstellte als Zwangsstruktur, und Nation blieben
für ihn unverwechselbare Gegensätze, auf deren definitive Trennung er
abzielte. Sein föderalistisches Verständnis einer nichtnationalistischen
Nation sollte den abstammungszentrierten deutschen Ethnizismus ebenso
ablösen wie das Konzept des westlichen Nationalstaates.
Frühzeitig warnte Landauer vor dem
heraufziehenden Weltkrieg. Sein konsequenter Antimilitarismus und seine
unerschütterliche Kriegsgegnerschaft zielten auf die dauerhafte Abschaffung
aller Armeen sowie im Kriegsfall auf Boykott, Gehorsamsverweigerung,
Desertation und Massenstreik bis hin zum Generalstreik.
Die Novemberrevolution 1918 bot Gustav
Landauer von München aus die Chance, seinen freiheitlichen Sozialismus in
einem föderalistischen und dezentralistischen Rätesystem zu verwirklichen -
ein Bund autonomer, föderalistischer Republiken, basierend auf dezentralen
Rätestrukturen. Im Rahmen der ersten bayerischen Räterepublik Anfang April
1919 übernahm Landauer das Amt eines Kultusministers und konnte hierbei auf
ein detailliertes Konzept einer libertären Restrukturierung der Gesellschaft
zurückgreifen. Schwerpunkte von Landauers Tätigkeit in der kurzlebigen
Räterepublik betrafen das Schul- und Hochschulwesen sowie das Theater. Sein
Engagement während der deutschen Revolution 1918/19 musste er mit seiner
brutalen Ermordung seitens gegenrevolutionärer Soldaten Anfang Mai 1919
bezahlen.
Band 5: Philosophie und Judentum
[Bestellen?]
Philosophisches Denken betrieb Landauer nie
als Selbstzweck. Vielmehr zielte er stets auf das Leben der Menschen, auf
deren gesellschaftliche Praxis, mit dem Ziel einer globalen Menschwerdung
auf der Grundlage von Freiheit, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit.
Philosophische Gesprächspartner fand er hierbei vor allem in Fritz Mauthner,
Martin Buber, Constantin Brunner und Ludwig Berndl. Besonders in der
Sprachkritik erkannte er ein Mittel zur Kritik der instrumentellen Vernunft
und zur Auflösung herrschaftsorientierter Ideologien. Deutlich wird
Landauers tiefes Verständnis von Philosophie als einem Erkenntnisinstrument,
nicht, um die Welt zu interpretieren, sondern um sie zu verändern: „Unsere
Aufgabe ist […] anzuerkennen, durch die Tat und den stillen Umgang im
Kleinen und Täglichen, dass die Menschen und alles, was Leben hat, uns nicht
als Gegenstände für unseren Genuss gegeben ist, sondern als solche, die in
allem Wesentlichen gerade so beseelt sind wie wir.“
Hinzu trat Landauers bewusstes Bekenntnis zum Judentum, das einherging mit
einer Wiederentdeckung der jüdischen Tradition, der mystischen und
häretischen Quellen des Judentums (Messianismus, Kabbala, Chassidismus). Es
entsprang vor allem kulturellen Impulsen eines engen Zusammenhanges zwischen
Judentum und Menschheitsidee. Im Prozess eines neuen, sozialen Umgangs der
Menschen untereinander, maß er dem lebendigen Judentum mit seinen
Nächstenliebe- und Gerechtigkeitsmotiven, den das Gemeinschaftsleben
verkörpernden Traditionen sowie dessen kultureller Vielfalt, eine bedeutende
Vorreiterrolle bei der Regeneration der gesamten Menschheit zu.
Band 6.1 und 6.2: Literatur
[Bestellen?
- Band 6.1]
[Bestellen?
- Band 6.2]
Im Rahmen von Gustav Landauers libertärem
Entwurf einer grundlegenden Umgestaltung gesellschaftlichen Lebens der
Menschen im Verhältnis untereinander und zur Natur gebührt der Literatur und
dem Theater eine zentrale Funktion. Dies vor allem deshalb, weil Landauer
eine ausschließlich politische oder ökonomische Umwälzung der bestehenden
Herrschaftsstrukturen mitnichten für ausreichend hielt, um tatsächlich zu
einer dauerhaften Menschwerdung zu gelangen. Daraus erklärt sich auch seine
grundlegende Skepsis gegen die so genannte Objektivität und den
Alleinvertretungsanspruch der Wissenschaft, die sich in seiner Sprach- und
Erkenntniskritik abbildet.
Dichtung, bildende Kunst, Theater und Musik erachtete er nicht „als eine
Privatsache, als eine Sache bloß des stillen Kämmerleins, des Hauses, der
Familie“. Auch gehe es nicht darum, „isolierten Privatpersonen angenehme
Gefühle des Schönen zu vermitteln. Die Kunst als eine der stärksten
Ausdrucksformen des Lebens greift selbst wieder aufs Leben in seiner
privaten und öffentlichen Sphäre zurück, um es zu wandeln, zu erhöhen, zu
befreien und zu reinigen.“
Gustav Landauer war ein detaillierter Kenner
der deutsch-sprachigen und internationalen Literatur. Zugleich verstand er
sich immer auch als Literaturvermittler und Entdecker zeitgenössischer
Autoren und Autorinnen. Seine zahlreichen, noch heute lesenswerten Essays,
Zeitungs- und Zeitschriftenartikel, Vorträge, Buch- und Theaterbesprechungen
belegen dies deutlich. Landauer erkannte rasch, welche gesellschaftliche
Sprengkraft etwa der Vermittlung von Dramen - Tragödien und Komödien - vor
allem des englischen Schriftstellers William Shakespeare in Schrift und
Vortrag sowie auf der Theaterbühne innewohnt.
Viele Autoren - Honoré de Balzac, Rabindranath Tagore, Leo N. Tolstoi, Walt
Whitman, Oscar Wilde - hat er, häufig gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin,
der Lyrikerin Hedwig Lachmann, durch erstmalige Übersetzungen und umfassende
Betrachtungen dem deutschsprachigen Kulturleben zur Verfügung gestellt.
Band 7: Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluss an
Mauthners Sprachkritik
[Bestellen?]
„Skepsis und Mystik. Versuche im Anschluss an
Mauthners Sprachkritik“ (1903) zählt zu Gustav Landauers philosophischen
Hauptwerken. Gebührt dieser sprach- und vernunftkritischen Monographie der
Rang einer grundlegenden Sprachphilosophie des Anarchismus, so gilt dies für
seine 1907 erschienene Studie „Die Revolution“ gleichermaßen hinsichtlich
einer fundierten libertären Geschichtsphilosophie.
Vorliegende textkritische Ausgabe basiert auf der Erstauflage von 1903,
ergänzt um die von Martin Buber aus Landauers handschriftlichen
Aufzeichnungen erweiterten, 1923 herausgegebenen, zweiten Auflage. Der
Herausgeber der „Ausgewählten Schriften“ Gustav Landauers hat zusätzlich
diejenigen Essays Gustav Landauers in einem Anhang beigefügt, die zum
Verständnis sowohl der Entstehungsgeschichte als auch der inhaltlichen
Komposition dieser bedeutenden Monographie unverzichtbar sind.
Band 8: , Wortartist - Roman, Novelle, Drama,
Gedicht, Satire, Märchen, Übersetzung
[Bestellen?]
Bereits als
Jugendlicher begann Gustav Landauer zu dichten (Lyrik, Dramen und Novellen).
1893 erschien sein einziger, bis heute lesenswerter Roman „Der
Todesprediger“ - Novellen „Ein Knabenleben“, „Arnold Himmelheber“, „Lebendig
tot“), Märchen („Der gelbe Stein“), Gedichte („Spanische Ballade“), Dramen
(„Nach Jahren“), Satiren und Übersetzungen (Walt Whitman, Rabindranath
Tagore) folgten. Als ein weithin anerkannter Experte der deutschsprachigen
und internationalen Literatur - hierzu die Bände 6.1 und 6.2: „Literatur“
der „Ausgewählten Schriften“ (2013) - stand auch seine eigene Kreativität
stets unter dem Vorzeichen einer grundlegenden Veränderung der Gesellschaft
hin zu mehr Freiheit, sozialer Individualität, Gerechtigkeit und Gleichheit
aller Menschen im Fokus seines Denkens, Schreibens und Handelns.
Zur Person des Herausgebers:
Dr. Siegbert Wolf, geb. 1954, Dr. phil., Historiker und Publizist in
Frankfurt am Main. Zahlreiche Bücher u.a. über Gustav Landauer, Martin Buber,
Hannah Arendt, Jean Améry sowie zur Frankfurter Stadtgeschichte: Hrsg.:
Jüdisches Städtebild Frankfurt am Main (1996); zuletzt: Gustav Landauer, Die
Revolution (1907). Hrsg. und mit einem Vorwort von Siegbert Wolf. Münster
2003 (= Klassiker der Sozialrevolte, Bd. 9); Werner Portmann/Siegbert Wolf ,
„Ja, ich kämpfte”. Von Revolutionsträumen, ‚Luftmenschen’ und Kindern des
Schtetls. Biographien radikaler Jüdinnen und Juden. Münster 2006; Milly
Witkop, Hertha Barwich, Aimée Köster u.a., Der ‚Syndikalistische
Frauenbund’. Hrsg., mit einer Einleitung von Siegbert Wolf. Münster 2007 (=
Klassiker der Sozialrevolte, Bd. 17); Maria Regina Jünemann, Die
Anarchistin. Roman. Neu herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort
versehen von Siegbert Wolf. Lich/Hessen 2008; Gustav Landauer, Ausgewählte
Schriften. Herausgegeben von Siegbert Wolf. Lich/Hessen 2008ff. Bisher
erschienen: Band 1: Internationalismus (2008); Band 2: Anarchismus (2009);
Band 3.1: Antipolitik (2010); Band 3.2: Antipolitik (2010).
>>
Gesamteinleitung
>> Leseprobe: Palästina
>>
Leseprobe: Die
vereinigten Republiken Deutschlands und ihre Verfassung |