|
Der Weg ins Exil:
Vor 70 Jahren emigrierte Sigmund Freud nach London
|
"Die Juden haben sich von
allen Seiten und aller Orten mit Begeisterung meiner Person bemächtigt als
ob ich ein gottesfürchtiger großer Rabbi wäre. Ich habe nichts dagegen
nachdem ich meine Stellung zum Glauben unzweideutig klargelegt habe, das
Judentum bedeutet mir noch sehr viel affektiv."
Sigmund Freud an Arthur Schnitzler,
24. Mai 1926
|
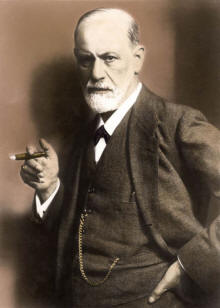
Foto: © Archiv S. Fischer Verlag
|
Von Roland Kaufhold und Hans-Jürgen Wirth
[ENGLISH]
Am 4.6.1938 schrieb der 82-jährige Sigmund Freud an seinen langjährigen
Briefpartner Arnold Zweig – welcher fünf Jahre zuvor nach Palästina
emigriert war – noch von Wien aus einen knappen Brief: "Leaving today for
39, Elsworthy Road, London N. W. 3.
Affect,
greetings Freud."
Der Schriftsteller Arnold Zweig, zutiefst mit Freuds Werk identifiziert,
antwortet ihm zwei Wochen später – die Post benötigte seinerzeit etwas
länger - voller Erleichterung: "Nun sind Sie in Sicherheit, weg von den
Opfern einer jahrzehntelangen Rachsucht. (...) Ihr Archiv, Ihre Bücher, die
Sammlungen sind gerettet."
Noch
am gleichen Tag – alle von den Nationalsozialisten geforderten Formalitäten
waren nun erfüllt - emigrierte Sigmund Freud mit einem Teil seiner Familie
über Frankreich nach London. Das Photo mit Anna und Sigmund Freud im
Bahnabteil ging durch die Weltpresse. 15 Monate später verstarb der schwer
krebskranke jüdische Begründer der Psychoanalyse 83-jährig im Londoner Exil.
Ein Anlass, sich an die Stationen seiner Emigration zu erinnern.
Vorgeschichte
Sigmund Freud wurde vor 152 Jahren, am 6. Mai 1856, in Mähren geboren. Er
besuchte in Wien die Schule und entwickelte in Wien, im gemeinsamen
Austausch mit zahlreichen Kollegen - nahezu alle waren Juden - die
Psychoanalyse. Freud war ein durch und durch skeptischer Mensch, kein
Menschenfreund, verwendete gelegentlich den Begriff des "Gesindels", wenn er
an seine ihm großteils feindlich gesonnene Umwelt dachte. Über die dem
Menschen innewohnende Destruktivität machte er sich keine Illusionen. Der
Möglichkeit der menschlichen Selbstzerstörung war er sich immer bewusst. Am
Vorabend der nationalsozialistischen "Machtergreifung" schrieb Freud, von
dunklen Vorahnungen erfüllt, am Ende seiner großen Arbeit "Das Unbehagen
in der Kultur":
"Die
Schicksalsfrage der Menschenart scheint mir zu sein, ob und in welchem Maße
es ihrer Kulturentwicklung gelingen wird, der Störung des Zusammenlebens
durch den menschlichen Aggressions- und Selbstvernichtungstrieb Herr zu
werden. (...) Die Menschen haben es jetzt in der Beherrschung der
Naturkräfte so weit gebracht, daß sie es mit deren Hilfe leicht haben,
einander bis auf den letzten Mann auszurotten. Sie wissen das, daher ein gut
Stück ihrer gegenwärtigen Unruhe, ihres Unglücks, ihrer Angststimmung."
Der
82-jährige Freud trat den Weg ins Exil nur mit größtem Widerstreben an. In
den Jahren von 1932 bis 1938 hatten nahezu alle Wiener Psychoanalytiker den
Weg ins Exil ergriffen, ergreifen müssen - Freud jedoch nicht. Der
krebskranke alte Mann beurteilte - wie zahlreiche Intellektuelle der
damaligen Zeit - die Gefährlichkeit und Langlebigkeit des
Nationalsozialismus zu optimistisch. Auch durfte der Schwerkranke, durchaus
nicht unberechtigt, damit rechnen, in seiner Heimatstadt "unbehelligt und
ruhig sterben zu können."
Ein "gottloser
Jude"
Die
Selbstbeschreibung als "gottloser Jude" verwendete Freud 1918, gegen Ende
des 1. Weltkrieges, in einem Brief an den Schweizer Pfarrer und
Psychoanalytiker Oskar Pfister. Zehn Jahre zuvor hatte er eben diesem
Pfarrer Pfister geschrieben: "Ganz nebenbei, warum hat keiner von all den
Frommen die Psychoanalyse geschaffen, warum mußte man da auf einen ganz
gottlosen Juden warten?"
An
die Existenz eines unser Seelenleben trostgebenden Gottes vermochte der
überzeugte Atheist Freud nicht zu glauben. Illusionen waren nicht seine
Sache. Seine leidenschaftliches Erkenntnisinteresse galt den uns
unangenehmen Wahrheiten, der Wahrheit über die Abgründe des menschlichen
Seelenlebens, einschließlich unserer Fähigkeit zur äußersten Destruktivität.
Seiner Identität als Jude war sich Freud bereits früh bewusst - sie wurde
ihm von seiner ganz überwiegend katholischen Umwelt aufgenötigt. Immer
wieder kam er in seinen Briefen und Studien auf seine Zugehörigkeit zum
Judentum zu sprechen - eine Identität, welche zunehmend die Haltung eines
stolzen Trotzes einnahm.
Wien war in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts eine
Zufluchtstätte für Juden geworden. 1880 - Freud hatte soeben seine ersten
medizinischen Schriften publiziert, 15 Jahre vor seiner ersten großen
psychoanalytischen "Studie(n) über Hysterie" - waren zehn
Prozent aller Wiener Juden. "In den 1880er Jahren waren mindestens die
Hälfte aller Wiener Journalisten, Ärzte und Anwälte Juden", schreibt Peter
Gay in seiner monumentalen Freud-Biographie.
Als Freud von 1865 - 1873 in Wien das Gymnasium besuchte stieg die Zahl
seiner jüdischen Mitschüler von 44 auf 73 Prozent.
Das
Gefühl einer gesellschaftlichen Ablehnung seiner beunruhigenden,
bahnbrechenden Entdeckungen, sowohl aus unbewussten als auch aus
antisemitischen Motiven, bildete sich in Freud früh heraus. Als sein Vater
dem wohl zehn- oder zwölfjährigen bei einem Spaziergang eine antisemitische
Episode berichtete, in welcher ihm ein Christ mit dem Ruf "Jud, herunter vom
Trottoir" die Mütze vom Kopf schlug, was sein Vater scheinbar ohne Gegenwehr
ertrug, empörte dieses Zurückweichen den jungen Sigmund. Diese "unterwürfige
Reaktion" seines Vaters "schien mir", wie er in seiner "Traumdeutung"
(1900) schreiben sollte, als "nicht heldenhaft".
Das Zurückweichen erweckte in dem Jungen Rachephantasien, er identifizierte
sich mit dem unerschrockenen, kämpferischen Semiten Hannibal.
Die grundlegende Bedeutung, welche Sigmund Freud in seinen
Schriften ab 1895 der seinerzeit tabuisierten menschlichen Sexualität
zuerkannte, rief im durch und durch katholischen Wien heftige
Gegenreaktionen hervor. So schrieb beispielsweise 1896 der Psychiater
Rieger, als Reaktion auf Freuds soeben publizierte Hysteriestudie, Freuds
Ansichten seien so abwegig, dass "kein Irrenarzt sie lesen könne, ohne ein
wahres Gefühl des Entsetzens zu spüren."
Freud fühlte sich gesellschaftlich geächtet.
Für
einen Juden war eine akademische Karriere in Wien nur bei Überwindung
hartnäckiger Hindernisse zu erlangen. Freud führte diese realistische
Einschätzung nicht zu einer Assimilation, zu einer Verleugnung seiner
jüdischen Wurzeln. 1897 trat der 41-jährige vielmehr der zwei Jahre zuvor
gegründeten Wiener Loge B'nai Brith bei und hielt dort Vorträge. Das
Gefühl einer Zugehörigkeit zu dieser jüdischen Vereinigung formulierte Freud
verschiedentlich in für ihn ungewohnter persönlicher Wärme.
Bereits in seiner bekannten autobiographischen Schrift "Selbstdarstellung",
1914 publiziert, kennzeichnete Freud seinen Standpunkt in entschiedener,
vielleicht etwas stilisierter Deutlichkeit:
"Meine Eltern waren Juden." Und Freud fügt hinzu: "Auch ich bin Jude
geblieben."
"Weil ich Jude war, fand ich mich frei von vielen Vorurteilen, die andere im
Gebrauch ihres Intellekts beschränkten, als Jude war ich dafür vorbereitet,
in die Opposition zu gehen und auf das Einverständnis mit der 'kompakten
Majorität' zu verzichten."
B'nai B'rith feierte am 8. Mai 1926 Freuds 70. Geburtstag in Form einer
Festsitzung und widmete eine Sondernummer ihrer "Mitteilungen" ihrem
prominenten Mitglied.
In
seiner Ansprache an B'nai B'rith - welcher krankheitsbedingt durch einen
Mitbruder verlesen werden musste - erinnert sich Freud im autobiographischen
Rückblick der Umstände seines 30 Jahre zurückliegenden Beitritts in diese
jüdische Vereinigung, welche "mein erstes Auditorium" war:
"Es
geschah in den Jahren nach 1895, daß zwei starke Eindrücke bei mir zur
gleichen Wirkung zusammentrafen. Einerseits hatte ich die ersten Einblicke
in die Tiefen des menschlichen Trieblebens gewonnen, manches gesehen, was
ernüchtern, zunächst sogar erschrecken konnte, andererseits hatte die
Mitteilung meiner unliebsamen Funde den Erfolg, daß ich den größten Teil
meiner damaligen menschlichen Beziehungen einbüßte; ich kam mir vor wie
geächtet, von allen gemieden. In dieser Vereinsamung erwachte in mir die
Sehnsucht nach einem Kreis von auserlesenen, hochgestimmten Männern, die
mich ungeachtet meiner Verwegenheit freundschaftlich aufnehmen sollten.
Ihre Vereinigung wurde mir als der Ort bezeichnet, wo solche Männer zu
finden seien. (...) Daß Sie Juden sind, konnte mir nur erwünscht sein, denn
ich war selbst Jude, und es war mir immer nicht nur unwürdig, sondern direkt
unsinnig erschienen, es zu verleugnen."
|
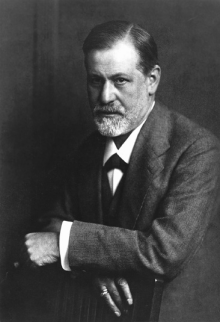
Foto: © Archiv S. Fischer Verlag
|
Um zu verhindern, dass seine neue Wissenschaft
Psychoanalyse als eine "jüdische" Erkenntnis- und Behandlungsmethode von der
größtenteils nicht-jüdischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, machte Freud
bei seiner "Vereinspolitik" (Gay), beim Aufbau seiner Psychoanalytischen
Vereinigung, bewusst einige Konzessionen: Er bemühte sich darum, dem
Psychiater Carl Gustav Jung - der "Arier" - , welcher 1906 Kontakt zu
ihm aufgenommen hatte, eine hohe Funktion innerhalb seiner Wiener
Psychoanalytischen Vereinigung zukommen zu lassen. Über mehrere Jahre sah
Freud in Jung sogar seinen "Kronprinzen", bezeichnete ihn gelegentlich als
"seinen Sohn". In Briefen an seinen jüdischen Kollegen Karl Abraham führte
Freud 1908 aus, dass es für Jung "als Christ und Pastorensohn" innerlich
sehr viel schwieriger sei, die inneren Widerstände gegen die Psychoanalyse
zu überwinden, als für seine jüdischen Kollegen. Freud fügte, auf Jung
bezogen, hinzu: "Um so wertvoller ist sein Anschluß. Ich hätte beinahe
gesagt, daß erst sein Auftreten die Psychoanalyse der Gefahr entzogen hat,
eine jüdische nationale Angelegenheit zu werden."
Im gleichen Jahr schrieb er Abraham: "Seien Sie versichert, wenn ich
Oberhuber hieße, meine Neuerungen hätten trotz alledem weit geringeren
Widerstand gefunden."
Und: "Unsere arischen Genossen sind uns doch ganz unentbehrlich, sonst
verfiele die Psychoanalyse dem Antisemitismus. (...) Wir müssen als Juden,
wenn wir irgendwo mittun wollen, ein Stück Masochismus entwickeln, bereit
sein, uns etwas Unrecht tun zu lassen." (ebda.) Sein Bruch mit Jung, wenige
Jahre später, stellte ein Trauma innerhalb der Geschichte der Psychoanalyse
dar. C. G. Jung, dies bleibt noch nachzutragen, war sich nicht einmal zu
schade, ab dem Jahr 1933 - also zu einem Zeitpunkt, als seine ehemaligen
jüdischen Freunde und Kollegen existentiell bedroht, einige Wenige ermordet
wurden
- in seinen psychologischen Schriften eine dezidierte Unterscheidung
zwischen dem "jüdischen und arischen Unbewußten" einzuführen.
Mitte der 1920er Jahre - Freud hatte einen Großteil seiner
Schriften publiziert, eine beeindruckende Schar von Mitstreitern gefunden
und internationale Anerkennung gefunden - wurden die Anzeichen des
Antisemitismus immer stärker. 1927 unterschrieb der liberale Freud einen
Wahlaufruf für die Sozialisten. Seine Zugehörigkeit zum jüdischen Volk, zu
seinen jüdischen Wurzeln, betonte Freud nun immer nachdrücklicher.
In
einem Interview formulierte der 70jährige Freud 1926: "Meine Sprache ist
deutsch. Meine Kultur, meine Bildung sind deutsch. Ich betrachtete mich
geistig als Deutschen, bis ich die Zunahme des antisemitischen Vorurteils in
Deutschland und Deutschösterreich bemerkte. Seit dieser Zeit ziehe ich es
vor, mich einen Juden zu nennen."
Und 1935 schrieb Freud in einem Brief, "daß ich mich immer treu zu unserem
Volk gehalten und nie für etwas anderes ausgegeben habe, als ich bin: ein
Jude aus Mähren, dessen Eltern aus dem österreichischen Galizien stammten."
1932 flohen die ersten Wiener Analytiker ins Exil - ein Prozess,
welcher in den Jahren 1937 und 1938 seinen traurigen Höhepunkt fand.
Freuds zutiefst ambivalente Einschätzung seiner eigenen existentiellen
Gefährdung spiegelt sich in seinem regen Briefwechsel der 1930er Jahre
wider. Im März 1933 schrieb er an Marie Bonaparte - die fünf Jahre später
seine Emigration nach London unterstützen sollte: "Man darf nicht übersehen,
daß Judenverfolgung und Einschränkung der geistigen Freiheit die einzigen
Punkte des Hitler-Programms sind, die sich durchführen lassen. Alles übrige
ist ja Phrase und Utopie. (...) Die Welt ist ein großes Zuchthaus, die
ärgste Zelle ist Deutschland. (...) In Deutschland sehe ich eine paradoxe
Überraschung voraus. Sie haben dort mit der Todfeindschaft gegen den
Bolschewismus begonnen und werden mit etwas enden, was von ihm nicht zu
unterscheiden ist. Außer vielleicht darin, daß der Bolschewismus doch
revolutionäre Ideale aufgenommen hat, der Hitlerismus nur
mittelalterlich-reaktionäre."
Und
auf die öffentliche Verbrennung seiner Bücher im Mai 1933 reagiert er mit
den sarkastischen Worten: "Was wir für Fortschritte machen! Im Mittelalter
hätten sie mich verbrannt, heutzutage begnügen sie sich damit, meine Bücher
zu verbrennen."
Die 1930er Jahre: Freuds
Briefwechsel mit Arnold Zweig in Palästina
Freud war zeitlebens ein produktiver und zuverlässiger Briefeschreiber. Er
führte eine umfangreiche Korrespondenz mit Kollegen, mit Schriftstellern und
Künstlern.
Auch
in dieser Phase der zunehmenden Bedrohung durch den Nationalsozialismus
setzte Freud seinen regen Briefwechsel fort. Einer seiner bevorzugten
Briefpartner war der jüdische Schriftsteller Arnold Zweig
(1897-1968), dessen Schriften Freud mit Interesse las. Zweig war 1933 nach
Palästina emigriert. Ebendorthin war auch Freuds enger Mitarbeiter Max
Eitingon von Berlin aus geflohen. Zahlreiche Psychoanalytiker und
psychoanalytische Pädagogen folgten ihm nach Palästina und bauten bereits
1934 die Palästinensische Psychoanalytische Gesellschaft (ab 1948: Israel
Psychoanalytic Society) auf. Amtssprache war seinerzeit, immer noch -
deutsch.
Diese Emigranten setzten in Palästina ihr europäisches Engagement fort und
waren vor allem an der Reform des im Aufbau befindlichen jüdischen
Erziehungs- sowie des Gesundheitswesens interessiert. Jahrzehnte später
sollten viele von ihnen in Israel sowie den USA maßgebend an
psychoanalytischen Bemühungen involviert sein, Shoah-Opfern durch
psychoanalytisch fundierte Bemühungen dabei zu helfen, besser mit ihren
traumatischen Erfahrungen umzugehen.
Viele von ihnen waren in Wien und Berlin von dem jungen Psychoanalytiker,
Pädagogen, Sozialisten und Zionisten Siegfried Bernfeld (1892-1953)
geprägt worden, der der jungen psychoanalytisch-pädagogischen Reformbewegung
entscheidende Impulse geliefert hatte. Dessen 1919 gegründetes Wiener
Kinderheim Baumgarten - ein pädagogisches Modellprojekt, in dem 240
jüdische Kriegswaisen betreut wurden - war der Mikrokosmos einer modernen
jüdische Erziehung, dessen Grundgedanken nun in zahlreichen Kibbuzim
aufgegriffen und realisiert wurden.
Arnold Zweig war in Palästina mit Eitingon befreundet und
bezeichnete dessen Wohnung Freud gegenüber als "das erfreulichste Haus in
Jerusalem"; und er fügte hinzu: "... und es ist wunderschön, Menschen so
nahe zu haben, die Ihnen innerlich so nahe stehen und Ihre Arbeit so treu
betreuen."
Zweig hatte sich in seiner Jugend, wie Bernfeld, leidenschaftlich mit dem
Zionismus identifiziert. 1924 war er der Redaktion der Jüdischen
Rundschau beigetreten und publizierte 1925 das Werk "Das neue Kanaan",
mit dem er seine Identifikation mit dem Zionismus zum Ausdruck brachte. 1929
publizierte er den Essay "Freud und der Mensch" in der Zeitschrift "Die
Psychoanalytische Bewegung".
Im
März 1927 hatte der tiefgründige Briefwechsel zwischen diesen beiden
Intellektuellen begonnen; er endete erst zwölf Jahre später mit Freuds Tod.
"Vater Freud" - wie ihn Zweig in seinen Briefen häufig respektvoll nannte -,
blieb all die Jahre, trotz der geographischen Distanz, ein
freundschaftlich-liebevoller Berater und Begleiter Arnold Zweigs.
Im April 1932 hatte Arnold Zweig das Wagnis auf sich
genommen, von einer Palästinareise wieder nach Deutschland zurückzukehren.
Am 1.5.1932 schreibt Zweig an Freud: "Welcher Irrtum, hierher
zurückzustreben! Was von diesem Europa, das ich liebe, von diesem
Deutschland, das ich zum guten Teil bin, ist in diesem Augenblick noch
greifbar da, Kraftquelle und Arbeitsanschluß? Warum nicht drüben geblieben,
in der heroischen Landschaft Galiläas oder am Meer von Tel Aviv oder am
Toten Meer."
Und am 29.5.1932 fügt Zweig hinzu: "Sie haben zwei
schwierige Punkte berührt, über die ich viel nachgedacht habe. Mein
Verhältnis zu Deutschland und zu meinem Deutschtum, und mein Verhältnis zu
den Juden, dem Judentum in mir und in der Welt, und zu Palästina. Dies Land
der Religionen kann doch, gerade von Ihnen, auch unter anderen Aspekten
angesehen werden als denen von Wahn und Wunsch."
Am
18.8.1932 antwortet ihm Freud. Er hat von den nationalsozialistischen
Drohungen gegen Zweig gehört und ermutigt seinen Freund zu einer Fortsetzung
ihres Briefwechsels, ihres regelmäßigen Manuskriptaustausches: "Also
vielleicht arbeiten die Nazis mir einmal in die Hände. Wenn Sie mir von
ihren Grübeleien erzählen, kann ich Sie von dem Wahn befreien, daß man ein
Deutscher sein muß. Sollte man dies gottverlassene Volk nicht sich selbst
überlassen? Ich schließe, damit Sie dieser Brief eher erreicht und grüße Sie
beide herzlich."
1933
tat der 46jährige Arnold Zweig etwas, was der 31 Jahre ältere Freud nicht
ernsthaft in Erwägung zog: Er emigrierte nach Palästina - bzw. blieb nach
einer Palästinareise im Gelobten Land. Freunde hatten ihm hierzu geraten.
Zweig ließ sich in Haifa nieder. Des Hebräischen weitestgehend unkundig,
durch eine Sehbehinderung am Erlernen der Sprache zusätzlich behindert, wich
seine anfängliche Euphorie rasch einer Ernüchterung: Er fühlt sich in Eretz
Israel als Schriftsteller zu wenig geschätzt, leidet unter den bedrückenden
ökonomischen Lebensverhältnissen, vermag sich gesellschaftlich nicht zu
assimilieren und verweigert eine vollständige Identifikation mit dem
Zionismus. Am 21.1.1934, nur einen Monat nach seiner Ankunft in
Palästina, schreibt er entmutigt an Freud: "Bald funktioniert die
Zentralheizung nicht, bald stank der Petroleumofen (...) Wir sind nicht
bereit, unseren Standard aufzugeben, und das Land ist noch nicht bereit, ihn
zu befriedigen. (...) Ich mache mir nichts mehr aus dem Land der Väter. Ich
habe keinerlei zionistische Illusion mehr. Ich betrachte die Notwendigkeit,
hier unter Juden zu leben, ohne Enthusiasmus, ohne Verschönerungen und
selbst ohne Spott."
Sieben Tage später, am 28.1.1934, antwortet ihm Freud: "Ich habe
lange in Spannung auf Ihren Brief gewartet. (...) ich bin begierig, sie zu
lesen, jetzt, da ich Sie von Ihrer unglücklichen Liebe zum angeblichen
Vaterland geheilt weiß. So eine Schwärmerei taugt nichts für unsereinen."
Und
am 25.2.1934 fügt Freud, auf seine eigene schwierige Lebenssituation
in Wien bezogen, hinzu: "Sie erwarten richtig, daß wir in Ergebung hier
ausharren wollen. Wohin sollte ich auch in meiner Abhängigkeit und
körperlichen Hilflosigkeit? Und die Fremde ist überall so ungastlich. Nur,
wenn wirklich ein Hitlerscher Statthalter in Wien regiert, muß ich wohl
fortziehen, gleichgültig wohin."
Zwei
Monate später sucht Zweig in seiner Not Hilfe durch eine psychoanalytische
Behandlung. Er schreibt am 23.4.1934 an Freud: "Lieber Vater Freud,
ich gehe noch einmal in Analyse. Ich werde die Hitlerei nicht los. Der
Affekt hat sich gegen jemanden umgelagert, die unsere Sachen 1933 unter
Schwierigkeiten betreut hatte. Aber mein Affekt ist Besessenheit. Und ich
lebe nicht in der Gegenwart, sondern bin 'abwesend'."
In
der Phase der eigenen Bedrohung galt Freuds größte Sorge dem Überleben
seiner Familie sowie dem seiner analytischen Kollegen. Deren Emigration sah
er wohl als eine Notwendigkeit an - und hing gelegentlich doch der
trügerischen Illusion an, dass seine Psychoanalyse, seine psychoanalytischen
Zeitschriften und sein Verlag in Wien überleben könnten. In dieser Phase
arbeitete er an seinem "Alterswerk": Der religions- und kulturkritischen
Studie "Der Mann Moses und die monotheistische Religion" (GW XVI, S.
101-246). Dieses Buch des knapp 80-jährigen, krebskranken Mannes war ein
Versuch, den "ewigen Antisemitismus", den mörderischen Haß auf "die Juden"
in historischer Dimension zu verstehen.
Je konkreter der Antisemitismus nun Freud selbst bedrohte, desto stärker
identifizierte dieser sich mit seinen jüdischen Wurzeln. Die ersten beiden
Kapitel der Moses-Studie erschienen 1937 in "Imago", vollständig publiziert
wurde sie jedoch erst nach Freuds Emigration nach London, in einem
holländischen Verlag.
In
einem Brief vom 30.9.1934 an Arnold Zweig skizziert Freud seine
thematische und methodische Zugangsweise: "Der Ausgangspunkt meiner Arbeit
ist Ihnen vertraut; derselbe wie für Ihre 'Bilanz' (Zweig 1934). Angesichts
der neuen Verfolgungen fragt man sich wieder, wie der Jude geworden ist und
warum er sich diesen unsterblichen Haß zugezogen hat. Ich hatte bald die
Formel heraus. Moses hat den Juden geschaffen, und meine Arbeit bekam den
Titel: Der Mann Moses, ein historischer Roman.
Am
9.9.1935 dankt Freud für die Zusendung von Zweigs Roman "Erziehung
von Verdun". Freud ist angetan von diesem Werk seines Freundes: "Meine
Tochter Anna liest jetzt die 'Erziehung von Verdun' und kommt immer wieder
zu mir, ihren Empfindungen Ausdruck zu geben. Wir tauschen dann unsere
Bemerkungen aus. Sie wissen, ich bilde mir ein, meine Warnung hätte Sie
abgehalten nach Berlin zurückzugehen, und ich bin noch immer stolz darauf,
und jetzt ist es erst recht sicher, daß Sie nie in die Nähe einer deutschen
Grenze kommen dürfen. Es wäre schade um Sie. Es (Zweigs 'Verdun', d. Verf.)
ist eine langersehnte Befreiung. Endlich die Wahrheit, die grimmige,
endgültige Wahrheit, die man nicht entbehren kann. Man versteht das
Deutschland von heute nicht, wenn man um 'Verdun' (und wofür es steht)
nichts weiß."
Gelegentlich tauchen bei Freud nun Andeutungen auf, in denen er seine eigene
existentielle Bedrohung durch die Nationalsozialisten nicht mehr
beiseitezuschieben vermochte. Am 14.10.1935 schreibt er Zweig: "Eine
bange Ahnung sagt uns, daß wir, oh die armen österreichischen Juden, einen
Teil der Rechnung werden bezahlen müssen. Es ist traurig, daß wir
Weltereignisse auch vom Judenstandpunkt beurteilen, aber wie könnten wir
anders!"
Arnold Zweigs Klagen über sein Leben in Palästina häufen sich. Am
15.2.1936 schreibt er Freud: "Ich sträube mich gegen das ganze Dasein
hier in Palästina. Ich fühle mich falsch am Platze. (...) Was sagen Sie
dazu? Sie und kein anderer haben mich doch vor der Tollheit zurückgehalten,
im Mai 33 noch einmal nach Eichkamp, d. h. ins Konzentrationslager und den
Tod zu gehen. Außer Ihnen hat von meinen Freunden nur noch Feuchtwanger so
klar gesehen. Aber was raten Sie mir zu tun?"
Freud ist von Zweigs Not berührt. Bereits sechs Tage später, am
21.2.1936, entgegnet er ihm: "Ihr Brief hat mich sehr bewegt. Er ist
nicht das erste Mal, daß ich von den Schwierigkeiten des Kulturmenschen
höre, sich in Palästina einzuleben. Die Geschichte hat dem Judenvolk keinen
Anlaß gegeben, seine Fähigkeiten zur Bildung eines Staates und einer
Gesellschaft zu entwickeln. (...) Sie fühlen sich unbehaglich, aber ich
wußte nicht, daß Sie die Isolierung so schlecht vertragen. Fest auf Ihrer
Künstlerschaft fußend, sollten Sie auch eine Weile allein sein können. In
Palästina haben Sie wenigstens persönliche Sicherheit und Ihre
Menschenrechte. Und wo wollen Sie hingehen? Amerika würden Sie, nach all
meinen Eindrücken, darf ich's sagen, vielmehr unerträglicher finden. Überall
sind Sie ein kaum geduldeter Fremder. In Amerika müßten Sie auch Ihre
Sprache abwerfen, nicht ein Kleidungsstück, sondern Ihre eigene Haut. Ich
meine wirklich, Sie sollten zunächst bleiben, wo Sie sind. Die Aussicht,
nach einigen Jahren Deutschland wieder zugänglich zu finden, ist wirklich
vorhanden. (...) Freilich, auch nach den Nazis wird Deutschland nicht mehr
das Frühere sein. (...) Aber man wird an der Aufräumungsarbeit teilnehmen
dürfen."
Die
immer weiter eskalierende Entrechtung und Verfolgung in Österreich führen
Freud zu einer zunehmend pessimistischeren - will heißen: realistischen - ,
aber auch fatalistischen Sicht auf seine Existenzmöglichkeit in Wien. Am
22.6.1936 schreibt er Zweig: "Österreichs Weg zum National-Sozialismus
scheint unaufhaltsam. Alle Schicksale haben sich mit dem Gesindel
verschworen. Mit immer weniger Bedauern warte ich darauf, daß für mich der
Vorhang fällt."
Und gegen Ende des Jahres 1937 scheint seine Resignation obsiegt zu haben:
"In Ihrem Interesse kann ich es kaum bedauern, daß Sie nicht Wien zur neuen
Heimat gewählt haben. Die Regierung hier ist eine andere, aber das Volk ist
dasselbe, in der Anbetung des Antisemitismus durchaus einig mit den Brüdern
im Reich. Die Kehle wird uns immer enger zugeschnürt, wenn wir auch nicht
erwürgt werden. Palästina ist wenigstens noch British Empire, das ist nicht
zu unterschätzen."
Die Emigration der Wiener
Psychoanalytiker und der Pädagogen ins Exil
Die
Vertreibung der intellektuellen Eliten aus Wien bzw. Österreich in den
1930er Jahren stellt die schärfste Zäsur in der Wissenschaftsgeschichte
Österreichs dar. Die Psychoanalyse sowie die - von Freud nachdrücklich
geförderte - Psychoanalytische Pädagogik wurde im eigenen Ursprungsland
vollständig zerstört und zur Emigration - größtenteils in die USA -
genötigt.
Von dem kulturellen und biographischen Schaden, den die
psychoanalytisch-pädagogische Bewegung erlitt, von ihrer
historisch-biographischen Entwurzelung, vermochte sie sich über mehrere
Jahrzehnte hinweg nicht mehr zu erholen.
Die psychoanalytische Bewegung selbst ist seit den 1930er Jahren nur noch
als Emigrationsbewegung zu beschreiben. Den meisten Psychoanalytikern gelang
die Flucht ins rettende Exil; über 20 von ihnen wurden jedoch ermordet, für
ihr Schicksal hatte sich bis in die 1980er Jahre nahezu niemand
interessiert.
Die Emigration vieler Psychoanalytiker wurde vor allem
ermöglicht, weil diese im Unterschied zu den meisten anderen jüdischen
Berufsgruppen über vielfältige ausländische Kontakte verfügten. Die Ausreise
beispielsweise in die USA war vor allem davon abhängig, dass der Emigrant
einen Bürger in Amerika fand, der die Erklärung abgab, ihn im Notfall
finanziell zu unterstützen. Auch waren in den 1920er und 30er Jahren
viele Interessierte - vor allem aus den USA - nach Wien gekommen,
um die Psychoanalyse in ihrem Geburtsort aus erster Hand zu erlernen. Einige
von ihnen gründeten in Wien therapeutische Schulen und Kindergärten,
übersetzten Schriften Freuds, erteilten einigen Analytikern
Englischunterricht. Einige dieser amerikanischen Analytiker - die durch ihre
amerikanische Staatsbürgerschaft in den 1930er Jahren nicht unmittelbar
bedroht waren - nutzten ihre Stellung und Kontakte, um Wiener Analytikern
bei der Flucht zu helfen. Einige waren sogar in Wien im illegalen Untergrund
engagiert, besorgten Affidavits, falsche Pässe, Geld und versteckten
Analytiker vor den Nazis. Als die wagemutigste Helferin gilt die
amerikanische Psychoanalytikerin Muriel Gardiner. Besondere Erwähnung
verdient das mutige Verhalten des renommierten Psychoanalytikers Richard
Sterba, der - obwohl als Katholik nicht persönlich gefährdet - aus
Solidarität mit seinen jüdischen Kollegen in die USA emigrierte.
Mehrere Analytiker - zu nennen sind u.a. Edith Jacobson, Edith Buxbaum,
Rudolf Ekstein, Marie Langer, Ernst Federn, Muriel Gardiner und
Thea Erdheim-Genner - waren intensiv im "illegalen" Widerstand gegen die
Nationalsozialisten engagiert und wurden von der Gestapo eine Zeit lang
inhaftiert. Bruno Bettelheim
sowie Ernst Federn
überlebten eine ein- bzw. eine siebenjährige Konzentrationslagerhaft in Dachau und Buchenwald und wurden nach ihrer
Befreiung zu den Begründern einer Psychologie des Terrors.
Ein
besonders tragisches Schicksal erlitt der kämpferische Antifaschist
Wilhelm Reich, der in den 1920er und 1930er Jahren zahlreiche
wegweisende Studien zur Psychologie des Faschismus publiziert hatte. Er
wurde 1933/34 wohl wegen seines politischen Engagements gegen die Nazis
sowohl aus der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung als auch aus
der Kommunistischen Partei ausgeschlossen; sein Schicksal hat für bis heute
anhaltende Kontroversen gesorgt.
Einige Zahlen seien genannt: Von den 149 Mitgliedern der
Wiener Psychoanalytischen Vereinigung - nahezu alles Juden - emigrierten bis
1939 146. Nahezu alle Psychoanalytischen Pädagogen emigrierten, größtenteils
in die USA. Den meisten von ihnen gelang es, trotz des in den USA
vorherrschenden "Medicozentrismus" (Paul Parin), sich in ihrer neuen Heimat
zu behaupten, Teile ihrer professionellen Identität in ihre neue
Heimatkultur einzubringen. Die sozial-aufklärerische Aufbruchstimmung, die
in dieser Weise wohl nur in Wien hatte entstehen können, war jedoch
ausgelöscht worden. In den USA gab es nahezu keine Möglichkeit mehr, hieran
kulturell anzuknüpfen Andererseits gelang es vielen von Sigmund Freud sowie
Siegfried Bernfeld geprägten jungen psychoanalytischen Pädagogen, in ihrer
neuen Heimat im psychoanalytisch-pädagogischen Feld Pionierarbeit zu
leisten. Zu nennen sind u.a.: Anny Angel-Katan, Bruno Bettelheim, Siegfried
Bernfeld, Peter Blos, Berta und Stefanie Bornstein, Edith Buxbaum, Kurt
Eissler, Rudolf Ekstein, Erik Erikson, Ernst Federn, Anna Freud, Judith S.
Kestenberg, Else Pappenheim, Lili Peller, Emma Plank, Fritz Redl, Emmy
Sylvester, Richard und Editha Sterba.
Freuds Emigration - Tod
im Exil
Ab
1936 verschärfte sich die Situation in Wien immer weiter. Der gescheiterte
Februaraufstand im Februar 1934 hatte auf Seiten der Linken einen Prozess
der Desillusionierung eingeleitet und die Emigrationswelle noch einmal
ansteigen lassen. In Freuds Briefen schlichen sich starke Züge von
Fatalismus ein: "Überflüssig, etwas über die allgemeine Weltlage zu sagen"
schrieb er im April 1932 an seinen ungarischen Kollegen Ferenczi.
Der Gedanke an die eigene Emigration, welche ihm auch von besorgten Freunden
nahegelegt wurde, tauchte vereinzelt auf, wurde jedoch gleich wieder
verworfen. "Flucht, meine ich, wäre nur durch direkte Lebensgefahr
gerechtfertigt", schrieb er im April 1933 an Ferenczi.
Freud wollte in Wien ausharren, solange es nur irgend ging. Die Rolle eines
Flüchtlings, der vor den Nazis davonlief, erschien dem knapp 80-jährigen
krebskranken Mann als keine hinnehmbare Lebensperspektive. Nach dem
gescheiterten Februaraufstand 1934 schreibt er am 20.2.1934 an seinen Sohn
Ernst Freud: "Entweder ein österreichischer Faschismus oder das Hakenkreuz.
Im letzteren Falle müssen wir weg."
Die international beachteten Geburtstagsfeiern um den 6. Mai 1936 anlässlich
Freuds 80. Geburtstages ermöglichen noch einmal eine kurze Ablenkung. Thomas
Mann verliest persönlich in Freuds Berggasse Nr. 19 seinen Gratulationstext:
"Freud und die Zukunft". Die international renommierte "Royal Society" in
London ernennt ihn zu ihrem korrespondierenden Mitglied; unter den
internationalen Presseberichten fiel insbesondere der der schwedischen
Schriftstellerin Selma Lagerlöf auf.
|
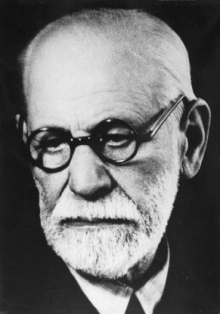
Foto: © Archiv S. Fischer Verlag
|
Zugleich leidet Freud jedoch zunehmend an den durch seine Krebserkrankung
bedingten Schmerzen, hat Sterbensgedanken. Seine Briefe, auch die an Arnold
Zweig, werden düsterer. Sein Angewiesensein an seine über alles geliebte
Tochter Anna, welche ihn jahrelang versorgt hatte, nimmt weiter zu. Diese
beschreibt in Briefen anschaulich die Panik unter Wiener Juden, durch die
sie sich jedoch nicht anstecken lasse. Am 11.3.1938 notiert Freud, nach
einem Ultimatum Hitlers, in seiner knappen Arbeitsnotiz "Finis Austriae",
am 13.3.38 "Hitler in Wien".
Der Vorstand der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung empfiehlt seinen noch
in Wien verbliebenen Mitgliedern die Emigration. Die Synagogen brennen,
Juden werden auf der Straße misshandelt. Am 15.3.1938 wird Freuds Wohnung
und sein Psychoanalytischer Verlag durchsucht, eine Woche später schließlich
wird Anna Freud von der Gestapo verhaftet und zu einem Verhör
vorgeladen - für Freud ein Schock. Die Ereignisse überschlagen sich: Nun
vermag er die Asylangebote mehrerer Regierungen, u.a. der von Palästina,
nicht mehr zu ignorieren. William Bullitt, amerikanischer Botschafter in
Frankreich, der amerikanische Außenminister Cordell Hull, der amerikanische
Generalkonsul in Wien sowie Freuds langjährige Freundin Prinzessin Marie
Bonaparte setzen sich nachdrücklich für Freuds Ausreiseerlaubnis aus Wien
ein.
Am
4. Juni 1938 sind alle Formalitäten erfüllt: Freud emigriert mit
einem Teil seiner Familie über Frankreich nach London. Das Photo mit Anna
und Sigmund Freud im Bahnabteil geht durch die Weltpresse. Sein letzter
knapper Brief, noch in Wien, vom 4.6.1938, geht an Arnold Zweig: "Leaving
today for 39, Elsworthy Road, London N. W. 3.
Affect,
greetings Freud."
Zweig antwortet ihm am 18.6.38 u.a.: "Nun sind Sie in Sicherheit, weg von
den Opfern einer jahrzehntelangen Rachsucht. (...) Ihr Archiv, Ihre Bücher,
die Sammlungen sind gerettet."
Freuds Beobachtungsgabe und Formulierungskunst ist ungebrochen. Unmittelbar
nach seiner Ankunft in London, am 6.6.1938, schreibt er an Eitingon in
Jerusalem einen langen, persönlichen Brief: "Die Affektlage dieser Tage ist
schwer zu fassen, kaum zu beschreiben. (...) Wir sind mit einem Schlag
populär in London geworden."
Und ein
schon nahezu versöhnlicher Zug macht sich bemerkbar, fügt er diesem Brief an
Eitingon doch die introspektive Selbstbeobachtung hinzu: "Das Triumphgefühl
der Befreiung vermengt sich zu stark mit der Trauer, denn man hat das
Gefängnis, aus dem man entlassen wurde, immer noch sehr geliebt."
[50]
Auch
in London setzt der 82-jährige sein wissenschaftliches Schreiben fort. Er
schließt seinen "Moses" ab, beginnt im Juli 1938 mit seiner dichten
Schrift "Abriß der Psychoanalyse".
Seine Krebserkrankung, an welcher er seit dem Jahre 1923 gelitten hatte,
überwältigt Freud zunehmend. Im September 1938 wird er ein letztes Mal
operiert; von diesem Eingriff wird er sich nicht wieder erholen. Ein Jahr
später, im September 1939, vermag er die Schmerzen nicht mehr zu ertragen.
Am 21. und 22. September verabreicht ihm sein Arzt mehrere Dosen Morphium,
in den frühen Morgenstunden des 23. September 1939 stirbt der weise alte
Mann im Londoner Exil.
Von dem Fürchterlichen, welches folgen sollte, erlebte Freud nichts mehr.
Vier seiner Schwestern wurden in Theresienstatt sowie in Auschwitz ermordet.
Diese Studie ist zuvor, in einer etwas gekürzten Version, in der
TRIBÜNE.
Zeitschrift zum Verständnis des Judentums, 44. Jahrgang, Nr. 177 (Heft
1/2006), S. 158-171
publiziert worden. Wir
danken dem Tribüne-Verlag
herzlich für die Nachdruckrechte.
[ENGLISH]
Anmerkungen:
Peter Gay (1989): Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Frankfurt/M.
(Büchergilde Gutenberg), S. 673.
Freud - Zweig, a.a.O., S. 169f.
Sigmund Freud (1930): Das Unbehagen in der Kultur. GW,
Bd. XIV, S. 506.
Ernst Federn (1988): Die Emigration von
Sigmund und Anna Freud. Eine Fallstudie. In: F. Stadler (Hg.):
Vertriebene Vernunft II. Emigration und Exil österreichischer
Wissenschaft 1930-1940. München Wien 1988, S. 248. Siehe vertiefend zu
Ernst Federn: Roland Kaufhold (2001): Bettelheim, Ekstein, Federn:
Impulse für die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen
(Psychosozial-Verlag)
www.suesske.de/kaufhold-1.htm;
www.hagalil.com/archiv/2007/08/federn.htm
Vgl. Bernd Nitzschke (1996): Wir und der Tod. Essays über Sigmund Freuds
Leben und Werk. Göttingen (Sammlung Vandenhoeck); Peter Schneider
(1999): Sigmund Freud. München (dtv).
Gay, a.a.O., S. 29.
Gay a.a.O., S. 20
Ernest Jones (1984): Sigmund Freud, Bd. 2, S. 139.
Freud (1926), in: Nitzschke, a.a.O., S. 118; s. auch Gay, a.a.O, S. 671.
Gay, a.a.O., S. 234.
Siehe hierzu vertiefend: Susann Heenen-Wolff (1987): "Wenn ich Oberhuber
hieße ... " Die Freudsche Psychoanalyse zwischen Assimilation und
Antisemitismus. Frankfurt am Main (Nexus).
Kaufhold (2001), S. 45, 268.
Ludger M. Hermanns (1982): John F. Rittmeister und C. G. Jung. In: H.-M.
Lohmann (Hg.) (1985): Psychoanalyse und Nationalsozialismus. Beiträge
zur Bearbeitung eines unbewältigten Traumas. Frankfurt/M. (Fischer TB),
137-145. Siehe auch die dort wiedergegebenen eindrücklichen
Stellungnahmen von Thomas Mann (1935) sowie von Ernst Bloch zu Jung;
letzterer bezeichnete Jung expressis verbis als "psychoanalytischen
Faschisten".
Gay a.a.O., S. 504 und S. 671.
Roland Kaufhold (2003): Spurensuche zur Geschichte der die USA
emigrierten Wiener Psychoanalytischen Pädagogen, in: Luzifer-Amor, 16.
Jg., Heft 31, 2003, S. 37-69.
Nitzschke a.a.O., S. 50.
Ruth Kloocke (2002): Mosche Wulff. Zur Geschichte der Psychoanalyse in
Rußland und Israel, Tübingen (edition diskord).
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit möchten wir nennen: Maria und Martin
Bergmann, Bruno Bettelheim, Yael Danieli, Nathan Durst, Ernst Federn, M.
Jucovy, Hans Keilson, Judith S. Kestenberg, Hillel Klein, R. Moses,
Yehuda Nir, Martin Wangh und Zvi Lothane. Als Literatur möchten wir
nennen: M. S. Bergman; Jucovy, M. E.; Kestenberg, J. S. (Hg.) (1982):
Kinder der Opfer, Kinder der Täter. Psychoanalyse und Holocaust.
Frankfurt M. (Fischer).
Roland Kaufhold (2008): Siegfried Bernfeld - Psychoanalytiker, Zionist,
Pädagoge. Vor 55 Jahren starb Siegfried Bernfeld, in: TRIBÜNE, 47. Jg.,
Nr. 185 (H. 1/2008), S.178-188.
Ernst L. Freud (Hg.) (1984): Sigmund Freud - Arnold Zweig: Briefwechsel.
Frankfurt/M. (Fischer TB), S. 134f.
Siehe vorhergehende Fußnote sowie: Manuel Wiznitzer: Arnold Zweig: Das
Leben eines deutsch-jüdischen Schriftstellers, Frankfurt/M.; Wilhelm von
Sternburg (1998): Um Deutschland geht es uns. Arnold Zweig. Die
Biographie, Berlin (Aufbau).
Sigmund Freud - Arnold Zweig: Briefwechsel, a.a.O., S. 49.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 54.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 56.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 66-68.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 70.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 76f.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 84.
Siehe hierzu: Bernd Nitzschke (1996): "Freud, der Mann Moses und der
Antisemitismus" sowie "Judenhaß als Modernitätshaß. Über Freuds Studie
'Der Mann Moses und die monotheistische Religion' (1937/39), beide in:
Nitzschke (1996), a.a.O,, S. 40-53, S. 149-183.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 102.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 120.
Gay a.a.O., S. 686.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 130f.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 132.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 142f.
Sigmund Freud - Arnold Zweig, a.a.O., S. 163.
Siehe Roland Kaufhold (2001): Bettelheim, Ekstein, Federn: Impulse für
die psychoanalytisch-pädagogische Bewegung. Gießen (Psychosozial-Verlag)
www.suesske.de/kaufhold-1.htm; ders. (2003): Spurensuche zur Geschichte
der die USA emigrierten Wiener Psychoanalytischen Pädagogen, in:
Luzifer-Amor: Geschichte der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung (Hg.
Thomas Aichhorn), 16. Jg., Heft 31 (1/2003), S. 37-69; Hans-Jürgen
Wirth/Trin Haland-Wirth (2003): Emigration, Biographie und
Psychoanalyse. Emigrierte PsychoanalytikerInnen in Amerika. In: Kaufhold
et. al. (Hg.) (2003), "So können sie nicht leben" - Bruno Bettelheim
(1903-1990), Zeitschrift für politische Psychologie Heft 1-3/2003, S.
91-120; Hans-Jürgen Wirth (2002): Narzissmus und Macht. Zur
Psychoanalyse seelischer Störungen, Gießen (Psychosozial-Verlag)
www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=1044&ojid...
Kaufhold 2001, a.a.O.
Siehe die Internetseite www.Edithbuxbaum.com
Vgl. Kaufhold (2001), a.a.O., Fisher, D. J. (2003): Psychoanalytische
Kulturkritik und die Seele des Menschen. Essays über Bruno Bettelheim.
Gießen (Psychosozial-Verlag).
www.suesske.de/buch_fisher.htm
Roland Kaufhold (Hg.) (1999): Ernst Federn - Versuche zur Psychologie
des Terrors. Gießen (Psychosozial-Verlag).
http://www.suesske.de/kaufhold-2.htm
Karl Fallend/Bernd Nitzschke (Hg.) (2002): Der "Fall" Wilhelm Reich.
Beiträge zum Verhältnis von Psychoanalyse und Politik, Gießen
(Psychosozial-Verlag).
http://www.psychosozial-verlag.de/psychosozial/details.php?p_id=147&ojid=03aa2b6b80c1dbbf0c5953b5a6ebd4b1
Gay, a.a.O., S. 660.
Gay, a.a.O., S. 666.
Gay, a.a.O., S. 668.
Gay, a.a.O., S. 694.
Freud - Zweig, a.a.O., S. 169f.
Gay, a.a.O., S. 709f.
[50]
Gay, a.a.O., S. 707. |