|
Jüdische Gemeinde Duisburg:
Fest des jüdischen Buches
Von Reinhardt Finck
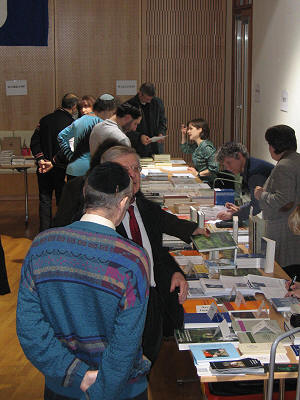 Das
moderne Jüdische Gemeindehaus in Duisburg, am aufstrebenden Innenhafen, Ende
März 2006: bis zu 300 Besucher treffen sich auf dem "Fest des jüdischen
Buches", einer regionalen Buchmesse mit vielen Lesungen und Vorträgen.
Zunächst von örtlicher Bedeutung für die Gemeinde
Duisburg-Mülheim-Oberhausen, die Gastgeberin, haben die renommierten Autoren
dieses Tages Besucher auch von weit her angelockt. Die Sprachen des
Buchfestes: Deutsch, Russisch, Jiddisch und auch etwas Französisch kommt
vor. Das
moderne Jüdische Gemeindehaus in Duisburg, am aufstrebenden Innenhafen, Ende
März 2006: bis zu 300 Besucher treffen sich auf dem "Fest des jüdischen
Buches", einer regionalen Buchmesse mit vielen Lesungen und Vorträgen.
Zunächst von örtlicher Bedeutung für die Gemeinde
Duisburg-Mülheim-Oberhausen, die Gastgeberin, haben die renommierten Autoren
dieses Tages Besucher auch von weit her angelockt. Die Sprachen des
Buchfestes: Deutsch, Russisch, Jiddisch und auch etwas Französisch kommt
vor.
In mehreren Räumen gleichzeitig läuft das Programm, im
Hauptsaal finden sich viele Buchstände von Verlagen mit jüdischem
Schwerpunkt, auch die Else Lasker-Schüler-Gesellschaft aus Wuppertal ist
vertreten, und hier finden die großen Lesungen statt. Das ganze Programm
wurde unterstützt vom American Joint Distribution Comittee, einzelne
Programmpunkte auch von der Deutsch-Französischen und von der
Deutsch-Israelischen Gesellschaft Duisburg: eine fruchtbare Zusammenarbeit.
In der Begrüßung betont Liliana Ruth Feierstein
die Bedeutung des Geschriebenen in der jüdischen Kultur. Jeder Mensch kann
ein Schreiber sein, das Judentum ist auf die Schrift und um Texte herum
gebaut. "Der Text ist das Zuhause und jeder Kommentar ein Zurückkehren", mit
den Worten des Kulturwissenschaftlers George Steiner.
Der Tag begann mit einem Vortrag von Elisa Klapheck: "So bin ich Rabbinerin
geworden." Im Laufe des Tages Lesungen der Schriftsteller Vladimir Vertlib
und Lena Gorelik, die beide aus Russland stammen und Deutsch schreiben, von
Edgar Hilsenrath, sicher der bekannteste Schriftsteller dieses Tages, und
von Leslie Kaplan, die eigens aus Paris gekommen war. Sie wurde, da
französisch lesend, von ihrer Übersetzerin deutsch unterstützt. So waren im
ganzen drei Generationen von Autoren jüdischer Herkunft anwesend: Kaplan und
Hilsenrath als ältere, Vertlib als mittlere und Gorelik als jüngste
Generation (sie ist 25 Jahre alt).
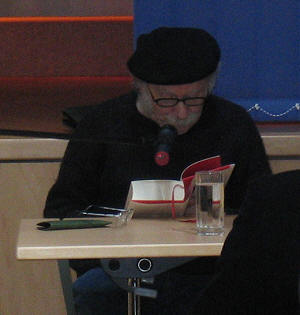 Vertlib
ist bei uns und in Österreich, wo er lebt, sehr bekannt, er hat inzwischen
mehrere Bücher veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, "Mein erster Mörder",
enthält drei Erzählungen. Die Titelgeschichte leitet aus der Vergangenheit
des Vaters als Nazi-Soldat in der Sowjetunion die spätere Mordtat seines
Sohnes ab. Die Gewalt scheint ihn zu entlasten. Die Erzählungen spielen sehr
mit Wiener Kolorit. Edgar Hilsenrath (Bild rechts) ist weltweit bekannt,
seine Bücher haben oft einen ironischen Unterton. Es wurde aus "Nacht"
gelesen, einem Roman aus der Zeit der Nazi-Besetzung Galiziens. Er
beschreibt die Beziehungen der jüdischen Opfer in ihrer Bedrängnis
untereinander. Vertlib
ist bei uns und in Österreich, wo er lebt, sehr bekannt, er hat inzwischen
mehrere Bücher veröffentlicht. Sein jüngstes Werk, "Mein erster Mörder",
enthält drei Erzählungen. Die Titelgeschichte leitet aus der Vergangenheit
des Vaters als Nazi-Soldat in der Sowjetunion die spätere Mordtat seines
Sohnes ab. Die Gewalt scheint ihn zu entlasten. Die Erzählungen spielen sehr
mit Wiener Kolorit. Edgar Hilsenrath (Bild rechts) ist weltweit bekannt,
seine Bücher haben oft einen ironischen Unterton. Es wurde aus "Nacht"
gelesen, einem Roman aus der Zeit der Nazi-Besetzung Galiziens. Er
beschreibt die Beziehungen der jüdischen Opfer in ihrer Bedrängnis
untereinander.
Leslie Kaplan ist in Frankreich gut bekannt, bei uns waren ihre bisher
übersetzten fünf Bücher eher etwas für Eingeweihte. Mit dem Buch "Fever", es
trägt wie das Original einen englischen Titel, könnte sich das ändern, das
Buch erhielt bereits 2006 einen Literaturpreis für die deutsche Übersetzung
(durch Sonja Finck) und für seine Bedeutung im deutsch-französischen
Zusammenhang. Auch hier passiert ein Mord, zwei Abiturienten sind die Täter,
und die Ursache sind verdrängte Tatsachen aus der Nazizeit: der eine,
jüdische Großvater verlor seine ganze Familie in Galizien, der andere
arbeitete für die deutsche Besatzungsmacht in Frankreich, er war wohl an
Judendeportationen beteiligt. Beide schweigen über Einzelheiten. Am Beispiel
der beiden Jungen, die im Laufe der Zeit immer ängstlicher und verrückter
werden, zeigt Kaplan das seelische Nachwirken der Shoa, diskutiert aber
zugleich die philosophische Frage nach der Willensfreiheit. Sie berichtet
auch über einige Fälle aus dem Papon-Prozess 1997/98, gegen einen führenden
Kollaborateur, und holt so die Geschichten von Opfern des Naziterrors ans
Licht der Gegenwart.

Vladimir Vertlib und Lena Gorelik
Lena Gorelik las aus "Meine weißen Nächte", ihrem Roman-Erstling, daneben
sind häufig Kurzgeschichten von ihr in der Presse zu lesen. Ihre Geschichten
kreisen um die Änderungen in den inneren Familienbeziehungen durch die
Übersiedlung von Russland nach Deutschland. Immer wieder stellt sie sich die
Frage: Bin ich Russsin? Bin ich Deutsche? Bin ich Jüdin? Es sind amüsante
Episoden aus dem Zusammenprall von Kulturen, besonders unter jungen Leuten.
Gorelik scheut keine Tabus, ihre Sprache ist frisch, direkt und angenehm zu
lesen.
Abschließend lasen Tamara Zhirmunskaja die Geschichte "Ich hab’ mich in
einen Juden verliebt" und Pavel Sirkes aus "Wieder donnert das Exodushorn",
zweisprachig, sowohl deutsch als auch russisch.
Das Besondere am Buchfest war die offene Atmosphäre, in der sehr
verschiedene Besuchergruppen auf ihre Kosten kamen. Neben den erwähnten
Lesungen aus literarischen Werken stellte Hajo Jahn Else Lasker-Schülers
"Das Lied der Emigranten" vor, und in der Bibliothek unterrichteten
verschiedene Rabbiner über den jüdischen Glauben, teils in Russisch. Diese
Veranstaltungen waren bisweilen überfüllt, es gibt ein Bedürfnis, die
jüdische Glaubenslehre neu kennen zu lernen und zu diskutieren.
In anderen Räumen haben bekannte Literaturwissenschaftler (u.a. Prof. Dr.
Daniel Hoffmann, Dr. Roland Gruschka) jüdische Literatur untersucht und
kommentiert. Die Texte wurden somit aus verschiedener Perspektive
betrachtet, auf eine rabbinische, literarische oder literaturkritische
Weise, also in einer spezifisch jüdischen Art des Lesens ausgelegt.
Im Ganzen war das Buchfest eine sehr gelungene Veranstaltung, die man gerne
in etwas größeren Räumlichkeiten wiederholt sähe.
Grußwort Liliana Ruth Feierstein
hagalil.com 27-04-2006 |