|
Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken
Kibbuzim im Landkreis Pegnitz:
In Franken für Israel üben
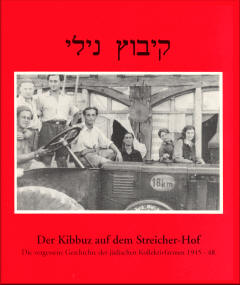 Ausbildungs-Kibbuzim
für mehrere hundert Juden gab es während der Nachkriegszeit im
Landkreis Pegnitz Ausbildungs-Kibbuzim
für mehrere hundert Juden gab es während der Nachkriegszeit im
Landkreis Pegnitz
von Jim G. Tobias
Abseits der vielbefahrenen Autobahn nach
Berlin, in der Nähe von Pegnitz (Landkreis Bayreuth), gibt es noch
ein Eckchen unberührtes ländliches Franken. Hierher verirren sich
nur wenige gestresste Grossstädter. Die friedliche Landschaft hat
keine touristischen "Highlights” zu bieten. Eingebettet zwischen
Feldern und Wiesen liegen kleine bäuerlich geprägte Dörfer wie
Prebitz, Voita, Losau oder Windischenlaibach.
Dass diese Ortschaften in der Nachkriegszeit
mehrheitlich von Juden bewohnt waren, ist kaum noch im öffentlichen
Bewusstsein. Nur noch die ältere Generation kann sich wage erinnern.
Für knapp zwei Jahre - zwischen 1946 und Ende 1947 - lebten hier
mehre hundert Juden, fünfmal mehr als die Israelitische
Kultusgemeinde Bayreuth heute an Mitgliedern zählt.
Unmittelbar nachdem Krieg wurden von den
amerikanischen Militärbehörden eine Reihe von Bauernhöfen
beschlagnahmt, um auf ihnen landwirtschaftliche Ausbildungszentren
für ehemalige jüdische KZ Häftlinge einzurichten. Auf diesen Gütern
sollten die Überlebenden der Shoa in Ackerbau und Viehzucht
unterrichtet werden, um dann nach Palästina zu fahren und am Aufbau
von Erez Israel mitzuwirken.
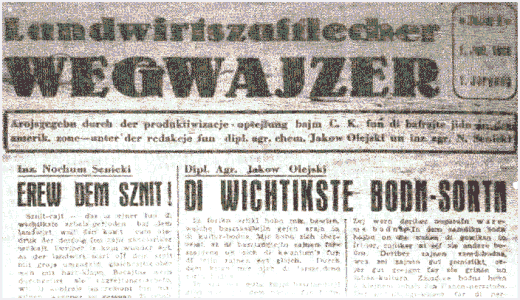
Bei Recherchen im YIVO-Institute for Jewish
Research, New York, stiess ich auf eine Aufstellung des AJDC
(American Jewish Joint Distribution Committee) über sogenannte
"Hachscharoth” (hebr. Vorbereitung, hier Trainings-Kibbuzim) in der
amerikanischen Besatzungszone. Es ist zwar in Fachkreisen bekannt,
dass mehrere DP (displaced person)-Lager in Form von Kibbuzim
existierten, doch Unterlagen oder sogar noch erhaltene sichtbare
Spuren gibt es in Deutschland kaum mehr.
Ausgestattet mit der Lageraufstellung aus dem
Institut und einer Landkarte, machte ich mich auf die Suche nach den
Relikten der letzten fränkischen "Landjuden". Erkundigungen bei der
örtlichen Bevölkerung stiessen anfänglich auf eine Mauer des
Schweigens. Erst auf beharrliches Nachfragen konnte der ein oder
andere Dorfbewohner sich noch an die Zeit nach dem Krieg erinnern.
"Ja, der Nachbarshof war von Juden beschlagnahmt” sagte eine alte
Landwirtin.
Der Hinweis eines etwa 30-jährigen Neubürgers
brachte schliesslich den entscheidenden Tip. "Im Prebitzer Wirtshaus
waren früher Juden untergebracht”, sagte der Dorfbewohner. Er
berichte, dass im jetzigen Wohnzimmer des Wirtes an der Decke noch
ein "Judenstern” zu erkennen sei. Doch das könne man nur noch
erahnen, weil schon mehrere Schichten Farbe das Symbol abdecken
würden. Das wäre alles was er wüsste, aber ich solle doch noch den
Nachbarn fragen, riet mir der junge Mann.
Schon von weitem sah man an einem Nebengebäude des
gegenüberliegenden Gehöftes eine Inschrift. Hebräische Lettern
zieren den Türstock eines oberfränkischen Bauernhofs! Das ist der
Beweis für die Existenz der früheren jüdischen Bewohner. Die
Buchstaben in der ersten Reihen waren deutlich zu entziffern. Mem,
Chet, Samech und Nun: Machsan, zu deutsch Magazin oder Lagerraum.
Die zweite Zeile ist leider nicht mehr zu entschlüsseln.
Anfänglich war der Besitzer des Hofes - ein Mann
um die siebzig - weniger auskunftswillig. Er konnte die "ungerechte”
Vorgehensweise der Amerikaner, die den Hof beschlagnahmten, immer
nocht nicht verstehen. "Von März 1946 bis September 1947 waren wir
besetzt”, empörte sich der Bauer und fügte hinzu "und nur weil mein
Vater Kreisbauernführer bei den Nazis war”. Der Gutsbesitzer
beruhigte sich jedoch rasch wieder und wurde gesprächiger. Nach
seiner Erinnerung kamen die Juden zumeist aus Polen oder Russland.
Er konnte zwar mit Ihnen reden, aber untereinander sprachen sie so
ein "komisch verdrehtes Deutsch” berichtete der Landwirt. Er wusste
auch noch wer seinerzeit, mit Unterstützung der amerikanischen
Militärpolizei, seinem Vater den Hof "wegnahm”. "Der lebt noch, das
war der Gothart, Josef”, sagte der Bauer sichtlich erregt.
Der Vorsitzende der Bayreuther IKG Josef Gothart
war für circa zwei Jahre - bis Ende 1947 - als Treuhänder für die
beschlagnahmten landwirtschaft-lichen Güter im ehemaligen Bezirk
Pegnitz eingesetzt. In einem Gespräch bestätigte Josef Gothart, dass
er seinerzeit diese Bauernhöfe verwaltete und öfters bei den
Beschlagnahmungen anwesend war. Als Grundlage für die vorübergehende
Enteignung galt ein Gesetz der amerikanischen Militärregierung. Die
Immobilien von aktiven Nazis mit Funktion sollten den jüdischen
Überlebenden als Ausbildungsstätte und Wohnraum zur Verfügung
gestellt werden.
Kein Zuverlässigerer konnte für diesen Job
gefunden werden. Josef Gothart war aktiver Ghettokämpfer in
Warschau, und überlebte mit viel Glück mehrere
nationalsozialistische Konzentrationslager. In den Augen der
verantwortlichen Militärs eine integere Person, die nicht in
Verdacht stand mit den Deutschen zu paktieren. Für den ehemalige
Treuhänder - der zeitweise sechs landwirtschaftliche Trainingscamps
betreute - ist die Vergangenheit immer noch präsent. Er berichtet,
dass die DPs, die überwiegend aus Polen oder Russland stammten, in
vielen Bauernhöfen kleine Synagogen einrichteten.
Zumeist waren das nur Betstuben, doch man hatte
dort eine Thora eingebracht und so konnten sich die Kibbuzniks zum
Gebet versammeln. "In Prebitz hatten wir zwei Kibbuzim”, erinnernt
sich Gothart. "Der eine war ein religiöser und hiess: "Kibbuz Dati
Bnei Akiba”. Hier lebten die frommen Juden, die bei den Gebeten
Teffilin anlegten und Tallit trugen”, sagte der Vorsitzende der
israelitischen Kultusgemeinde.
Die UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation
Administration) stellte Nahrungsmittel, Kleidung und lebenswichtige
Medikamente. Jede Woche kam ein Lastwagen der internationalen
Hilfsorganisation und belieferte die Kibbuzim. Aber auch die
deutschen Behörden waren zur Unterstützung der DPs verpflichtet.
Alle Bewohner der "Hachscharoth” waren jedoch nur
von einem Gedanken beseelt: Endlich nach Erez Israel zu reisen. Doch
vorher mussten sie die nötigen Fertigkeiten in Ackerbau und
Viehzucht erlernen. Die Jewish Agency schickte Lehrer, die hebräisch
unterrichteten, denn niemand konnte Iwrit. Die gemeinsame
Umgangssprache war jiddisch. Zusammen mit den ortsansässigen Bauern
- und unter Anleitung von jüdischen Vorarbeitern - bestellten die
zukünftigen Palästina Siedler die Felder. Wenn eine Gruppe das
nötige "Know-how” erworben hatte, machten sich die Mäner und Frauen
auf den beschwerlichen Weg. Die "Alija Beth”, die illegale
Einwanderung ins damals noch britisch verwaltete Mandatsgebiet,
musste unter grosser Geheimhaltung vonstatten gehen. Für Tausende
jüdischer Überlebende des Holocaust begann in einer der vielen
landwirtschaftlich ausgerichteten DP-Camps der Traum vom eigenen
Staat Wirklichkeit zu werden. Die "Chawerim” (hebr. Genossen) der
etwa 20 Kibbuzim in der frankischen Region haben gewiss einen
grossen Teil zum Aufbau des Landes Israel beigesteuert.
Über diese "Hachscharoth”, liegen kaum gesicherte
Erkenntnisse oder gar Publikationen vor. Ein weitgehend unbekanntes
Kapitel der deutsch-jüdischen Geschichte wartet darauf, entdeckt zu
werden. |