|
Jüdische DPs in Mittel und Oberfranken
Letzte Stationen in Europa:
Camps für Holocaust Überlebende in Westmittelfranken
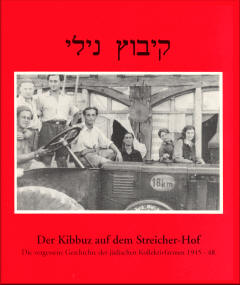 Kibbuz
im Wildbad Burgbernheim und Windsheim als Stationen vor der
Emigration Kibbuz
im Wildbad Burgbernheim und Windsheim als Stationen vor der
Emigration
von Jim G. Tobias
Inmitten eines dichten Waldgebietes, unweit der
Marktgemeinde Burgbernheim (Kreis Neustadt Aisch / Bad Windsheim)
lieg das Wildbad mit seinen Heilquellen. Ein Ort der auf eine lange
Geschichte zurückblickt. Bereits im 12. Jahrhundert waren die
Quellen bekannt. Kaiser Karl IV. wie auch die Würzburger Bischöfe
schätzten das wohltuende und gesundheitsfördernde Wasser. Im Jahre
1487 liess Markgraf Albrecht zu Brandenburg hier ein Gästehaus und
eine Badestube einrichten. Über viele Jahrhunderte diente das Kurbad
der Erholung und Zerstreuung. Seit 1980 befindet sich dort der
"Waldgasthof Wildbad".
Dass die beiden mächtigen Fachwerkhäuser und das
angrenzende Jagdschlösschen in der Nachkriegszeit von jüdischen
Überlebenden des Holocaust bewohnt waren, ist gänzlich unbekannt.
Unmittelbar nach Kriegsende hatte die amerikanische Militärregierung
die Gebäude beschlagnahmt und im Wildbad ein Camp für jüdisches DPs,
Displaced Persons (zu deutsch: verschleppte entwurzelte Menschen)
eingerichtet. Für kurze Zeit verwandelte sich das Wildbad in eine
landwirtschaftliche Kollektivsiedlung.
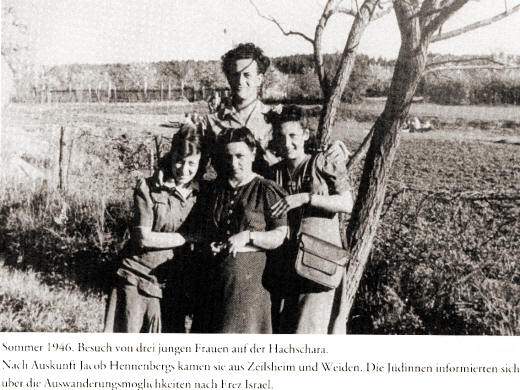
Nichts deutet heute mehr auf den ehemaligen Trainingskibbuz hin. Die
Spuren sind verwischt, die Geschichte vergessen, viele Zeitzeugen
sind längst tot. Doch nicht nur in Wildbad waren jüdische DPs
untergebracht. Ein grosses Camp mit über 2000 Bewohnern existierte
von 1946 bis 1949 in Bad Windsheim, in der ehemaligen
Hermann-Göring-Siedlung. Auch in der Ansbacher Bleidornkaserne
bestand ein Lager, in dem einige hundert DPs lebten. Neben den
Massenlagern gab es etwa 20 Hachscharoth (hebr. Vorbereitung)
genannte Kibbuzim in den Bezirken Mittel- und Oberfranken. Beispiele
sind der Pleikershof bei Cadolzburg und die jüdischen Bauernschulen
im Raum Prebitz (Kreis Bayreuth).
In den grossen Camps kam es zu einer Wiedergeburt
des jüdischen Lebens. Es wurden Talmud-Thora Schulen gegründet,
koschere Küchen eingerichtet und sogar eigene Fussballvereine ins
Leben gerufen. Über all diese Aktivitäten berichtete die, vom
Regionalkomitee der befreiten Juden in Bamberg verlegte,
jiddisch-sprachige Zeitung "Undzer Wort".
Bislang liess sich die Existenz der fränkischen
DP-Camps nur anhand von Listen des American Joint Distribution
Committee (AJDC), einer amerikanisch-jüdischen Hilfsorganisation,
nachweisen. Leider sind in diesen Aufzeichnungen keine konkreten
Ortsangaben verzeichnet. Dank der im New Yorker YIVO -Institute for
Jewish Research archivierten Wochenzeitung "Undzer Wort" können nun
die jüdischen Lager und Kibbuzim lokalisiert werden. In der Ausgabe
vom 23. August 1946 erscheint unter der Rubrik "Fun Rajon Lebn"
folgende Notiz: "(...) Heute zählt das Lager Windsheim etwa 2.800
jüdische Bewohner. Dazu gehören 232 Juden des Kibbuz "Aguda", der
sich etwa (?) Kilometer von Windsheim entfernt in der Siedlung
Wildbad befindet". Vorher war über diese Einrichtung - ausser dem
Vermerk "Agricultural Trainings Farm Wildbad" in einer AJDC-Tabelle
- nichts bekannt. Nachforschungen bei der Gemeinde Burgbernheim, zu
diesem Ort gehört das Wildbad, brachten endgültige Klarheit. Im
Archiv findet sich ein schmaler Band mit Unterlagen zur
Beschlagnahmung des Wildbades. Neben dem "Besetzungsbefehl" sind
einige Notizen des damaligen Bürgermeisters vorhanden. Am Nachmittag
des 25.6.1946 war US-Major Charlier im Burgbernheimer Rathaus
erschienen und hatte die Räumung der bis dato von Deutschen
bewohnten Häuser angeordnet. Den Bewohnern blieb vier Tage Zeit, die
Gebäude zu verlassen. Möbel, Wäsche und sonstiges persönliche
Eigentum durfte mitgenommen werden.
Etwas über ein Jahr lebten und arbeiteten bis zu
200 jüdische Überlebende des Holocaust im Wildbad. Hier hatten sie
die Möglichkeiten, wieder zu Kräften zu kommen und sich auf ihr
neues Leben im noch zu schaffenden eigenen Staat vorzubereiten.
Hebräische Sprachkurse und landwirtschaftliche Unterweisungen
bestimmten den Alltag auf der Kollektivfarm. Kaum einer - der
vorwiegend aus dem Osten stammenden - Juden hatte vor der Shoa
Berührung mit Ackerbau und Viehzucht. Aber in Palästina warteten
unfruchtbare Landstriche darauf in Äcker umgewandelt zu werden. Die
zahlreichen Kibbuzim in Franken waren dafür die idealen
Trainingscamps.
Neben dem Wildbad existierte auch im Ansbacher
Vorort Strüth ein jüdisches Ausbildungslager. Vom Januar 1946 bis
zum April 1949 war in dem Gebäude der ehemaligen Lungenklinik ein
Kindercamp untergebracht. Dort warteten mehrere hundert Kinder und
Jugendliche - organisiert in zwei Kibbuzim - ungeduldig darauf,
endlich den blutgetränkten deutschen Boden verlassen zu können.
Über die zahlreichen DP-Camps in Ober- und
Mittelfranken, die neben ihrem konkreten Ausbildungsauftrag auch
eine Wartesaalfunktion für die an Leib und Seele gequälten Menschen
hatten, liegen kaum Erkenntnisse vor. Eins ist jedoch sicher: Die
fränkischen Kibbuzniks gehörten zu den Wegbereitern des Staates
Israel.
|