|
Prag, 27. Mai 1942, 10.35 Uhr:
Operation Anthropoid - Das Heydrich Attentat
Von M. Reisinger
In Kooperation mit dem Militärhistorischen Instituts Prag
zeigt das Deutsche Technikmuseum Berlin eine Ausstellung über das Attentat
auf Reinhard Heydrich in Prag. Die Sonderausstellung, die über zehn
Themenbereiche umfasst, dokumentiert, wer die Attentäter waren, was sie
bewegte, von wem sie beauftragt waren, wie ihre Aktion ablief und
schließlich welche Folgen dieses Attentat für die tschechoslowakische
Bevölkerung hatte.

Oben: Reinhard Heydrichs Amtsantritt auf dem Prager
Hradschin am 27. September 1941 als Stellvertretender Reichsprotektor
von Böhmen und Mähren. Rechts neben Heydrich Staatssekretär Karl Frank.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag
Rechts: Über das "Heydrich-Attentat" vom 27. Mai 1942 berichtete die
Presse im Protektorat Böhmen und Mähren in aktuellen Sonderausgaben. Die
Nachricht vom Tod Heydrichs wurde von der Bevölkerung im Protektorat
Böhmen und Mähren als Signal zum Widerstand verstanden.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag |
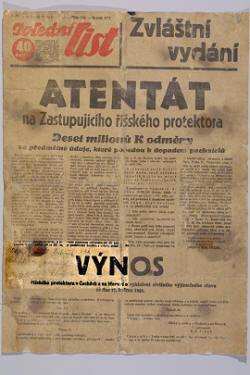 |
Am Mittwoch, den 27. Mai 1942, gegen 10.35 Uhr, wurde der
Wagen Reinhard Heydrichs in einer Haarnadelkurve des Prager Vororts Liben
von zwei bewaffneten Männern attackiert. Wenige Tage später verstarb
Heydrich im Krankenhaus an den Verletzungen, die er sich bei dem Attentat
zuzog. Mit diesem erfolgreichen Anschlag auf einen der maßgeblichen
Vorbereiter des Holocaust und Schlüsselfigur des Staatsterrors im Dritten
Reich war sowohl Mythos als auch Bann der Unverwundbarkeit der
NS-Führungsriege gebrochen. Dieser Umstand muss für den Widerstand gegen die
Nazityrannei von großer Bedeutung gewesen sein. Mehrere Attentate auf Hitler
schlugen fehl und Heydrich unterließ während seiner Prager Zeit nichts, um
den tschechoslowakischen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mit aller
Härte zu bekämpfen.

Die Aufnahme aus einem Untersuchungsprotokoll der Polizei
zeigt das von Heydrich benutzte Mercedes-Benz Kabriolett vom Typ 320 B in
der Spitzkurve der damaligen Klein-Holloschewitz-Straße im Prager Stadtteil
Liben nach dem Attentat.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag
Am Anfang der ein wenig unübersichtlichen Ausstellung steht
das für die Tschechoslowakei demütigende Münchener Abkommen vom 29.
September 1938, nach dem die sudetendeutschen Gebiete (Böhmen und Mähren) an
das Deutsche Reich abgetreten werden mussten. Die zweite Schmach für die
Menschen folgte ein knappes halbes Jahr später, als in einer
Nacht-und-Nebel-Aktion der nach Berlin gereisten Präsidenten Emil Hácha, mit
seiner Unterschrift das Ende der zweiten tschechoslowakischen Republik durch
die Besetzung der Deutschen Wehrmacht besiegelte.
Der nächste Einschnitt, der die tschechoslowakische
Exilregierung in London zum aktiven engagierten Handeln veranlasste, folgte
am 28. September 1941, als Reinhard Heydrich, auf Anordnung Adolf Hitlers,
stellvertretender Statthalter des "Protektorats Böhmen und Mähren" wurde.
Bereit 24 Stunden nach Amtseinführung wurde die neue Qualität des
nationalsozialistischen Terrors unter Heydrich im Protektorat sichtbar.
Josef Bílý und Hugo Vojta waren die ersten von zahlreichen ranghohen
Offizieren des tschechoslowakischen Widerstands, die hingerichtet wurden.
Bereits in den Jahren 1934 bis 1939 war Reinhard Heydrich als
Leiter der Sicherheitspolizei, des SD, der Geheimen Staatspolizei (Gestapo)
und später des Reichssicherheitshauptamts (RSHA) bei Regimegegnern und
Rivalen gefürchtet. Er baute ein Kontroll- und Unterdrückungssystem auf, und
wendet Einschüchterung, Erpressung, Folter und Mord als Terrormaßnahmen an.
Bei der Verfolgung von Jüdinnen und Juden in Europa nahm
Heydrich eine Schlüsselstellung ein. So richtete er in Wien die
Zentralstelle zur Verfolgung und Ausweisung von Juden ein, organisierte im
besetzten Polen die Einrichtung jüdischer Ghettos und überwachte die
Deportation der jüdischen Bevölkerung aus Deutschland und Österreich in
diese Ghettos. In einem "Bestellungsschreiben" Görings vom 31. Juli 1941
wurde Heydrich beauftragt, "einen Gesamtentwurf über die organisatorischen,
sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten
E.[ndlösung] der Judenfrage vorzulegen". Die Wannseekonferenz am 20. Januar
1942, auf der Fragen zur Koordination des bereits eingeleiteten Massenmord
an den europäischen Juden besprochen wurden, diente Heydrich dazu, sich die
Federführung in dieser Sache endgültig zu sichern. Die Ermordung der
europäischen Juden war damit Sache von Polizei und SS.
Einige Besucherinnen und Besucher der Ausstellung werden
erstaunt fragen, warum dort eine von zwei Kopien der tschechischen Krone
gezeigt wird. Für Michal Burian, stellvertretender Direktor des
Militärhistorischen Instituts Prag, spielt diese Kostbarkeit eine wichtige
Rolle in der Ausstellung. Als Reinhard Heydrich am 19. November 1941 vom
Protektoratspräsidenten Emil Hácha vier Schlüssel zur Kronjuwelenkammer in
einem Demütigungsakt überreicht bekam, war, so die Prophezeiungen, Heydrichs
Schicksal besiegelt. Denn laut mittelalterlicher Legende wird derjenige, der
sich zu Unrecht der Krone bemächtigt, innerhalb eines Jahres zu Tode kommen.
Wer waren aber diejenigen, die diese Legende wahr werden
ließen? Es waren natürlich keine Propheten oder Hüter der Kronjuwelen,
sondern die in Großbritannien speziell trainierten tschechoslowakischen
Soldaten Josef Gabcík und Jan Kubiš. Sie waren die Helden der "Operation
Anthropoid", die fast einer antiken Tragödie mit all ihren Bestandteilen,
wie Tapferkeit, Liebe, Verrat und Tod gleichkam.
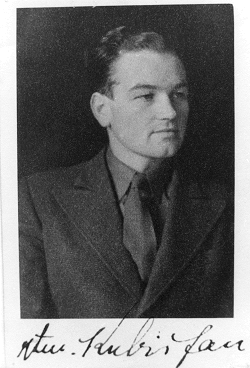
Jan Kubiš in Zivil. Der Tscheche führte als Mitglied der
tschechoslowakischen Exilarmee zusammen mit Josef Gabcík am 27. Mai 1942
in Prag das Attentat auf den Stellvertretenden Reichsprotektor und
Gestapochef Reinhard Heydrich aus.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag |
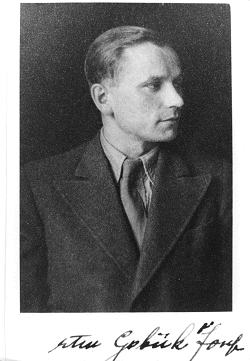
Josef Gabcík in Zivil. Der Slowake führte als Mitglied
der tschechoslowakischen Exilarmee zusammen mit Jan Kubiš am 27. Mai
1942 in Prag das Attentat auf den Stellvertretenden Reichsprotektor und
Gestapochef Reinhard Heydrich aus.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag |
Eines der zentralen Objekte dieser Operation und der
Ausstellung ist Heydrichs offener Mercedes-Benz Typ 320 B. Deutlich und
durch Exposes abgesichert sind heute noch die Spuren der Beschädigung über
dem Trittbrett zu sehen, wo die Handgranate, die Jan Kubiš gegen den Wagen
schleuderte, ein Loch in die Karosserieaußenwand riss. Durch
Granatensplitter und Teile der Sitzpolsterung an der Milz verletzt, verstarb
Reinhard Heydrich am 4. Juni 1942 an Blutvergiftung im Krankenhaus.
Trotz der Vorbereitungszeit von einem halben Jahr, verlief
das Attentat nicht so, wie es von Kubiš und Gabcík geplant war. Als Josef
Gabcík seine Maschinenpistole auf Heydrich richtete und abdrückte, passierte
nichts. Hatte er etwa vergessen, seine Waffe zu entsichern? Diese Frage wird
auch nach Ausstellungsrundgang offen bleiben müssen. Jedenfalls machte
Heydrich den Fehler seinen Fahrer zum Anhalten des Fahrzeugs aufzufordern.
Dies gab Jan Kubiš nun die Gelegenheit eine seiner Handgranaten gegen das
Fahrzeug zu schleudern. Auf der Flucht ließen Kubiš und Gabcík einige
Gegenstände zurück, mit denen die Gestapo erfolglos nach den Attentäter
fahndete und die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind.
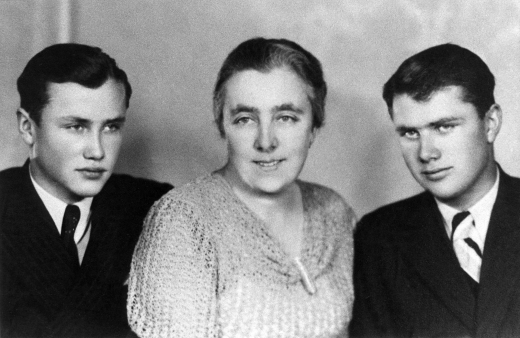
Marie Moracová mit ihren Söhnen Vlastimil (links) und
Miroslav (rechts). Die Wohnung der
Moracovás war der Hauptzufluchtsort der Fallschirmspringer in Prag. Nach
ihrer Verhaftung
durch die Gestapo beging Marie Moracová am 17. Juni 1942 Selbstmord. Ihr
Sohn Vastimil
und ihr Mann Alois wurden am 24. Oktober 1942 im Konzentrationslager
Mauthausen
hingerichtet. Ihr zweiter Sohn Miroslav diente als Pilot der
tschechoslowakischen Exilarmee in
England. Er starb am 7. Juni 1944 bei einem Flugzeugabsturz.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag
Das NS-Regime reagierte auf das Attentat mit einem Rache- und
Terrorfeldzug gegen die Bevölkerung im Protektorat. Einen Tag nach dem
Begräbnis Heydrichs in Berlin wurde am 10. Juni 1942 das Bergarbeiterdorf
Lidice
dem Erdboden gleich gemacht. Alle 173 männlichen Einwohner im Altern von 15
und 84 Jahren wurden erschossen. Frauen und 104 Kinder wurden in
Konzentrationslager verschleppt, wo die meisten von ihnen starben. Nur 17
Kinder aus Lidice überlebten die nationalsozialistische Todesmaschinerie.

Die Bergarbeitersiedlung Lidice wurde am 10. Juni 1942, einen
Tag nach Heydrichs Begräbnis in Berlin, als Vergeltungsmaßnahme der
Nationalsozialisten dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner erschossen
oder verschleppt. Lidice ist bis heute ein Symbol für die
menschenverachtende Brutalität des NS-Regimes und den antifaschistischen
Widerstand.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag
Doch keine Folter und kein Terror half, den Tätern auf die
Spur zu kommen. Diese hielten sich währenddessen mit fünf anderen
Widerstandskämpfern in der Krypta der orthodoxen Sankt Kyrill und Methodius
Kirche in Prag versteckt. Eigentlich hätten es acht Fallschirmjäger seien
sollen, die dem nationalsozialistischen Terror erfolgreich die Stirn boten.
Karel Curda, Mitglied der Operation "Out Distance" verließ nach dem Attentat
gegen alle Absprachen Prag und fuhr zu seiner Mutter in die Nähe von Trebon.
Dem psychischen Druck des NS-Terrors nicht stand haltend, kehrte er am 16.
Juni nach Prag zurück, sagte umfangreich bei der Gestapo aus und führte so
die Häscher auf die Spur seinen Kameraden in der Kirche.
Am Morgen des 18. Junis 1942 war deren Schicksal besiegelt.
Josef Bublík, Josef Gabcík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav
Švarc und Josef Valcík führten mehr als sechs Stunden lang einen
aussichtslosen Kampf gegen eine 800-köpfige Armada von Waffen-SS und
Gestapo. Die letzten Patronen in ihren Waffen richteten die
Widerstandskämpfer gegen sich selbst. Da das Ziel der Gestapo, Heydrichs
Attentäter lebend gefangen zu nehmen, fehl schlug, rächte sich das Regime an
über 300 Familienangehörigen und Helfeshelfern. Ende 1942 und Anfang 1943
wurden sie in zwei Wellen im KZ Mauthausen ermordet.
 |

Oben: Funkstation vom Typ MARK III, mit der die
Widerstandskämpfer den Kontakt zur Militärführung in England hielten
Foto: Clemens Kirchner, DTMBLinks: Bischof
Gorazd leistete mit den Mitgliedern der orthodoxen Gemeinde St. Kyrill
und Methodius in Prag den Fallschirmjägern Hilfe, indem er ihnen
Unterschlupf gewährte. Als oberster Repräsentant der Tschechischen
Orthodoxen Kirche wurde er auf dem Exekutionsplatz in Prag-Kobylisy,
heute Gedenkstätte des antifaschistischen Widerstandes, am 4. September
1942 hingerichtet.
Foto: Militärhistorisches Institut Prag |
Persönliche Gegenstände der Widerstandskämpfer wurden von der
Gestapo in der Kathedrale zusammengesammelt und archiviert. Nach Ende des
Kalten Kriegs fanden sich diese Sachen bei einer Inventarisierung im
Militärhistorischen Institut wieder an, was das Institut dazu bewog diese
Ausstellung, zuerst in Prag 2002, zu initiieren. Durch ärztliche Protokolle,
die damals die Gestapo in der Kirche anfertigen ließ, konnten die Sachen der
jeweiligen Fallschirmjägern für die Darstellung in der Ausstellung
zugeordnet werden. Neben diesen persönlichen Exponaten zeigt die Ausstellung
auch einige Gegenständen, die Familienangehörige im Konzentrationslager
Terezín (Theresienstadt) angefertigt hatten.
Ergänzt wird der Ausstellungsrundgang, zu dem ein Katalog
leider nicht erschienen ist, durch eine 52-minütige BBC-Dokumentation in
deutscher oder englischer Sprache. Sie beschreibt Vorbereitung, Verlauf und
die Folgen des Attentats auf Heydrich, mit Originalaufnahmen und
nachgestellten Spielsequenzen.
Mit dieser Ausstellung wendet sich das Technikmuseum zum
zweiten Mal in kurzer Zeit einem Thema zu, dass so gar nicht in ein Museum
passt, in dem sich die Besucher durch die Details von Lokomotiven,
Flugzeugen oder anderen technischen Errungenschaften begeistern lassen. Vor
einigen Wochen eröffnete das Museum die Dauerausstellungen zur
"Judendeportationen mit der Deutschen Reichsbahn 1941-1945", in der u.a. 12
Berliner Schicksale, von denen nur drei überlebten, porträtiert werden.
In seiner Eröffnungsrede zur jetzigen Ausstellung betonte
Prof. Dirk Böndel, Direktor des Museums, dass Technikgeschichte nicht
losgelöst von der politischen Verantwortung betrachtet werden darf. Technik
sei in seiner Darstellung nicht nur auf reines Funktionieren zu reduzieren,
sondern müsse auch vor dem Hintergrund der Auswirkungen auf den Menschen
betrachtet werden. Diese Verbindung wolle man zukünftig vermehrt in
Ausstellungen und darüber hinaus in begleitenden Vortrags- und
Diskussionsforen in Augenschein nehmen.
Die Ausstellung ist noch bis April 2006 im
Deutschen Technikmuseum Berlin zu
sehen.
Trebbiner Str. 9
10963 Berlin-Kreuzberg
U-Bhf. Möckernbrücke oder Gleisdreieick
Öffnungszeiten: Di-Fr, 9:00-17:30 Uhr; Sa/So, 10:00-18:00 Uhr (bis April
2006)
Eintritt: 4,50 Euro; erm. 2,50 Euro
Weitere Informationen:
Sonderseite des Technikmuseums zur Ausstellung
Website des
Militärhistorischen Instituts Prag |