Tödlicher Ausgang:
Antisemitismus in Deutschland - nach 1945
Die Auerbach-Affäre
I. Teil
Von Wolfgang Kraushaar*
In kaum einem anderen Vorgang ist das Verhältnis der
Nachkriegsdeutschen zu den jüdischen Überlebenden deutlicher vor Augen
getreten als in der "Affäre Auerbach".
Ein hoher bayerischer Beamter schildert in seinen 1964
erschienenen Erinnerungen, wie er am Ende der vierziger Jahre in München
eine Demonstration beobachtet:
Eines Tages [...] hörte ich einen großen Lärm auf der
Straße. Ich ging ans Fenster und sah dort die ganze Straße angefüllt mit
einer laut schreienden Truppe marschierender Männer in Shorts, weißen
Hemden und hellblauen Krawatten mit erhobenem Arm. Ihnen wurden
Spruchbänder vorangetragen. An der Spitze und am Schluss begleitete sie
ein amerikanischer Tank. Es waren polnische Juden, displaced persons,
die zum amerikanischen Generalkonsulat zogen, um dort vor dem darin
untergebrachten britischen Konsulat gegen die Erschießung von jüdischen
Terroristen in Palästina zu protestieren [...] Der Aufzug erinnerte
stark an die Zeit, als in der Weimarer Republik die Nazis Uniformverbot
hatten und auch im Hemd und mit erhobener Hand demonstrierten.
Das Merkwürdigste aber war, dass an der Spitze ein bayerischer Beamter
marschierte, der bayerische Staatskommissar für die Betreuung der Juden,
Auerbach, eine damals sehr mächtige Persönlichkeit, vor dem die Beamten
ebenso Angst hatten wie seinerzeit vor einem nationalsozialistischen
Gauleiter.1
Diese Schilderung stammt von Friedrich Glum, dem damaligen
Ministerialdirigenten in der bayerischen Staatskanzlei.
Über das Leben Philipp Auerbachs, jener dämonisierten Figur,
die im Zentrum vieler antisemitischen Projektionen stand, ist kaum mehr als
ein dürres Skelett an Daten bekannt:2
Er wurde 1906 als Sohn des Chemikaliengroßhändlers Aaron Auerbach in Hamburg
geboren. Von 1913 bis 1922 besuchte er die
Talmud-Tora-Realschule am
Grindel, danach absolvierte er eine kaufmännische Lehre und besuchte
eine Drogisten-Fachschule.
Nach seinem Abschluß war er als Industriechemiker, Kaufmann und
Firmendirektor im Rheinland tätig.
1933 emigrierte er nach Belgien und gründete in der Nähe von Antwerpen eine
Import-Export-Firma, die zeitweilig 2.000 Beschäftigte zählte. Während des
spanischen Bürgerkriegs unterstützte er die Republikaner durch die
Einschleusung von Freiwilligen. Nach dem Einmarsch der Deutschen 1940 wurde
er von den belgischen Behörden verhaftet, nach Frankreich abgeschoben und
interniert. Im November 1942 an die Gestapo ausgeliefert, kam er zunächst
ins Polizeigefängnis am Berliner Alexanderplatz. Dort wurde er für rund ein
Jahr als Dolmetscher in der Ausländerabteilung der Kriminalpolizei
eingesetzt. Um die Jahreswende 1943/44 deportierte man ihn nach Auschwitz.
Im Anschluß an die Auflösung des Lagers musste er den Marsch über das KZ
Groß-Rosen zum KZ Buchenwald mit antreten.
Nach der Befreiung trat Auerbach in Düsseldorf in die SPD ein und wurde im
September 1945 Sachbearbeiter beim Regierungspräsidenten in der Abteilung
"Fürsorge für politisch, religiös und rassisch Verfolgte". Doch bereits nach
wenigen Wochen wurde er vom Dienst suspendiert, weil er damit begonnen
hatte, die NS-Vergangenheit des Oberpräsidenten der Provinz Nordrhein, des
späteren Bundesinnenministers Robert Lehr (CDU), auszuspähen.
Besonders aktiv war er anschließend bei der Gründung jüdischer
Kultusgemeinden; schon bald wurde er zu ihrem Präsidenten in der britischen
Zone ernannt. Auf Vermittlung des bayerischen Ministerpräsidenten Wilhelm
Hoegner gelang es ihm schließlich, im Herbst 1946 nach München
überzuwechseln und dort das Amt eines Staatskommissars für die Betreuung der
Opfer des Faschismus anzunehmen.
Anmerkungen
1 Friedrich Glum, Zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik - Erlebtes
und Erdachtes in vier Reichen, Bonn 1964, S. 601.
2 Vgl. Elke Fröhlich, Philipp Auerbach (1906-1952), "Generalanwalt für
Wiedergutmachung", in: Manfred Treml/Wolf Weigand (Hrsg.), Geschichte und
Kultur der Juden in Bayern, München 1988, S. 315-320.
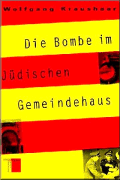 Fortsetzung
>> Im Teil II.: Fortsetzung
>> Im Teil II.:
Das Geschick und die Eigenwilligkeit, mit der Auerbach die Interessen der
NS-Verfolgten vertrat, hatten ihn schon frühzeitig ins Kreuzfeuer der Kritik
geraten lassen.
*) Von Wolfgang Kraushaar ist soeben sein aufsehenerregendes
Buch "Die
Bombe im jüdischen Gemeindehaus" erschienen:
Nicht die Rote Armee Fraktion war die erste Gruppierung, die in den
Untergrund ging, sondern eine, die sich nach südamerikanischem Vorbild
Tupamaros nannte: die Tupamaros West-Berlin.
Sie plazierten am 9.November 1969 eine Bombe, die von einem Agent
provocateur des Verfassungsschutzes stammte und im Jüdischen Gemeindehaus
während einer Gedenkveranstaltung explodieren sollte.
Am Jahrestag des Nazi-Pogroms wollten sie für ein Fanal sorgen. Die Bombe
versagte zwar, der Schock jedoch saß tief. NS-Überlebende hätten erneut
Opfer werden sollen - diesmal durch die Kinder der Täter-Generation. Was bei
der Olympiade 1972 in München mit dem blutigen Überfall auf die israelische
Olympia-Mannschaft schließlich traurige Wirklichkeit wurde, fand hier
bereits seinen Auftakt.
Wer hat am 9. November 1969 diese Bombe gelegt? Gab es Auftraggeber? Was ist
aus dem Bombenleger geworden? Die Spuren, die über Jahrzehnte hinweg
verblaßt und darüber hinaus absichtlich verwischt worden sind, können mehr
als nur neu gelesen werden - diesmal, 35 Jahre danach, können sie entziffert
werden.
Die Tupamaros West-Berlin waren ein Produkt jener linksradikalen Subkultur,
die aus einer orientierungslos gewordenen 68er-Bewegung hervorgegangen war
und seit dem Herbst 1969 West-Berlin mit einer Serie von Bombenanschlägen
überzog. Im Vordergrund standen nicht nur Angriffe auf Justizangehörige,
Richter und Staatsanwälte. Auch israelische und jüdische Einrichtungen
wurden zu erklärten Zielscheiben. Den Protagonisten der Tupamaros
West-Berlin ging es darum, den Vietnamkrieg durch den Nahostkonflikt zu
ersetzen und den Guerillakampf in das Land der NS-Täter zu holen.
Der Feind Israel:
"Es gab Antisemitismus bei
militanten Linken"
Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar über Israel als Feind
subkultureller Linksradikaler und judenfeindliche Züge in der RAF...
9. November 1969:
Das abgespaltene Attentat
1969 wollten West-Berliner Linksradikale die "Reichskristallnacht"
nachinszenieren. Bislang existierte für diese Tat kein Ort im Gedächtnis der
Linken...
Solidarität mit haGalil!
Diskussion und Information:
Antisemitismus aus der Mitte der Gesellschaft
Podiumsdiskussion im großen Saal des Münchner Gewerkschaftshauses am
Donnerstag, 30. Juni, 19.00 Uhr...
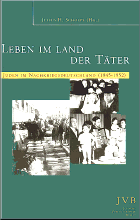 Der
Beitrag erschien 2001 im von Julius H. Schoeps herausgegebenen Sammelband:
Leben im Land der Täter
Jüdisches Leben im Nachkriegsdeutschland (1945-1952)
Mit Beiträgen von Werner Bergmann, Y. Michael Bodemann, Josef Foschepoth,
Angelika Königseder, Wolfgang Kraushaar, Ina S. Lorenz, Lothar Mertens,
Ulrike Offenberg, Julius H. Schoeps, Juliane Wetzel, u.a...
hagalil.com
19-07-2005 |