|
Jüdische Schulen am Grindel:
Die Einweihung des Neubaus der Talmud-Tora-Realschule (1911)
Von Ursula Randt
Erschienen in: Ursula Wamser/Wilfried Weinke (Hg.): Ehemals in Hamburg zu
Hause: Jüdisches Leben am Grindel. Hamburg 1991; weiterer
Literaturtipp
In der mehr als 100jährigen Geschichte der
Talmud-Tora-Schule hatte es wohl kaum einen denkwürdigeren Tag gegeben als
den 20. Dezember 1911: den Tag der Einweihung des neuen Schulgebäudes am
Grindelhof 30.(1) Das Innere des Hauses war mit
immergrünen Pflanzen festlich geschmückt. Palmen und Lorbeer umrankten die
Estrade der Aula und gaben einen Rahmen für das Bildnis von Moritz M.
Warburg.(2)
Jahrzehntelang hatte er im Schulvorstand gewirkt und immer
wieder mit Sorge auf die unzureichende Unterbringung der Schule an den
Kohlhofen hingewiesen, die durch An- und Umbauten kaum dauerhaft verbessert
werden konnte. Moritz M. Warburg (3) vor allem war
es zu verdanken, dass der Neubau endlich Wirklichkeit geworden war.

Talmud-Tora-Schule. Grindelhof 30, recht im Hintergrund
die Bornplatz Synagoge. Aus: Hamburg und seine Bauten, Bd. 1, 1914.
Gemeinsam mit seinen Söhnen hatte er 200.000 Mark zur
Verfügung gestellt und durch sein Beispiel zahlreiche Mitglieder der
Deutsch-Israelitischen Gemeinde in Hamburg angeregt, ebenfalls zu spenden.
So war schließlich der erforderliche Betrag von 525.000 Mark für das
Grundstück, das Gebäude und die Einrichtung zusammengekommen. Doch dem
Stifter war es nicht vergönnt, die Vollendung des gemeinsamen Werkes zu
erleben: im Januar 1910 hatte die Gemeinde seinen Tod beklagen müssen.
Die geräumige Turnhalle — sie diente auch als Aula —
konnte die große Zahl der Gäste kaum fassen, die sich zur feierlichen
Eröffnung des Neubaus eingefunden hatten. Als Vertreter des Senats war der
Präses der Oberschulbehörde der Einladung gefolgt, Senator Dr. von Meile,
als Vertreter der Bürgerschaft Herr Präsident Engel. Von der
Oberschulbehörde hatten sich Prof. Dr. Brütt, Prof. Dr. Dilling, Prof. Dr.
Schober und Prof. Dr. Heskel eingefunden. Auch mehrere Direktoren höherer
Schulen der Stadt zählten zu den Gästen. Vollzählig erschienen waren
selbstverständlich Vorstand und Repräsentantenkollegium der
Deutsch-Israelitischen Gemeinde, Delegierte des Synagogen- und des
Tempelverbandes und die jüdischen Geistlichen von Hamburg, Altona und
Wandsbek. Man sah die Familie Warburg und zahlreiche andere Spender, den
Architekten Ernst Friedheim und Herren der Baukommission. Die meisten Herren
waren in Begleitung ihrer festlich gekleideten Ehefrauen gekommen. Neben dem
Lehrerkollegium hatte etwa die Hälfte der Schüler Platz gefunden: die
meisten drängten sich auf der Empore. So großzügig das neue Schulgebäude
auch geplant war - es erwies sich immer noch als zu klein.
Stille herrschte, als nach einem Präludium für Cello und
Harmonium der Schülerchor die letzten Verse des 122. Psalms in hebräischer
Sprache anstimmte: "In deinen Mauern weile Frieden, in deinen Hallen still'
Gedeih'n". Dann ergriff Oberrabbiner Dr. Spitzer das Wort. Er umriß das
Bildungsziel der Schule, an dem sie in allen Wandlungen der Zeit seit 100
Jahren festgehalten hatte, "bürgerliches Wissen in Verbindung mit
jüdisch-religiösem Lebenswandel zu pflegen". - "Möge dieses Haus zu allen
Zeiten seiner Aufgabe gerecht werden, möge es dem großen Vaterlande treue
Söhne, der Vaterstadt gute Bürger und unserer Religionsgemeinschaft
überzeugungsvolle Anhänger erziehen!", rief er aus.(4)
Die Festrede hielt danach Direktor Dr. Joseph Goldschmidt. Er wandte sich
zuletzt an seine Schüler:
"Möglichste Vervollkommnung sei das hohe
Ziel, das ihr erreichen wollt... Zur Krönung der zur Einheit und
Vollkommenheit strebenden Entwicklung tritt die Religion hinzu, keine bloße
Morallehre, sondern die Kunde unserer jüdischen Gesetze, geschöpft aus den
biblischen und talmudischen Quellenschriften. Nicht umsonst befinden wir uns
hier in der nächsten Nähe der Hauptsynagoge, sie mag uns beim Eintritt und
Ausgang, das Psalmwort zuwinken: Anfang der Weisheit ist die Ehrfurcht vor
Gott.... Drei Idealen streben wir zu. Das erste zeigt uns unser jüdischer
Glaube. Die erhabenen Vorschriften der schriftlichen und mündlichen Lehre
erwecken in unseren Herzen das Zartgefühl für Menschen und Tiere, befestigen
die Ergebenheit in die Schickungen des Allmächtigen und erwärmen uns für
alles Wahre und Edle. Ein zweites Ideal besteht darin, daß ihr aus der
Beschäftigung mit der deutschen Literatur und Geschichte die deutsche
Eigenart schätzen, lieben und hochachten lernt. Treue gegen sich selbst und
andere, Festigkeit und Kraft, Ernst und Mut im Handeln zeichnen den
deutschen Mann aus. Und bewundern wir unser Heimatland ob der Schönheit
seiner Berge und Täler, seiner sanften Ströme und lieblichen Seen, so sind
wir stolz, Bürger eines Volksstammes zu sein, der durch jene Tugenden
emporragt vor allen Nationen des Erdballs. Insbesondere aber hängt unser
Herz, und das sei euer drittes Ideal, an unserem lieben, schönen Hamburg.
Noch ist das Gefühl für die Vaterstadt bei euch eine unbewußte
Anhänglichkeit, wie das Kind seine Eltern liebt, ohne zu erkennen, wie viel
Gutes es ihnen verdankt. Laßt euch aber sagen, die Hamburger haben ihre
schätzenswerte Sonderart, die euch später, wenn ihr mit schärferem Auge
zuzuschauen versteht, zum Bewußtsein kommen wird. Fleißig sind sie und
unverdrossen, nicht träumerisch, sondern wachsam, wägend und wagend,
Menschen des Rates und der Tat. Werdet tüchtige Juden, tüchtige Deutsche,
tüchtige Hamburger! Das walte Gott."(5)
Das "Holder Friede, süße Eintracht, weilet, weilet
freundlich über dieser Stadt" aus Friedrich Schillers "Lied von der Glocke",
gesungen vom Schülerchor, beschloß die Feier. Geleitet vom Direktor und vom
Lehrerkollegium nahmen nun die Gäste das neue Schulhaus in Augenschein. Man
war sich einig, daß das dreistöckige Gebäude im Reformstil in jeder Hinsicht
den Erfordernissen eines modernen Unterrichts für die 176 Vorschüler und 350
Realschüler entsprach.(6) Zudem war es dem
Architekten gelungen, die Schule und das angrenzende Gelände mit seinen
Baumgruppen derart zu gestalten, daß alles zusammen mit der Synagoge am
Bornplatz ein harmonisches Bild ergab.
Natürlich wollte der "Verein ehemaliger Schüler der Talmud
Tora Schule" die Einweihung des Neubaus nicht sang- und klanglos
vorübergehen lassen.(7) Im "Weißen Saal" von
Sagebiels Etablissement an der Drehbahn fanden sich abends mehr als 450
Damen und Herren zum Festkommers zusammen: Repräsentanten der Gemeinde,
Delegierte des Synagogenverbandes, der Henry-Jones-Loge, der Steinthal-Loge,
der Zionistischen Ortsgruppe, der Jüdischen Turnerschaft von 1902 und
anderer Vereine, selbstverständlich die Herren des Schulvorstandes und das
gesamte Lehrerkollegium. Die Galerie war für die Damen reserviert. Sie
konnten den ganzen Saal überblicken: An langen Tafeln saßen die Männer mit
ihren farbigen Schülermützen. Dr. Rudolf Cohen, der Vorsitzende des Vereins
ehemaliger Schüler, begrüßte die Gäste. Er schloß seine schwungvolle Rede
mit einem Hoch auf Hamburg, und dann erscholl das gemeinsame Lied: "Stadt
Hamburg an der Elbe Auen". Dr. Lanzkron ließ in seiner Festrede noch einmal
die Geschichte der Schule vor den Anwesenden vorüberziehen. Er selbst war
der Verfasser des Liedes "An die Talmud Tora", das zum Schluß erklang.
Dankreden und Toaste in Poesie und Prosa folgten.
Zu den Höhepunkten des Abends gehörte ein mit Spannung
erwartetes Stück des Buchhändlers Salomon Goldschmidt. "Die Balladen" wurden
von ehemaligen Schülern mit so viel Bravour gespielt, daß Gelächter und
Beifall kein Ende nehmen wollten. Die meisten erinnerten sich noch gut an
Salomon Goldschmidts Sketch zur Zentenarfeier der Schule 1905: Mit dem
Einakter "Nach zweihundert Jahren" hatte der einfallsreiche Schreiber einen
Blick in die Zukunft getan und die Vorbereitungen zur Zweihundertjahrfeier
der Talmud Tora in humorvoller Weise geschildert.(8)
Und dann gab es noch eine Überraschung: Dem Fest-Komitee war es gelungen,
die Gebrüder Wolf (9), ebenfalls ehemalige Schüler
der Talmud Tora, zur Mitwirkung an diesem Kommers zu gewinnen. Ein Feuerwerk
von fidelen plattdeutschen Liedern und improvisierten Einfällen löste
Beifallsstürme aus. Man mochte sich an diesem Abend einfach nicht trennen.
Rückblick in die Schulgeschichte der Talmud Tor (1805-1911)
Die Anfänge der Talmud-Tora-Schule reichten weit zurück -
bis zur Wende zum 19. Jahrhundert. Damals lebten etwa 7.000 Juden in
Hamburg, viele von ihnen in Armut. Von Gleichberechtigung war man noch weit
entfernt. Juden waren von den Zünften ausgeschlossen, der Zugang zu den
meisten Berufen war ihnen verwehrt. Zahlreiche Arme ernährten sich
kümmerlich von Hausier- und Kleinhandel, und das hieß: Männer und Frauen
gingen von früh bis spät im Freien ihrem mühsamen Broterweb nach. Oft
blieben ihre Kinder unbeaufsichtigt. Die 5—13jährigen erhielten religiösen
Unterricht im "Cheder", einer einfachen, einklassigen "Schule" im Wohnzimmer
eines Lehrers. Dort erwarben sie selten mehr als geringe
Hebräischkenntnisse, denn deutsche Sprache und allgemeinbildende Fächer
gehörten nicht zu den Lehrgegenständen.(10)
Am Neuensteinweg in Hamburg führte der Kaufmann Mendel
Frankfurter eine kleine Tapetenfabrik. Er war ein vielseitig gebildeter Mann
und ein bedeutender Talmud-Gelehrter. Als Mitglied der
Talmud-Tora-Kommission der Gemeinde Altona in Hamburg, die für den
Unterricht der Kinder der Armen zu sorgen hatte, lag ihm das Schicksal
dieser Kinder besonders am Herzen.
"Und seine Augen ruhten auf den Söhnen der Armen, um
die sich niemand kümmerte, und er betrachtete sie und sah sie zerstreut in
den Straßen, ohne richtige Bekleidung liefen sie hin und her, nicht nur
nackt an Kleidern, sondern auch nackt von Verstand, sogar über ihren Lehrern
lagerte eine Wolke", hat sein Sohn später geschrieben. Mendel
Frankfurter war leidenschaftlich entschlossen, den Kindern zu helfen.
"... mit lauter Stimme bat er die Reichen der Stadt um
Hilfe, und er ging von Haus zu Haus und von Ecke zu Ecke und sprach zum
Herzen der Philanthropen mit Flehen und Verstand und süßen Worten, und ihre
Herzen schmolzen und wurden zu Wasser, und sie schütteten ihre Säcke aus,
und sie gaben ihm sehr viel Geld, so viel er von ihnen verlangt hatte, und
dann erbaute er das Haus der Talmud Tora, wo arme Kinder auch Unterkunft
fanden, und er deckte alles, was ihnen fehlte an Bettzeug und Kleidung für
ihren Körper, auch Speise und Brot, um sich satt zu essen. Wie kann denn ein
Kind lernen, das hungrig ist? Und mein frommer Vater hat sich von allen
Arbeiten befreit und sich fast überhaupt nicht mehr um den Unterhalt seines
Hauses gekümmert, und er gab seine ganze Zeit denen, die Gottes Lehre
lernen."(11)
So entstand das erste Haus der Talmud Tora an der
Elbstraße mitten in der Neustadt, wo fast alle Hamburger Juden wohnten. Das
geräumige, mehrstöckige Gebäude hatte für jeden Lehrer ein Zimmer, in dem er
seine Schüler um sich versammelte, dazu ein Büro für den Vorstand und einen
Hofplatz hinter dem Haus, auf dem sich die Kinder im Freien erholen konnten.
Ein derartiges "Lehrhaus für Kinder" hatte es niemals vorher in der
Geschichte der Juden in Hamburg gegeben. Das Haus war ein großzügiges
Geschenk der Kaufleute Michel Lehmann, Elias Ruben und Süßkind Oppenheim. Am
31. März 1805 wurde die "Israelitische Armenschule der Talmud Tora"
feierlich eröffnet.
60 kleine Knaben im Alter von etwa sieben bis zwölf Jahren
hielten ihren Einzug. Voraussetzung für ihre Aufnahme war, daß sie schon
etwas Hebräisch lesen konnten: das lernten die fünf- bis siebenjährigen
Kinder außerhalb des Lehrhauses im Cheder. Im Alter von 13 Jahren wurden die
Schüler entlassen. Bis dahin lebten und lernten sie von morgens bis abends
im Schulhaus; dort bekamen sie auch ein kostenloses Mittagessen. Zu ihrem
Lehrplan gehörten Hebräischlesen und -schreiben, das Studium der Tora im
hebräischen Urtext und später erklärende Schriften und Texte aus dem Talmud.
Täglich drei Stunden kam der Schreib-Rechenlehrer ins Haus, um die Kinder in
kleinen Gruppen in Rechnen und "Jüdischschreiben" zu unterweisen, denn
beides galt als unentbehrlich für eine spätere Berufstätigkeit. Der Anteil
an weltlichem Wissen war also sehr gering. Die Schule, erwachsen aus dem
Geist tiefer Frömmigkeit, betrachtete sich vor allem als eine Pflanz- und
Pflegestätte des gesetzestreuen Judentums.
Doch das Verlangen der Juden nach Gleichberechtigung nahm
zu. und bald wurde deutlich, daß allgemeinbildende Fächer unerläßlich waren,
wollte man nicht "ein mit der zivilisierten Welt unverträgliches
Isolierungssystem behaupten."(12) Unter dem
Einfluß der Aufklärung waren in vielen Städten moderne jüdische Schulen
entstanden, in denen auch Deutsch und profane Fächer gelehrt wurden. In
Hamburg war 1815 von Anhängern der jüdischen Reformbewegung eine derartige
"Freischule" gegründet worden.(13) Nur durch eine
umfassende Neuordnung des Unterrichts würde die Talmud-Tora Schule neben ihr
bestehen können. Unter der Leitung des talmudisch wie weltlich gleichermaßen
gebildeten Chacham Isaak Bernays (14) wurde der
Lehrplan 1822 von Grund auf umgestaltet, ein Teil des jüdischen Lehrstoffes
gestrichen und statt dessen Deutsch und Realien eingeführt. Die Realien
umfaßten außer Rechnen "im ausgedehntesten kaufmännischen Sinne"
Schönschreiben, Geographie, Völker- und Naturkunde."(15)
Besonders das Fach "Deutsch" nahm jetzt einen hohen Rang
ein. Fast alle Kinder sprachen noch einen abfällig "Jargon" genannten
jüdischen Dialekt, der einem lautreinen Hochdeutsch weichen sollte. Da es
nicht möglich war, orthodox eingestellte jüdische Lehrer zu finden, die
Deutsch in ausreichendem Maße beherrschten, wurden junge, christliche
Theologen als Deutschlehrer an die Talmud Tora gerufen. Mit Eifer und
Geschick widmeten sie sich der Aufgabe, den armen israelitischen Knaben den
Weg in die Emanzipation zu ebnen.(16)
Eine Schule, die weltliches Wissen vermittelte und dennoch
ohne Kompromisse religiös-orthodox blieb, entsprach den Wünschen vieler
Eltern. So wurden immer mehr Kinder angemeldet. Als 1851 die Schulerzahl auf
230 angewachsen war, wurde es im Haus an der Elbstraße unerträglich eng.
Aber noch reichlich sechs Jahre dauerte es, bis ein schönes, neuerbautes
Schulhaus an den Kohlhöfen 20 eingeweiht werden konnte.
Im Sommer 1869 zählte die Schule 368 Schüler. Zum Lehrplan
gehörten inzwischen auch Englisch und Französisch, Mathematik, Physik,
Geschichte, Zeichnen und Turnen. 1870 war die Talmud Tora eine der ersten
Schulen in Hamburg, denen die Berechtigung erteilt wurde, mit dem
"einjährig-freiwilligen Zeugnis" abzuschließen. Damit hatte die Armenschule
den Rang einer "Höheren Bürgerschule" erreicht. Wie eh und je fühlte sie
sich jedoch den Söhnen der wenig bemittelten Gemeindeangehörigen besonders
verpflichtet, und nach wie vor zahlten die meisten Eltern gar kein oder nur
ein geringes Schulgeld. Oberrabbiner Anschel Stern, seit 1851 Nachfolger des
Chacham Isaak Bernays, hatte die leitende Stellung im Schulvorstand .(17)
Vor allem durch seine vorausschauende, kluge Personalpolitik hatte er die
Anerkennung der Schule ermöglicht: Erst seit kurzem waren die Juden in
Hamburg rechtlich gleichgestellt, und noch gab es kaum jüdische Oberlehrer.
Da aber eine "Höhere Bürgerschule" akademisch gebildete Lehrer erforderte,
hatte sich Anschel Stern dafür eingesetzt, christliche Lehrer aus dem
Johanneum, dem Christianeum und anderen höheren Schulen stundenweise für den
Unterricht an der Talmud Tora zu gewinnen.
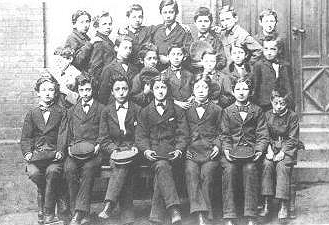
Schüler der Talmud-Tora-Schule 1879
(Privatbesitz)
Von der Genehmigung zur "Abhaltung von Prüfungen für den
einjährig freiwilligen Militärdienst" bis zum ersten Examen hatte es
nochmals ein Jahr gedauert. Drei glückliche und stolze Kandidaten, 14 und 15
Jahre alt, konnten im April 1871 das begehrte Zeugnis in Empfang nehmen.
Hunderte von Talmud Tora-Schülern hatten seitdem das Einjährige" bestanden,
und immer mehr von ihnen entschlossen sich, anschließend eine Oberrealschule
oder ein Realgymnasium zu besuchen, um die Hochschulreife zu erlangen und zu
studieren.
Im Frühjahr 1911 hatten sich 33 Schüler zur
Entlassungsprüfung gemeldet, von denen 31 die dreitägige mündliche Prüfung
vor dem Kommissar der Oberschulbehörde, Herrn Schulinspektor Prof. Dr.
Heskel, bestanden hatten.(18) Leicht wurde es den
durchschnittlich 15 Jahre alten Jungen nicht gemacht! Der mündlichen Prüfung
war die schriftliche vorangegangen. Das Thema des Deutschaufsatzes hieß:
"Inwiefern ist der Mensch der Herr der Erde, inwiefern nicht." In der
Mathematikarbeit wurden vier Aufgaben gestellt, an denen wohl mancher ältere
Schüler eines Gymnasiums gescheitert wäre. Schließlich waren noch eine
französische und eine englische Übersetzung anzufertigen. Von den 31
glücklichen Examenskandidaten wollten vier anschließend eine Oberrealschule
besuchen und später studieren, wahrend die anderen sich - wie es der
Tradition entsprach für den Beruf des Kaufmanns entschieden hatten. Und
schon "büffelte" ein neuer Jahrgang der nächsten Prüfung entgegen. Von den
11 im Jahr vorgeschriebenen Deutschaufsätzen hatten die Schüler die meisten
Themen schon bearbeitet, u.a.: "Woran erkennen wir auf einem Gang durch
Hamburg, daß wir uns in einer Welthandelsstadt befinden?" - "Das Geld ist
ein guter Diener, aber ein schlechter Herr." - "Wie Hermann Dorothea
erwarb." - "Bedeutung Friedrich des Großen."(19)
Dr. Goldschmidt (20) hatte
allen Grund, mit den Leistungen seiner Schüler zufrieden zu sein. Eins aber
erfüllte ihn mit besonderem Stolz: Die Schule hatte einen bedeutenden
Beitrag zur jüdischen Emanzipation geleistet, ohne ihr auch nur das
Geringste von den religiösen Geboten des Judentums zu opfern. Sie hatte den
Beweis erbracht, daß es möglich war, zugleich orthodoxer Jude und
nationalbewußter Deutscher zu sein. Sie hatte der Weg gezeigt,
unverfälschtes Judentum beizubehalten und dennoch an den Bildungsgütern der
Zeit teilzunehmen, ja, beides in ein harmonisches Verhältnis zueinander zu
bringen. In diesem Sinne verkörperte er seine Schule geradezu.
Dr. Goldschmidt, Direktor der Talmud-Tora-Realschule, und sein
Kollegium
Dr. Goldschmidt war der Talmud Tora seit langem verbunden.
1867 hatte der knapp 25jährige nach abgeschlossenem Studium und Promotion
seine erste Lehrerstelle an der Talmud Tora angetreten. Neun Jahre später
war er an die ebenfalls streng orthodoxe "Realschule der israelitischen
Religionsgemeinschaft zu Frankfurt a.M." übergewechselt. Natürlich hatte er
freudig zugestimmt, als er 1889 zum Direktor der hochangesehenen Talmud Tora
berufen worden war. Bis zum Tod von Oberrabbiner Anschel Stern hatte die
Leitung der Schule in den Händen eines Vorstandes gelegen, in dem der
Oberrabbiner den Vorsitz führte und die pädagogische Richtung bestimmte. Mit
Dr. Joseph Goldschmidt stand zum ersten Mal in der Geschichte der Schule ein
pädagogisch ausgebildeter und erprobter Man an der Spitze der Anstalt,
freilich ein Mann, der nicht weniger als der Oberrabbiner die Gewähr für
unwandelbare Treue zum jüdischen Gesetz bot.(21)
Der doppelte Bildungsauftrag der Schule bedeutete Arbeit,
Arbeit und nochmals Arbeit. Dr. Goldschmidt forderte sie mit unbeugsamer
Strenge von Schülern und Lehrern, am meisten aber von sich selbst. Jeder Tag
seines Lebens war von religiösen und weltlichen Pflichten ausgefüllt, und so
verlangte er es auch von anderen. Undenkbar, daß er gefehlt hätte oder auch
nur geringfügig verspätet zum Unterricht erschienen wäre! "Dr. Goldschmidt
tüchtig ist, doch bekannt als Pessimist: als Director zieret ihn Ordnung und
auch Disciplin", reimten die Schüler.(22) Selten
lachte "der Alte", nichts schien ihn aus der Fassung bringen zu können, in
jeder Situation blieb er nüchtern, kühl und distanziert. Er war "immer
makellos und etwas altmodisch gekleidet. Er war sehr schweigsam und sprach
sehr leise, hatte aber die Fähigkeit, eine Klasse mit den Augen allein zu
regieren."(23) Geschichte und Literatur waren
seine Fächer, und die Schüler erfuhren mit Respekt das außerordentliche
Wissen, die Gründlichkeit und Genauigkeit des "gelernten Historikers".
Weniger schätzten sie es, wenn ein Lehrer fehlte und Dr. Goldschmidt ihn
vertrat. In diesen Stunden pflegte er nämlich das "Verbum finitum"
durchzunehmen; irgendwann mußte er es als geeigneten Gegenstand für
Vertretungsstunden entdeckt haben, und seitdem blieb er dabei, Punktum. Man
wußte also genau, was einen erwartete; die Reaktionen des "Alten" waren
stets berechenbar. Es kam vor, daß ein Schüler die Kühnheit besaß, sich über
einen Lehrer beim Direktor zu beschweren. "Tschupp! Der Lehrer hat recht!"
hieß es dann kurz, und damit wandte sich Dr. Goldschmidt ab und ließ den
Beschwerdeführer stehen. "Tschupp, der Lehrer hat recht", blieb ein
geflügeltes Wort, wenn man resignierend zum Ausdruck bringen wollte, daß man
doch nichts zu melden hatte." (24)
Stolz war Dr. Goldschmidt auf sein Kollegium. Jeder der 21
Herren - darunter drei Christen - trug zu dem hohen Ansehen bei, das die
Schule bei der Gemeinde und bei der Oberschulbehörde genoß. Senior war
Daniel lsaak (25), der 1910 das 70. Lebensjahr
vollendet hatte. Als er 1864 in die Schule eingetreten war, hatte das einen
langjährigen Mißstand beendet: Jahre zuvor war der bewährte christliche
Lehrer Kluge (26), der den deutschen
Elementarunterricht bei den Kleinen zur allgemeinen Zufriedenheit geleitet
hatte, wegen schwerer Krankheit ausgeschieden, und seitdem hatte man sich
mit ständig wechselnden Lehrern abfinden müssen, die ihrer wichtigen Aufgabe
oft nicht gewachsen waren. Daniel lsaak hatte sich durch eine dreijährige
Ausbildung am jüdischen Lehrerseminar in Hannover auf sein Amt vorbereitet.
Ihm wurden die Schulanfänger damals anvertraut - mehr als 70 in einer
Klasse! Von nun an konnte man wieder unbesorgt sein. Die Jüngsten liebten
ihren Lehrer, der "mit einem unermeßlichen Schatz von Liebe und Güte
begnadet" war (27), und in nur einem Jahr lernten
sie bei ihm deutsch und hebräisch lesen. Jedenfalls wurde behauptet, es habe
nie einen Fall gegeben, wo ihm das nicht gelungen sei. Jahr für Jahr übergab
er eine wohlgeordnete Klasse von Talmud-Tora-Schülern seinem Nachfolger und
nahm eine unruhige Schar neugieriger Erstkläßler in Empfang. Mit zunehmendem
Alter sehnte er sich manchmal danach, ältere, "gesetztere" Schüler
unterrichten zu dürfen, doch Dr. Goldschmidt hatte diese Bitte jedesmal
abgewehrt. Unmöglich! Woher sollte man einen Ersatz für Daniel Isaak finden?
So blieb er bei seinen ABC-Schützen. Es ließ sich leicht ausrechnen, daß er
weit mehr als 2.000 Talmud-Tora-Schüler in die Anfangsgründe der deutschen
und hebräischen Schriftsprache eingeführt hatte. "Kindermädchen" nannten ihn
die Großen mit gutmütigem Spott.(28)
Überall in der Gemeinde bekannt und geachtet waren auch
die Brüder Dr. David (29) und Dr. Lipmann
Schlesinger(30), die offiziell Dr. Schlesinger I.
und Dr. Schlesinger II. hießen. Die Schüler nannten sie allerdings in
schlechtem Hebräisch "Echod", der Erste, und "Eini", der Zweite. Mit
besonderem Stolz wies man daraufhin, daß die beiden gelehrten Herren selbst
ehemalige Schüler der Talmud Tora waren, Echod, der Hebräisch unterrichtete,
wußte sich leicht Respekt zu verschaffen. "Er war klein, stämmig, sah alles
und genierte sich nicht im geringsten, auch noch an Primaner kräftige
"Backse" auszuteilen, wie Ohrfeigen in Hamburg hießen", erinnerte sich viele
Jahre später sein Schüler Hans Klötzel. Doch: "Echod war einer der wirklich
großen Lehrer, die ich gehabt habe, ein pädagogisches Talent von Rang, dem
man es anmerkte, daß er auf keinem Lehrerseminar verwässert oder verbogen
worden war. Seine Lehrmethoden waren in jeder Weise originell, und bei aller
Strenge, die er walten ließ, war sein Unterricht überaus lebendig und, ich
möchte sagen, abenteuerreich. Er war einer der wenigen Lehrer, bei denen wir
denken lernten... Er gab T'nach in den oberen drei Klassen, und wenn er eine
neue Klasse übernahm, pflegte er anzukündigen: 'Bisher habt ihr Lobstriche
für gute Antworten bekommen. Bei mir gibt's Lobstriche für gute Fragen.'"(31)
Viel schwerer hatte es sein jüngerer Bruder. Eini war
kurzsichtig und schwerhörig, "dabei von einer überaus sanften Gemütsart."
Das forderte die Schüler natürlich immer wieder zu allerlei Unfug heraus.
Neben Mathematik unterrichtete er Physik und Chemie. "Eini hat sich
jahrzehntelang darüber gewundert, warum ihm niemals ein Experiment gelang,
zu dem er einen Bunsenbrenner benutzte. Er ist nie auf den Gedanken
gekommen, daß immer ein Schüler bereitstand, um im entscheidenden Moment den
Gasschlauch zuzukneifen und so den Brenner zum Erlöschen zu bringen."(32)
Am meisten setzte ihm seine Schwerhörigkeit zu. Es konnte vorkommen, daß
sich ein Schüler mitten in der Stunde meldete und eilig fragte: "Herr Dr.
Schlesinger, darf ich Ihre Frau küssen?" Worauf Eini abwinkte: "Jetzt nicht!
Warte bis zur Pause!" -(33) Aber zuletzt hatte
man doch auch bei Eini eine Menge gelernt, und viele Schüler leisteten dem
klugen, gütigen Mann später insgeheim Abbitte.
Kaum ein anderer Lehrer hatte den Geist der
Talmud-Tora-Schule so nachhaltig geprägt wie Dr. Samson Philip Nathan, der
im Herbst 1905 gestorben war. Er war 1820 als Sohn des Lehrers und
Waisenvaters P.S. Nathan in Hamburg geboren und hatte die "Israelitische
Armenschule Talmud Tora" besucht.(34) Isaak
Bernays unterrichtete ihn persönlich in den "jüdischen sowohl sprachlichen
als talmudischen Studien" und bescheinigte ihm "erfreuliche, glänzende
Fortschritte". Samson Philipp Nathan wechselte auf Gelehrtenschule des
Johanneums über und lernte dort Griechisch und Latein mit derselben
Leichtigkeit wie Hebräisch. Sein Studium in Würzburg und Berlin, das er in
Jena mit der Promotion abschloß, führte ihn mit christlichen Gelehrten
zusammen; daneben hatte er jedoch seine jüdischen Studien nicht
vernachlässigt, so daß er 1847 in Frankfurt am Main die Approbation zur
Rabbinatswürde erhielt. Dennoch schlug er es aus, ein Rabbinat zu
übernehmen. Es zog ihn zurück nach Hamburg und an die Talmud-Tora-Schule.
1848 trat er dort als Lehrer ein. Neben den jüdischen Fächern übertrug man
ihm bald Rechnen, da er ein ausgezeichneter Mathematiker war. Für seine
Lehrmethode charakteristisch war "die Klarheit seiner Ausdrucksweise und die
Knappheit derselben. Die Klarheit des Ausdrucks war das Spiegelbild seines
streng logischen Denkens, die Knappheit wiederum entsprang seinem
schlichten, einfachen, ungekünstelten Wesen."(35)
Seine Zeit war durch Lehrtätigkeit in der Schule, im Verein Mekor Chajim (36)
und im Israelitisch-wissenschaftlichen Verein in Altona vollkommen
ausgefüllt. Jeder in der Gemeinde kannte seine kleine, schmächtige Gestalt,
in der eine unerschöpfliche Energie und Arbeitskraft steckte. Er gehörte
"mit felsenfester Treue dem Judentum" an.(37) Und
er war - ungewöhnlich für seine Zeit politisch zeitlebens freiheitlich und
demokratisch gesinnt. Wer ihn näher kannte, wußte auch von seiner
Schlagfertigkeit, seinem Witz und seinem Humor; "die Fröhlichkeit", hatte er
einmal geschrieben, "ist die Seele alles Lebens" (38)
- Noch im Frühjahr 1905 erteilte der 85jährige in seiner lebendigen
Lehrweise den vollen Unterricht. Erst im September desselben Jahres zwang
ihn zunehmende Schwäche, sich aus der Schule zurückzuziehen. Einige ältere
Schüler waren bei ihm, als er am 31. Oktober 1905 starb: "Dr. Nathan saß in
einem Lehnstuhl, umringt von seiner Familie, seinen Kollegen und den
angesehensten Männern der orthodoxen Gemeinde. Die Prima sagte Tehillim.
Plötzlich hob Dr. Nathan die Hand, um Schweigen zu gebieten, sagte mit
lauter Stimmer 'Sch'ma Israel!' - und war tot." (39)
Einer der Großen der alten Deutsch-Israelitischen Gemeinde
war davongegangen: aber im Gedächtnis der Gemeinde lebte er fort.
Anmerkungen:
(1) Talmud-Tora-Realschule, Bericht über das Schuljahr
1911—1912. Der Neubau der Talmud-Tora-Realschule und die Einweihung des
neuen Hauses. Hamburg 1912.
Staatsarchiv Hamburg, TT 4, Hamburger Nachrichten, Einweihung der
Talmud-Tora-Realschule, und Neue Hamburger Zeitung, Die Einweihung der
Talmud-Tora-Realschule. Undatiert.
(2) Moritz M. Warburg, geb. 1838 in Hamburg, gest. 1910 in
Hamburg. 1876—1899 Mitglied im Vorstand der Schule, seit 1899 Vorsitzender
des Vorstandes. Die Familie Warburg gehörte seit jeher zu den Freunden und
Förderern der Schule. Samuel Elias Warburg (1759—1826) gehörte 1805 zu den
Mitbegründern.
(3) Vgl. Anm. 2.
(4) Vgl. Anm. 1.
(5) Vgl. Anm. 1.
(6) Unter "Vorschule" verstand man die ersten drei Klassen
einer höheren Lehranstalt, in denen Elementarkenntnisse vermittelt wurden.
(7) Staatsarchiv Hamburg, Politische Polizei, SA 581,
Verein ehemaliger Schüler der Talmud-Tora-Schule, lsraelitisches
Familienblatt, Festkommers, 8.1.1912.
(8) Vgl. Anm. 7. lsraelitisches Familienblatt, Festkommers
anläßlich Zetitenarfeier, 10.4.1905.
(9) Gebr. Wolf: Ludwig Wolf (1867—1955), James Wolf
(1870—1943) und Leopold Wolf (1869—1926). "Snuten un Poten" und "Een echt
Hamborger Jung" gehörten zu den beliebtesten Schlagern der Gebr. Wolf. Vgl.:
Helmut Glagla, Das plattdeutsche Liederbuch, München und Zürich 1982.
(10) Joseph Goldschmidt, Geschichte der
Talmud-Tora-Realschule in Hamburg. Festschrift zur Hundcrtjahrfeicr der
Anstalt 1805—1905. Hamburg 1905. Die folgenden Ausführungen stützen sich auf
diese Schrift.
(11) Ebenda, 5. 13. Zitiert aus der hebräischen Schrift
"Pene Tebek von Moses Mendelsohn, Sohn des Mendel Frankfurter". Übersetzung
von N. Bar-Giora Bamberger.
(12) Staatsarchiv Hamburg, YF 1, Protocolle der
Direction, 1. Sitzung v. 18.4.1822.
(13) Die "Israelitische Freischule von 1815" nahm ab 1859
auch christliche Schüler auf und verlor danach bald ihren jüdischen
Charakter. Sie hieß später "Stiftungsschule von 1815" und wurde als
"Anton-Rée Oberrealschule" wegen rückläufiger Schülerzahlen 1933
geschlossen.
(14) lsaak Bernays, geb. 1791 in Mainz, gest. 1849 in
Hamburg. Oberrabbiner der Deutsch-lsraelitischen Gemeinde in Hamburg von
1821—1849. Er nannte sich "Chacham"; das ist das sefardische Wort für
"Weiser", "Gelehrter".
(15) Übersicht der theoretischen Begründung sowohl als
des faktischen Bestandes der hiesigen jüdischen Armenschule genannt Talmud
Tora 1830. Aus: Staatsarchiv Hamburg CLV Lit. L b Nr. 18 Vol. 7b Fasc. 2
lnv. 1, Acta in Sachen der Direktoren der Talmud Tora Armenschule die
Vorsteher der Deutsch-lsraelitischen Gemeinde.
(16) An der Israelitischen Armenschule Talmud Tora
erhielt der christliche Lehrer — seiner besonderen Bedeutung als
Deutschlehrer entsprechend — anfangs den Titel "Oberlehrer" und das höchste
Gehalt, das einem Lehrer dieser Schule bezahlt wurde.
(17) Anschel Stern, geb. 1820 in Steinbach/Hessen, gest.
1888 in Hamburg. Von 1851 bis 1888 Oberrabbiner in Hamburg und Ephorus der
Talmud-Tora-Schule.
(18) Talmud-Tora-Realschule, Bericht über das Schuljahr
1910—1911, Hamburg 1911.
(19) Vgl. Anm. 1.
(20) Dr. Joseph Goldschmidt, geb. 9.11.1842 in Rakwitz
(Posen), gest. 13.6.1925 in Hamburg. Wissenschaftlicher Lehrer,
Lehrbefähigung für Deutsch, Geschichte, Geographie, Latein. Direktor der
Talmud-Tora Realschule von 1889 bis 1921.
(21) Staatsarchiv Hamburg, ff3, Protokolle der Direktion,
Sitzung v. 24.9.1888.
(22) Aus: Lieder für den Fest-Kommers zur Feier des
Lehrerjubiläums des Herrn Dr. S.P. Nathan. 10.5.1898. Privatbesitz,
unveröffentlicht.
(23) CZ Klötze, Eine jüdische Jugend in Hamburg vor dem
Ersten Weltkrieg, Hamburg o.J., S. 30.
(24) Mündliche Aussage des ehemaligen Schülers J.C.,
Israel, März 1986.
(25) Daniel lsaak, geb. 1840 in Kesselbach/Hessen, gest.
1914 in Hamburg. Seit 1864 Lehrer der Talmud-Tora-Schule.
(26) J.E. Kluge war 1829 auf Vorschlag des Direktors des
christlichen Waisenhauses als "Elementarlehrer" an der Talmud-Tora-Schule
eingestellt worden.
(27) Joseph Norden, Vor fünfzig Jahren, in: Hamburger
Israelitisches Familienblatt, Nr. 14, 2.4.1936.
(28) Alle Lehrer der Talmud-Tora-Schule hatten
Spitznamen. Sie wurden der Verfasserin mitgeteilt von Herrn Uri Katzenstein,
Israel.
(29) Dr. David Schlesinger, geb. 1851 in Hamburg, gest.
1921 in Hamburg. Besuchte nach der Talmud-Tora-Schule das
Jüdisch-theologische Kollegium in Hamburg, ab 1870 das Akademische
Gymnasium. 1871—1874 Studium der Philosophie und Orientalia. Von 1875 bis
1920 Lehrer an der Talmud Tora.
(30) Dr. Lipmann Schlesinger, geb. 1860 in Hamburg, gest.
1934 in Hamburg. Bestand 1875 das "Einjährige" an der Talmud Tora. Nach dem
Besuch des Akademischen Gymnasiums Studium der Mathematik und Orientalistik.
Von 1889 bis 1925 Lehrer an der Talmud Tora.
(31) C.Z. Klötzel, a.a.O., 5. 32f.
(32) Ebenda, 5. 31f.
(33) Mitgeteilt von Herrn Rudi Gräber, Israel, Schüler
der TTR von 1915 bis 1924.
(34) Salomon Goldschmidt, Dr. Samson Philip Nathan. Ein
Lebens- und Charakterbild, Hamburg 1906. Die folgende Darstellung stützt
sich auf Salomon Goldschmidts Schrift.
(35) Ebenda, 5. 18.
(36) Mekor Chajim heißt "Quelle des Lebens". Es handelte
sieh um einen streng orthodoxen Lernverein.
(37) Salomon Goldschmidt, aaC., 5. 7.
(38) Ebenda, 5. 9.
(39) Vgl. Anm. 24, 8. 31. Tehillina: Psalmen. Sch'ma
Israel: Höre Israel. 5, Mose 6,4. Bekenntnis der Einzigartigkeit Gottes.
hagalil.com
/ 10-04-2005 |