|
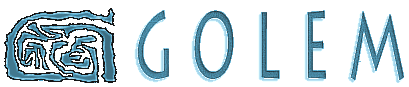

Zwanzigster April
Vladimir Vertlib
Ich sitze im Café Museum am Wiener Karlsplatz, ich und
die anderen vom Jüdischen Club. Daniel Weißberg hat uns eingeladen. Alle
miteinander. Muß ein Vermögen kosten. Aber was ist schon Geld? In solchen
Augenblicken.
Daniel Weißberg übersiedelt nach Israel und hat zum Abschiedsfest geladen.
Seine Beweggründe liegen klar auf der Hand. Es ist Herbst 1986. Nur wenige
Monate zuvor ist in Österreich ein Mann zum Präsidenten gewählt worden, der
"das kollektive Schweigen des Landes, das allgemeine Verdrängen und Lügen, in
einer Weise verinnerlicht hatte, daß er das personifizierte Sinnbild einer
ganzen Gesellschaft wurde." So Daniels Worte.
Daniel spricht gern im Stil jener Feuilltons, die er
manchmal für Zeitungen schreibt. Seine Sprache ist flüssig. Was er sagt,
versteht sich von selbst. Diese Offensichtlichkeit ist eine Schwäche, die er
sowohl kultiviert, wie er sie mit einer durch Jahre erarbeiteten Routine durch
die Form zu überspielen versteht. Die Offensichtlichkeit ist auch seine
Stärke. Keiner kann unser aller Gedanken so formvollendet, so treffend
formulieren. Während er redet, neigt er den Kopf zur Seite und blickt über
oder durch die Köpfe seiner Zuhörer. Das Gesagte unterstreicht er mit
schnellen, beinahe erratisch wirkenden Handbewegungen. Die hektische Gestik
paßt nicht zu seiner leisen, tiefen Stimme mit der sanften Note. Sie hat schon
einen ziemlichen Sog, diese Stimme.
Daniel Weißberg ist Naturwissenschaftler, Systemanalytiker
und technischer Mathematiker. So wie im Inland seine Artikel zu
gesellschaftlichen und politischen Fragen für Irritationen sorgen, erregen
seine Forschungsarbeiten Aufsehen im Ausland. Mit Siebenundzwanzig hat er
eigentlich schon enorm viel erreicht, der Weißberg. Ich bin erst zwanzig und
ahne trotzdem schon, daß ich es nie so weit bringen werde.
Weißberg war lange Jahre Vorsitzender unseres Clubs. Ein Jammer, daß wir ihn
verlieren. Aber wir verstehen ihn. Natürlich verstehen wir ihn. Nur daß wir
etwas ratlos zurückbleiben. "Die Gesellschaft, die um sich eine Mauer des
Schweigens gebaut hat und den fähigsten Maurer zu deren Pflege abgestellt
hat", erklärt Daniel – Singsang in der Stimme, ansteigende Lautstärke, "muß
zusehen, wie sie trotzdem wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und, meine
Freunde, ihr wißt es genau. Es ist keine gute Zeit für Juden, denn nicht nur
kritische Geister wagen nun, das Liebgewonnene und Selbstverständliche in
Frage zu stellen. Auch die Gegenseite hält sich nicht mehr an das Tabu, den
eigenen Gefühlen nur indirekt freien Lauf zu lassen."
Pause und ein Schluck Kaffee.
"Antisemitismus, Xenophobie und der ganz gewöhnliche
Alltagsfaschismus!" Die anderen Kaffeehausbesucher blicken von ihren Zeitungen
auf. Vor einigen Jahren habe er in einem geriatrischen Tageszentrum seinen
Zivildienst absolviert, erzählt Daniel. Ein alter Mann habe ihm während einer
Taxifahrt erklärt, Hitler sei ein Verbrecher, die Ermordung der Juden aber
eine gute Sache gewesen. Er hätte ruhig viel mehr Juden umbringen können, der
Hitler...
Nun passen sich die Sätze den abgehackten Bewegungen seiner Arme an.
Man könne sich vorstellen, wie die nächsten Monate für ihn gewesen seien.
Tagtäglich diesen Mann sehen zu müssen. Später habe er sich mit ihm versöhnt.
Ein existentiell wichtiges Gespräch. Aber bitte, das sei eine außergewöhliche
Situation gewesen. Absolut außergewöhnlich! Es sei natürlich alles viel
komplizierter gewesen, als er es jetzt in wenigen Sätzen schildern könne. Viel
Peinliches sei auch dabei gewesen. Für alle Beteiligten. Etwas, das man gar
nicht wiedergeben kann. Und eigentlich wolle er gar nicht darüber reden...
Er schweigt, und nun ist es auf einmal vorbei mit der
Vorhersehbarkeit, so als hätte jemand mit einem Zauberstab den ganzen Menschen
Weißberg ausgewechselt. Das ist ungewohnt und beängstigend zugleich, und jeder
aus unserer Gruppe erzählt schnell eine Geschichte eindeutigen Inhalts: Ein
gehässiges Wort in der U-Bahn. Ein unfreiwillig belauschtes Gespräch im Zug.
Ein Streit mit dem Nachbarn, der mit einer unmißverständlichen Äußerung endet.
Wie sollen wir denn sonst die unerträgliche Pause überbrücken? Über was sollen
wir denn reden? Über das Wetter? Über die Liebe? Vielleicht sollten wir das ja
auch. Aber dafür fehlt uns der Mut. In solchen Augenblicken.
"Es ist ein Läuterungsprozeß", sage ich schließlich. "Auch
die Antifaschisten erheben nun ihre Stimme. Es wird nie mehr so sein wie
früher."
"Ja", sagt er. "Aber bevor sich Österreich geläutert und gereinigt hat, bin
ich wieder die Judensau."
"Vielleicht", meine ich, "aber hier bist du der Daniel Weißberg, der schon an
Fernsehdiskussionen zum Thema Judentum teilgenommen hat. Und meinetwegen bist
du hier die Judensau, die gegen Österreich hetzt. Und die Österreicher lieben
ihr Schweinsschnitzerl. Aber was bist du in Israel? Nichts als noch ein
weiterer Jud."
Er nimmt mir diese Äußerung nicht übel.
Die Freunde gehen einer nach dem anderen, bis schließlich nur mehr wenige
übrigblieben. Wir sprechen bis tief in den Abend hinein. Der Ober wechselt die
Aschenbecher. Das Café Museum ist Weißbergs eigentliches Zuhause, wo er seine
Forschungsberiche und seine Artikel schreibt und zahlreiche Bekannte empfängt.
Der Ober bringt ungefragt den Verlängerten. Und kurz vor der Sperrstunde sagt
er wie jeden Abend: "Sie können natürlich auch heute noch eine Viertelstunde
länger bleiben, Herr Weißberg."
"Ja, ja, wenn Sie dann das Licht ausmachen, gehen wir ... Und ... könnte ich
noch einen Kleinen Braunen haben? Zum Abschluß des Abends?"
"Na gut, weil Sie es sind, Herr Weißberg."
Und du willst nach Israel auswandern? denke ich, während ich beobachte, wie er
den Kaffee schlürft.
Ich beschließe, zu Fuß nachhause zu gehen. In weniger als
einer halben Stunde habe ich die Stadt durchquert. Mitten auf der
Schwedenbrücke sehe ich Paula Rothfeld stehen. Im Café Museum hatte sie
während des ganzen Abends kein Wort gesprochen, nur eine Zigarette nach der
anderen geraucht. Sie hat ein weißes Jäckchen an, enganliegend, zu dünn für
das naßkalte Novemberwetter. Von der Ferne sieht sie aus wie eine kleine
Statuette aus Marmor.
Ich frage sie, ob sie auf der Brücke auf jemanden warte.
Nein, erklärt sie mir. Brücken eigneten sich einfach sehr gut zum Nachdenken.
Ob sie nicht mit zu mir nachhause kommen wolle, um noch ein wenig zu plaudern
und ein Gläschen Wein zu trinken, frage ich. Ich bin selbst erschrocken über
meinen Mut.
"Gut, gehen wir", sagt sie, und nun bin ich so verblüfft, daß ich für die
nächsten Minuten stumm bin.
Bis zur Wohnung sind es dreihundert Meter. Ich versuche, das Schloß so leise
wie möglich umzudrehen, um meine Eltern nicht zu wecken. Dennoch geht das
Licht an. Meine Mutter steht im Vorraum, hat nur ein Nachthemd an, gähnt. Als
sie Paula sieht, lächelt sie und sagt: "Grüß Gott", "Viel Spaß" und "Gute
Nacht" und geht wieder zurück ins Schlafzimmer.
"Das ist mir peinlich", sagt Paula. "Ich gehe lieber wieder."
"Nein, nein. Meine Eltern sind das gewohnt. Das macht nichts."
"Ach so."
Ich spüre, wie ich rot werde.
In Wirklichkeit ist es über ein Jahr her, daß ich ein
Mädchen mit nachhause gebracht habe. Ich höre schon die Kommentare meiner
Eltern am nächsten Morgen. Meine Mutter wird über Verhütungsmethoden reden,
und mein Vater grinsen und meinen, daß es schon höchste Zeit gewesen sei, daß
er in meinem Alter viel mehr für seinen "täglich notwendigen
Geschlechtsverkehr" getan habe und daß ich lethargisch und erfolglos sei und
lieber meine Zeit vor dem Fernsehapparat verbringe, anstatt auf Frauenfang zu
gehen.
Ich führe Paula in mein Zimmer, bitte sie, auf dem Sofa Platz zu nehmen, gehe
in die Küche, um eine Flasche Rotwein und Gläser zu holen. Als ich
zurückkomme, steht Paula vor meinem Bücherregal. Etwa die Hälfte meiner Bücher
sind auf Russisch. Ich beginne, ihr zu erklären, welche Bücher ich schon
gelesen habe, welche mich besonders beeindruckt haben und was ich an der
russischen Literatur allgemein schätze. Ich spreche ziemlich lange, bis ich
merke, daß sie nichts sagt, steht nur da, leicht vorgebeugt, mit einem
ironischen Lächeln auf den Lippen. Auf einmal komme ich mir dumm vor und
murmle verlegen: "Ich lese eben gern."
"Ich weiß. So habe ich dich also richtig eingeschätzt. Ein Bücherwurm."
"Liest du keine Bücher?"
"Doch, doch", sagt sie, lacht, und ich fühle mich noch unsicherer. Ich
entkorke die Weinflasche, schenke ein.
"Ich beobachte gern die Menschen", erklärt sie, "dann mache ich mir meine
Gedanken über sie, versuche sozusagen ein Persönlichkeitsprofil zu erstellen.
In den meisten Fällen erweist es sich als zutreffend."
"Du studierst Psychologie, glaube ich."
"Ja, im dritten Semester. Trotzdem kenne ich mich bei Menschen aus, obwohl
einem ja beim Studium die Menschenkenntnis ausgetrieben wird. Ich werde es
aber abschließen, das Studium. Was ich einmal anfange, führe ich zuende."
Wir stoßen an.
"Auf Daniel Weißbergs Übersiedlung nach Israel. Möge er dort glücklich
werden."
"Mhm", murmelt sie mit ernster Miene, macht einen kleinen Schluck, setzt sich
auf das Sofa, schlägt die Beine übereinander und beobachtet aufmerksam, wie
ich mit dem Glas in der Hand im Zimmer stehe und nicht entscheiden kann, ob
ich mich ebenfalls auf das Sofa oder auf den Sessel setzen soll. Am liebsten
würde ich ihr den Arm um die Schultern legen. Doch fraglos wäre dies zu
forsch, und so entscheide ich mich für den Sessel.
"Wie ist denn mein psychologisches Profil, sieht man einmal davon ab, daß ich
ein Bücherwurm bin", frage ich nach einer weiteren kurzen Pause.
"Du erwartest doch nicht, daß ich diese Frage beantworte", sagt sie.
"Nein, ich habe mir gedacht, weil du ja das selber angesprochen hast... Aber
natürlich, ich wollte nicht... Ich war nur neugierig... Also, ich meine,
vergiß es..." Ich breche ab und frage mich, warum ich denn immer, immer das
Falsche sagen muß. Kein Wunder, daß ich keine Freundin habe, denke ich.
"Bitte entschuldige", sage ich.
"Wofür entschuldigst du dich?"
Nun bin ich endgültig verlegen, trinke das Weinglas in einem Zug leer und
frage schnell: "Hast du nie daran gedacht, so wie Daniel, nach Israel zu
übersiedeln?"
"Ich war schon mehrere Male in Israel. Aber ich bin nach
jüdischem Gesetz keine Jüdin. Meine Mutter ist Christin."
"Ach so, natürlich, ich verstehe. Ich glaube, du hast schon einmal davon
gesprochen. Ich hatte es ganz vergessen."
"Es gibt Menschen, die vergessen solche Sachen nie, am wenigsten vergißt man
solche Sachen in Israel. Auch bei uns gibt es einige, denen das ein Problem
ist."
"Also für mich ist Judentum eine Schicksalsgemeinschaft", erkläre ich. "Wenn
dein Vater Jude ist, genügt das, meiner Ansicht nach, daß du an der
Schicksalsgemeinschaft teilhast. Wir alle machen ähnliche Erfahrungen."
"Mir war klar, daß du so denkst. Du bist schließlich Russe, hast mit Religion
nichts am Hut."
Schweigen.
Sie greift nach der Flasche, schenkt ein, trinkt, zündet sich eine Zigarette
an.
"In jedem Fall hast du es leichter als ich", sagt sie.
Sie hebt die Augen, scheint den Luster über meinem Kopf zu beobachten, hat das
Glas wieder auf den Tisch gestellt, schwankt offensichtlich, ob sie
weiterreden soll oder nicht, beginnt ihre Brille zu putzen. Ich habe den
Eindruck, daß sie mir diese Nacht noch viel erzählen wird, und ich weiß, daß
ich jetzt schweigen und warten und daß ich ihr Zeit lassen muß. Ein leichtes
Mißtrauen huscht über ihr Gesicht. Ein einziges Wort nur und alles ist
zerstört.
Während ich warte, kommt mir jener Abend in den Sinn, als ich das erste Mal
den Jüdischen Club aufsuchte. Es war Winter. Ich ging an der Tür vorbei,
senkte den Blick, beschleunigte den Schritt. Meine Nervosität kroch von den
eiskalten Zehen in die behandschuhten Hände, deren Finger in schmerzvoller
Unbeweglichkeit erstarrten. Aufgehellt und bis zur Undeutlichkeit verzerrt
erschienen im gleißenden Licht der Straßenlaternen die Gesichter der
Passanten, die an mir vorbeieilten. Gern wäre ich wieder in diese fast uniform
wirkende Menge eingetaucht.
Auf der blaugestrichenen Tür aus schwerem Eisen, die an den
Liefereingang eines Gewerbebetriebes erinnerte, war die Aufschrift kaum noch
lesbar. Bei genauerem Hinsehen erkannte ich den Davidstern, einst weiß, jetzt
in dutzende graue Lackreste zersplittert: Club Jüdischer Jugend Wiens. Die
Passanten schoben sich die Wollmützen in die Stirn, um sich dem Zugriff des
eisigen Windes zu entziehen, verkrochen sich in die Krägen ihrer Mäntel. Der
Standort des Clubs war strategisch günstig gewählt. Nichts lud hier zum
Verweilen ein, kein Beisl, kein Kaffeehaus, kein Geschäft war in der Nähe. Nur
ein chinesisches Restaurant war kürzlich an der Ecke eröffnet worden. Seine
Gäste kamen immer aus der anderen Richtung, dort wo sich die geschäftige
Durchzugsstraße mit ihren Modeboutiquen und bunten Vitrinen befand.
Ich läutete, stellte mich direkt vor das Guckloch und versuchte ein so
freundliches Gesicht wie möglich zu machen. Die Tür öffnete sich. Zwei gut
gekleidete junge Männer musterten mich von Kopf bis Fuß. Einer von ihnen trug
eine Kippa.
"Wer sind Sie? Was wollen Sie?"
Zuerst stammelte ich etwas, das ziemlich unsinnig geklungen
haben muß, erklärte aber schließlich doch, daß ich Jude sei.
"Woher sollen wir wissen, daß du wirklich Jude bist?" Der mit der Kippa
grinste spitzbübisch, während der andere desinteressiert, sogar etwas
stumpfsinnig an mir vorbeischaute.
"Soll ich die Hosen runterlassen?" fragte ich.
"Schon gut. Geschieht ja alles zu deiner eigenen Sicherheit. Nenn uns lieber
ein paar Namen."
Ich nannte die Namen einiger jüdischer Studenten, von denen ich wußte, daß sie
Clubmitglieder waren.
"Woher kommst du? Wo bist du geboren?"
Ich schilderte meine doch recht abenteuerliche
Lebensgeschichte in wenigen Sätzen. Mir war kalt.
"Schon wieder ein Russe", sagte der junge Mann mit der Kippa und seufzte. "Na
gut, komm rein."
Als ich in den Raum trat, blickte kaum jemand auf. Die Clubmitglieder saßen
oder standen in kleinen Gruppen beisammen. Die Konservativen. Die Orthodoxen.
Die Nichtreligiösen. Die lokale jüdische Schikkeria. Die Söhne und Töchter
reicher Eltern, die am Kartentisch vierstellige Beträge verspielten. Die
russischen Juden aus Zentralasien und Transkaukasien, die Sefarden. Die
russischen Juden aus dem europäischen Teil der Sowjetunion - das waren die
wenigsten. Die meisten von ihnen kannte ich schon. Um sie zu treffen, brauchte
ich den Jüdischen Club nicht. Aber die Grüppchen blieben unter sich. Es
sollten Wochen vergehen, bevor ich mir im Club einen Bekanntenkreis aufbauen
konnte.
Daniel Weißberg, der auf alles eine Antwort wußte, erklärte mir einmal: "Die
jungen Juden in diesem Land tragen das Mißtrauen ihrer Väter und Großväter in
sich, unauslöschlich, allesbeherrschend. Sie begegnen dir verschlossen und
unfreundlich, weil sie Offenheit nie gelernt haben. Du kannst das nicht
verstehen. Ihr russischen Juden habt nicht diese Geschichte, ihr und eure
Eltern habt die Gemeinheiten von Wien nie kennengelernt, sondern nur klare
Grenzen. Und wer klare Grenzen kennt, der kann auch klar unterscheiden und
sich beizeiten sogar sicher fühlen."
Keine Frage, dieser Daniel Weißberg war ein kluger Kopf. Doch seine Brillanz
half mir nicht weiter.
Paula streicht ihre Haare glatt, richtet den Kragen ihrer Bluse, macht einige
Male den oberen Knopf auf und zu, nimmt das Weinglas in die Hand und stellt es
wieder auf den Tisch zurück, wendet sie sich ab und dann mit einer schnellen
halben Drehung ihres Körpers wieder mir zu. Ich denke, daß es schamlos wirken
muß, sie anzustarren.
"Zuerst habe ich verheimlicht, daß ich eine nichtjüdische Mutter habe", sagt
sie schließlich. "Ich bin stundenlang im Club gesessen und habe die anderen
beobachtet. Ich dachte mir: hier siehst du, wie du hättest werden können."
"Willst du denn so sein?" frage ich. Sofort kommen mir meine Worte blödsinnig
vor.
Sie gibt mir keine Antwort, blickt zu Boden, dann auf die Uhr, dann zur Tür.
"Es gibt da einen, den David Rosenberg, du kennst ihn sicher, den großen
Dürren, mit dem Käppi, der sich immer aufspielt wie der König der Juden."
"Was ist mit ihm?" frage ich.
"Irgendwann hat er begonnen, mich mit einer blauäugigen Blonden aus Rußland,
der Sveti Nefitz, zu verwechseln. Dabei ist sie eine stattliche Erscheinung,
die Sveti, während ich doch eher klein und zierlich bin. Sveti ist ebenfalls
nur zur Hälfte Jüdin. Und dieser David Rosenberg hat plötzlich nicht mehr
geredet mit mir und hat sich demonstrativ abgewendet, wenn ich mich ihm zu
nahe kam. Bis ich verstand, daß er mich mit Sveti verwechselte, hat es eine
ganze Weile gedauert. Doch einmal hörte ich ihn von Sveti, der Nichtjüdin
reden, die im Club eigentlich nichts verloren habe, und er nickte in meine
Richtung... Es wurde mir so übel. Aber ich habe das Mißverständnis natürlich
nicht aufgeklärt. Sollte ich etwa sagen: Ich bin nicht die Sveti. Ich bin
schon jüdisch, also sei nett zu mir? Das wäre außerdem gelogen. Nach der
Halacha bin ich Nichtjüdin. Er hat ja auf seine Weise die Wahrheit erkannt.
Vielleicht hat ihm der Herr ein Zeichen gegeben." Sie kichert.
"David ist ein präpotenter Dummkopf. Ist es wichtig, ob er dich grüßt oder
nicht?"
Sie blickt mich mit einem mitleidigen Lächeln an.
"Du verstehst mich nicht. Du kannst mich nicht verstehen."
Schweigen.
"In der Großen Mohrengasse steht ein altes Haus", sagt sie.
"Wenn ich dort vorbeigehe, schaue ich immer in die beiden großen Fenster links
im dritten Stock. Meine Großeltern haben dort gewohnt. Bis 1938. Dann hat man
meinen Großvater abgeholt, nach Dachau gebracht, später nach Auschwitz. Meine
Großmutter konnte zusammen mit meinem Vater nach Australien auswandern, ist
aber 1950 wieder nach Österreich zurückgekehrt. Manchmal gehe ich am
Freitagabend in die Große Mohrengasse. Die Fenster sind hell erleuchtet. Der
Sohn des Arisierers, ein erfolgreicher Arzt, ein Gynäkologe, wohnt immer noch
dort. Und ich stelle mir vor, wie mein Großvater mit seiner Familie am
Schabbattisch gesessen ist, im Schein der Kerzen. Mein Großvarter ist vergast
worden. Auch Davids Großeltern sind in Auschwitz vergast worden."
Wieder Schweigen.
"Ich habe an jenem Abend, als David von Sveti, der
Nichtjüdin, geredet und in meine Richtung gedeutet hatte, den Club verlassen,
bin durch die Straßen geirrt, den Kopf ganz eingezogen, den Rücken rund wie
eine Katze. Ich wünschte mir, eine Bande antisemitischer Jugendlicher würde
mich überfallen, mich zusammenschlagen, so daß ich die Wunden herzeigen könnte
und schreien: Seht her! Ich wünschte mir, ich hätte eine jüdische Nase."
Ich verstehe und empfinde, vielleicht das erste Mal in meinem Leben, das
Gefühl "auf der anderen Seite" zu stehen. Zum ersten Mal bin ich nicht in
jenem Randbereich, wo die Konturen fließend werden und die Sicherheit über
sich selbst und die anderen zu schwinden beginnt. Ich bin unumstößlich und
ohne jeden Zweifel Jude, einerlei ob nach der Halacha oder den Nürnberger
Rassegesetzen. David Rosenberg mag mich verachten, weil ich ein "Russe" und
ein Ungläubiger bin, aber er gibt mir immer die Hand. Ich erschrecke und
schäme mich ein wenig, als mir klar wird, daß ich mich eigentlich über diesen
Umstand freue.
"Die Geschichte mit David hat noch eine Fortsetzung", sagt
Paula. "Da warst du noch nicht im Club, und man hat es dir sicher nicht
erzählt, sowas erzählt man ja nie... David hat herausgefunden, daß nicht
Svetis Mutter keine Jüdin, wie er ursprünglich geglaubt hatte, sondern ihr
Vater Nichtjude ist. Eigentlich ist ja sogar Svetis Mutter nur zur Hälfte
Jüdin, wie ich später erfahren habe, aber die Großmutter mütterlicherseits war
Jüdin, und auf die kommt es an. David hat das also erfahren und war ganz
zerknirscht und ist mir eines Abends förmlich entgegengeflogen und hat meine
Hand so heftig geschüttelt, daß es wehtat. Ja, grüß dich! hat er ganz laut
ausgerufen, so daß es alle hören konnten. Wie geht's denn so, Sveti? Darf ich
dir ein Gläschen Wein spendieren? Da habe ich richtig zu brüllen begonnen, daß
ich nicht die Sveti, sondern die Paula bin und daß meine Mutter Christin ist,
nur daß er's weiß, ein für allemal. Und wenn ihm das ein Problem ist, dann
soll er meinetwegen zur Hölle fahren."
"Und er?"
"Zuerst ist er zurückgewichen, ist bleich geworden, wollte etwas antworten,
doch da stand plötzlich die Sveti vor uns, die sonst ja nur selten im Club
erscheint, aber ausgerechnet an diesem Abend gekommen ist und gerade den Raum
betreten hatte. Die Sveti steht also vor uns - wie gesagt, eine stattliche
Erscheinung, ich frage mich ja wirklich, wie man uns beide verwechseln kann -
und sagt: Ich höre, es wird von mir geredet. Hier bin ich. Nun ja. Der David -
es war wirklich ein Vergnügen, ihm zuzuschauen - ist ganz kleinlaut geworden,
hat etwas gestammelt, ist rot angelaufen, hat einen richtigen Schweißausbruch
gehabt. Dann haben alle im Club zu lachen begonnen. Sogar die Ultraorthodoxen
haben geschmunzelt. Das Ganze war ja wirklich irgendwie lustig."
Wir reden noch lange. Als es draußen hell wird, schalte ich
das Licht aus, setze mich auf das Sofa und umarme Paula. Sie läßt es gewähren,
ohne etwas zu sagen. Ich frage sie, ob sie sich hinlegen möchte. Sie nickt.
Wir ziehen uns aus, kriechen ins Bett. Meine Hand streichelt ihre Schultern,
ihre Brüste, ihren Bauch, ihre Oberschenkel. Sie faßt mich am Handgelenk.
"Nein", sagt sie. "Ich will das nicht. Nicht nach dieser Nacht. Nicht jetzt."
Bevor sie einschläft, flüstert sie mir ins Ohr: "Ich habe doch gewußt, daß
meine psychologischen Profile immer stimmen. Dich habe ich richtig
eingeschätzt."
Als ich gegen Mittag aufwache, ist sie weg. Ich finde ihre Nummer im
Telephonbuch und rufe sie an. Nein, sie wolle mich diesen Abend nicht treffen,
erklärt sie.
Einige Tage später sehe ich sie im Club. Sie wolle mich vorläufig nicht mehr
besuchen kommen, wolle auch nicht mit mir ausgehen. Vielleicht habe sie mir in
jener Nacht zu viel erzählt. Sie wisse selbst nicht so genau, müsse mit sich
selbst und ihren Gefühlen ins Reine kommen. Ich solle ihr Zeit geben.
In den folgenden Monaten kommt sie seltener in den Club. Wir sprechen kaum
miteinander.
Ein halbes Jahr später feiern wir Daniel Weißbergs Rückkehr nach Österreich.
Daniel sitzt im großen Schaukelstuhl, der mitten im Zimmer seiner kleinen
Garconière steht, und gibt in zahlreichen, mitunter geistreichen Anekdoten
israelischen Impressionen von sich. Auf eine vielversprechende Karriere als
Wissenschaftler in Israel hat er verzichtet. "Wien entkommt man nicht",
erklärt er. "Es ist wie ein wildes Tier, das seine scharfen Zähne in deinen
Hals gebohrt hat. Es läßt nicht mehr los."
"Trinken wir auf den Masochismus!" sagt jemand.
"Jedenfalls ist es schön, daß du wieder da bist."
Man schöpft aus einer in einem großen Bottich in der
Kochnische stehenden, auf Äpfel- und Orangenbasis zubereiteten Bowle, in die
einer der Gäste auch noch eine halbe Wodkaflasche gekippt hat. Man trinkt,
plaudert, hört zu, kommentiert, sinniert über Israel, Österreich, die Juden,
Waldheim und die beginnende Intifada. Wien hat Daniel Weißberg wieder.
Immer neue Gäste und Gästegruppen treffen ein. Die Bowle schwindet, und die
Stimmung wird ausgelassener. Die Musik wird lauter gedreht. Die Umarmungen und
Küsse auf dem Sofa werden heftiger. Einige sitzen schon stark angeheitert auf
dem Boden, trinken weiter, rauchen.
Gesättigt von unzähligen Gesprächen, mit einer leichten Übelkeit im Magen von
der schnell heruntergewürgten kalten Buffetkost, ziehe ich mich in eine Ecke
der Kochnische zurück, trinke Wasser, möchte einige Augenblicke allein sein.
Ein Ausruf, der den allgemeinen Lärm überlagert, läßt mich aufhorchen: "Das
ist geschmacklos! Da mache ich nicht mit."
Ich gehe ins Zimmer zurück und sehe wie der dicke Benjamin, der allgemein
anerkannte Spaßmacher des Clubs, eine Audiokasette in die Höhe hält, die ihm
andere zu entreißen versuchen.
"Aber das ist doch nur Spaß!" sagt Benjamin und lacht. "Die Leute kommen zu
einer jüdischen Party. Doch statt einem Fest, ist es dunkel und still. Statt
Schalom hören sie die Worte des Führers."
Schließlich verstehe ich den Grund der Aufregung. Benjamin hat eine Kasette
mit einer Rede Adolf Hitlers mitgebracht. Wenn es das nächste Mal an der Tür
läutet - verspätete Besucher treffen immer noch ein - möchte er das Licht aus-
und den Kasettenrekorder einschalten. Man könne Wetten darauf abschließen, wie
die Reaktion des Neuankömmlings sein wird. Zweifellos werde er einige
Augenblicke lang meinen, er sei in eine Falle geraten, von rechtsradikalen
Fanatikern oder Ewiggestrigen umgeben, die Hitlers Geburtstag feiern.
"Tatsächlich!" höre ich jemanden ausrufen. "Heute ist ja wirklich der
zwanzigste April, Hitlers Geburtstag."
"Das ist widerlich. Kann nur dem Benjamin einfallen."
"Wenn jemand kommt und sowas hört, wird er sich zu Tode erschrecken. Das ist
unverantwortlich", meint ein anderer.
"So ein kleiner Schock kann nicht schaden", erklärt Benjamin. "Um nicht zu
vergessen, in welchem Land wir leben."
Es entbrennt ein heftiger Streit, ob das Ganze nun wirklich eine gute Idee
sei.
"Und wenn die Nachbarn die Polizei holen", möchte jemand
wissen. "Was sollen die Polizisten denken, wenn sie UNS sehen."
"Wer holt schon die Polizei wegen einer Hitlerrede. Schließlich leben wir in
Österreich."
Daniel Weißberg erhebt sich mit Mühe aus seinem Sessel. "Freunde!" sagt er mit
schwerer Zunge. "Wie ihr alle wißt, ist Benjamin ein Narr. Aber Narren gebührt
die Narrenfreiheit der Weisen." Er nimmt Benjamin die Kasette aus der Hand,
schwankt zum Kasettenrekorder, legt die Kasette ein, geht vorsichtig, wobei er
sich an der Wand abstützen muß, zum Lichtschalter.
Wir sitzen in der Finsternis und warten. Kurze Zeit herrscht vollkommene
Stille. Wohnungstür im Visier. Bestimmt wird jetzt niemand mehr kommen, denke
ich. In wenigen Minuten ist der Spuk vorbei. In diesem Augenblick läutet es an
der Tür. Ein Tuscheln und Kichern geht durch den Raum, das sogleich von
Hitlers heiserer, hysterischer Stimme übertönt wird – es geht um die
"Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa".
Das Licht geht wieder an. Ich erkenne den neuen Gast. Es ist Paula. Ihren
Gesichtsausdruck werde ich nie vergessen.
Hitler verstummt. Manche beginnen zu lachen, zu pfeifen, zu klatschen.
"Scherzchen, Scherzchen", sagt jemand im Singsang. Die übertriebener
Fröhlichkeit seiner Stimme wirkt gespenstisch.
"Gratuliere!" sagt Paula. "Die Überraschung ist euch prächtig gelungen."
Sie dreht sich um, will gehen, wird umringt, festgehalten, auf das Sofa
gedrückt.
"Es war doch alles nur Spaß", versucht Benjamin zu erklären. "Vielleicht war
das ja wirklich nicht klug von uns."
"Das Ganze war nicht persönlich gemeint. Wir wußten ja gar nicht, wer kommt."
"Daß ihr mich nicht für einen Hitlerfan haltet, davon gehe ich einmal aus",
bemerkt Paula trocken.
"Ach, sei doch nicht gleich so zynisch."
"Ich? Ich soll zynisch sein?" Paula lacht gequält.
"Zynismus ist Balsam für unsere Verletzungen." Ist das nicht
die Stimme von Daniel Weißberg? Der Gastgeber ist nicht mehr in der Lage, sich
aus seinem Schaukelstuhl zu erheben. Doch auch betrunken bleibt er ein
messerscharfer Analytiker. "Man könnte unseren Zynismus als Befreiungsschlag
in einer aus dem Lot geratenen Welt sehen, als eine Paraphrase auf den
brutalen Zynismus, der uns umgibt, als die Bündelung einer Gefühlswelt, die
..." Er beendet den Satz nicht, schließt die Augen.
Paula ist wieder aufgestanden.
"Es tut mir leid!" murmelt Benjamin.
Paula geht zum Kassettenrekorden und schaltet ihn wieder ein. Keiner hindert
sie daran. Hitlers Stimme schwillt zum dröhnenden, geistesgestörten Brüllen
an, während sie am Volume-Knopf dreht. Ich gehe auf Paula zu, fasse sie am
Arm, überlege mir eine nette und versöhnliche Phrase, aber es fällt mir keine
ein. Sie stößt mich von sich. Ihre Lippen bewegen sich kaum merkbar, unhörbar,
so als würde sie die Worte des Führers nachflüstern.
Nachdem Paula gegangen ist, herrscht einen Augenblick Stille. Dann eine leise
Stimme: "Ich habe von Anfang an gesagt, daß das keine gute Idee ist. Aber auf
mich hat ja keiner gehört. Auf mich hört ja nie jemand. Wenn ihr nur auf mich
gehört hättet..."
Eine andere Stimme: "Geh, hojt die Papp’n!"
Und plötzlich reden alle wild durcheinander, und es wird an diesem Abend noch
das eine oder andere gehässige Wort fallen.
Ich beschließe, Paula am nächsten Tag anzurufen, um zu erklären, zu glätten,
auszugleichen, zu beruhigen. Das schlechte Gewissen läßt sich nicht beruhigen.
Ich gehe nachhause, lege mich ins Bett, kann lange nicht einschlafen, wache
erst gegen Abend auf. Als ich zum Telephonhörer greife, erscheinen mir all die
schönen Sätze, die ich mir im Geist zurechtgelegt habe, plötzlich banal,
gegenstandslos, und so rufe ich dann doch nicht an, auch am nächsten und
übernächsten Tag nicht und sehe Paula, die nach diesem zwanzigsten April nicht
mehr in den Club kommt, nie mehr wieder.
Vladiir Vertlieb, geb 1966 in Leningrad, emigrierte 1971 mit
seiner Familie nach Israel. Von 1971 - 1981 Odyssee durch Europa, Israel und
die USA, seit 1981 ständiger Wohnsitz in Österreich.
|