|
Wie bereits angedeutet bestimmten die verschiedenen
Farben, Nummern und einige andere Kennzeichen die "soziale Lage"
eines KZ-Häftlings und damit in erster Linie seine Überlebenschancen.
Sie waren ein Bedingungsfaktor der extremen Ungleichheit im Lager, bestimmten
auch an diesem Ort die "Über- und Untermenschen", versahen die Häftlinge mit
Macht und Geltung und entschieden in letzter Konsequenz über Leben und Tod. Denn
während "Unzählige im Elend verhungerten, führten wenige Häftlinge ein geradezu
luxuriöses Leben. Während viele an körperlicher Plackerei zugrunde gingen,
brauchten andere gar nicht zu arbeiten. Während die meisten in ständiger Angst
vor Gewalt lebten, konnten einige ungestraft quälen und töten."
Mit der Zeit bildete sich im Lager eine gewisse Häftlingshierarchie heraus. Über
die Stellung, die Behandlung sowie über die Lebensbedingungen eines Gefangenen
entschied jedoch nicht nur die Kategorie, welcher er zugeteilt wurde, sondern
auch die Nationalität, die Länge der Gefangenschaft, der politische Hintergrund,
Beziehungen zum Lagerpersonal, das Arbeitskommando sowie sein
Organi-sationstalent. An der Spitze dieser Hierarchie standen in allen
Konzentrationslagern stets die deutschen, an unterster Stelle wiederum stets die
jüdischen Häftlinge. Die übrigen Häftlingsgruppen verteilten sich auf die Mitte,
deren Rangordnung niemals endgültig war, sondern zu jeder Zeit von der SS
verändert werden konnte. In allen Lagern entbrannte daher ein regelrechter Kampf
um eine möglichst hohe Stellung innerhalb der jeweiligen Lagergemeinschaft,
die neben einem "gewissen Grad materieller Versorgung [...] auch Schutz vor der
SS"
bot. Die Lebensbedingungen und die Behandlung der Häftlinge durch die SS hingen
im Lager sehr eng zusammen. Die Unterbringung, Ernährung, Bestrafung, der
Gesundheitszustand sowie der Arbeitseinsatz der Gefangenen sind nur einige
Indikatoren mit denen diese erfasst und beurteilt werden können. Sie unterlagen
im Verlauf der KZ-Haft nicht selten einem enormen Wandel, welcher im Folgenden
anhand der nichtjüdischen, "roten" tschechischen Häftlinge untersucht werden
wird.
Nach W. Sofsky stellten die tschechischen Häftlinge in
den Konzentrationslagern eine Sondergruppe dar, da sie im Gegensatz zu Polen und
Russen nicht als "slawische Unter-menschen, sondern als Angehörige einer
benachbarten Bevölkerung (galten), die man zeit-weise sogar ,eindeutschen’
wollte."
Ihre Behandlung in den Konzentrationslagern war daher im Hinblick auf ihre
Nationalität durchaus besser als die der Polen, Russen, Franzosen oder
Italiener, jedoch weit schlechter als die der Deutschen oder Österreicher.
Sofsky zählt die tschechischen Häftlinge zusammen mit deutschen "Asozialen",
Bibelforschern und Nordeuropäern zur "oberen Mittelklasse" des "sozialen Feldes"
im KZ und betont dabei, dass, während "der Abstand von der Aristokratie
zur Mittelklasse besonders kraß war, [...] die Differenz zwischen der
Mittelklasse und den Parias häufig in nicht mehr als einem Stückchen Brot"
bestand. Die Lage der Tschechen war demnach zunächst nicht durch einen erhöhten
Vernichtungsdruck gekennzeichnet. Doch das bedeutete nicht, dass sie im Lager
von Anfang an unbedingt bessergestellt waren. Nach der Ankunft der ersten
größeren Gruppe tschechischer Häftlinge im Juni 1939, rangierten sie zunächst
zusammen mit den Juden am unteren Ende der Häftlingshierarchie. Ihnen fehlten
notwendige Kenntnisse über die strikte Lagerordnung sowie über wichtige
Überlebensstrategien und vor allem Beziehungen zum Lagerpersonal. Sie wurden im
Block Nr. 19 von den übrigen Häftlingen streng isoliert, durften untereinander
nicht in ihrer Muttersprache sprechen, und viele von ihnen wurden in die
gefürchtete "Strafkompanie" versetzt, in der sich ihre Lebensbedingungen
zusätzlich verschlechterten. "Die Menschen in dieser Strafkompanie arbeiteten
geschlossen sehr schwer auf dem Bau oder am Kanalisationssystem, durften nur
einmal im 1 Jahr nach Hause schreiben und bekamen weit weniger Essen und Brot.
Das Rauchen und die Kantinenbesuche waren für sie verboten. Jeglicher Kontakt zu
ihnen war unmöglich."
Diese Häftlinge litten an chronischem Hunger und vollkommener Erschöpfung, da
sie weniger Essen bekamen und keine Erholungsmöglichkeiten hatten. Sie waren
bevorzugte Objekte für etliche Schikanen und Misshandlungen durch die SS und
wurden schließlich meist in ein anderes Lager überführt, in dem sie als
Neuzugänge erneut massivem Terror ausgesetzt waren. Auch die Aufnahme der
Tschechen in das "Revier" war in der ersten Zeit, ähnlich wie bei jüdischen
Häftlingen, unerwünscht. Diejenigen, die nicht in die Strafkompanie versetzt
wurden, arbeiteten auf der "Plantage", dem größten Arbeitskommando des Lagers,
in welchem die Häftlinge besonders brutal behandelt wurden. "Die Menschen wurden
von einer Meute von Kapos und Hilfskapos gejagt, die sie mit aus Kabeln
angefertigten Knüppeln oder mit Spaten-schäften schlugen."
Die Gefangenen waren dort schutzlos jeder Witterung ausgeliefert und arbeiteten
ohne Erholungsmöglichkeit oft "bis zum völligen Zusammenbruch".
Mit dagegen vollkommen anderen Lebensbedingungen wurden
die "Protektoratshäftlinge"
bei ihrer Ankunft im Lager konfrontiert. Diese Tschechen wurden von der
Lagerführung sowohl in Dachau als auch in Buchenwald als sogenannte
Vorzugshäftlinge behandelt und erhielten damit zahlreiche Privilegien. Wie
bereits erwähnt, wurden sie besonders gekenn-zeichnet und mit roten Armbinden
versehen. Sie wurden ebenfalls von den übrigen Lager-insassen isoliert. Im
Gegensatz zu ihren Landsleuten sollten sie jedoch einer "in jeder Hinsicht
korrekte(n) Behandlung" unterzogen werden, was im konkreten Fall bedeutete,
dass sie "nur nach Wunsch geschoren" wurden, dass sie außerhalb der
Arbeitszeit rauchen und lesen durften und besonders bei Krankmeldungen in den
Genuss einer "bevorzugte(n) Behandlung"
kommen sollten. Kašák bestätigt diese milderen Umstände und fügt hinzu, dass in
diesem "privilegierten Block" überhaupt nicht gearbeitet wurde.
Die Gründe für ein solch bevorzugtes Verfahren mit den tschechischen Geiseln
korrespondieren weitgehend mit der vorsichtigen Besatzungspolitik im Protektorat
Böhmen und Mähren zu dieser Zeit. Heinrich Himmler äußert in einem Brief an
Freiherr von Neurath, dass er mit dem Befehl zur besonderen Bewachung und
Behandlung der festgenommenen Tschechen dem "Wunsche"
des gemäßigten Reichsprotektors entsprach. Außerdem stellt er fest, dass
"diese Maßnahme im Grundsätzlichen richtig war", was "schließlich nicht
zuletzt die bisherige ruhige Gesamt-lage im Protektorat"
beweise. Damit enthüllt er die Pragmatik, die sich hinter dem angeblich milden
Umgang mit den Tschechen seit März 1939 sowie zu Kriegsbeginn verbarg. Anfang
September wurde nämlich eine bedeutende Anzahl deutscher Soldaten aus dem
Protektorat an die polnische Front abgezogen und aufgrund des Aufsehens, welches
die Verhaftungsaktion "Albrecht I." bei der tschechischen Bevölkerung erregte,
wollten die Besatzer offensichtlich durch die mildere Behandlung der
"Protektoratshäftlinge" zu weniger gefährlichen Unruheherden in dem okkupierten
Land beitragen.
Im Herbst 1939 wurde das KZ Dachau geräumt und sämtliche
Häftlinge wurden in andere Lager evakuiert. Wie bereits erwähnt, gelangte der
überwiegende Teil der tschechischen Häftlinge nach Buchenwald. Dort wurden die
"Protektoratshäftlinge" mit der anderen Gruppe von Tschechen zusammengelegt,
welche ebenfalls im Zuge der "Aktion Albrecht I." verhaftet und ins
Konzentrationslager überführt worden war. Sie genossen auch in diesem Lager bis
Herbst 1941 zahlreiche Privilegien und wurden offiziell als "Ehrenhäftlinge"
registriert.
Als im Jahr 1940 hunderte neuer Tschechen nach Dachau
deportiert wurden, war von einer bevorzugten Behandlung nichts mehr zu spüren.
Im Gegenteil: sehr viele Tschechen wurden gerade jetzt in die "Strafkompanie"
überführt und dadurch schlimmen Torturen ausgesetzt. Dieses Schicksal traf nun
überwiegend tschechische Offiziere, die bei der Flucht ins Ausland gefasst
worden waren. Edgar Kupfer-Koberwitz berichtet von der Begegnung mit einem von
ihnen, der "ein merkwürdig blutunterlaufenes Gesicht" hatte. ,Was hast
du gemacht?’ fragte ich ihn. ,Der Stubenälteste hat mit mir gesprochen –
physisch’, war seine Antwort."
Nur kurze Zeit später wurden die meisten tschechischen Offiziere in andere KZs
überstellt und dort erneut terrorisiert. Ähnlich erging es auch vielen anderen
Tschechen, sowohl im Jahr 1940 als auch im darauffolgendem Jahr, bis sie
offensichtlich die "Regeln" des Konzentrationslagers verinnerlicht hatten, und
allmählich begannen, das Lager zu verarbeiten. Doch auch die Haftdauer, die man
in den meisten Fällen an der Häftlingsnummer ablesen konnte, wirkte sich auf die
Lebensbedingungen der Gefangenen enorm aus. Mit der Ankunft neuer
Häftlingsgruppen, "rückten die alten Kategorien in der Sozialstruktur auf", so
dass "eine eigentümliche soziale Mechanik in Gang" kam.
Mit der Ankunft der Tschechen bekamen etwa die österreichischen Häftlinge oder
die deutschen "Asozialen" einen höheren Status. Mit der Ankunft der Polen und
Russen rückten wiederum die Tschechen in der Hierarchie auf.
Die verschärfte Besatzungspolitik im Protektorat seit
Heydrichs Machtübernahme fand im Gegensatz zu anderen Konzentrationslagern, wie
etwa Mauthausen, in Dachau nur einen mäßigen Widerhall. Erst nach dem Attentat
im Mai 1942 verschärfte die SS die Behandlung der tschechischen Häftlinge
vorübergehend. Nach dem Bericht des Überlebenden František Zatloukal wurde
"jeglicher Hass und Wut der aggressiven SS-Männer [...] auf die wehrlosen
Häftlinge tschechischer Nationalität übertragen."
Auch sein Mithäftling Josef Straka schildert, dass nach dem Attentat "noch am
gleichen Tag und noch einer ganzen Reihe von Tagen danach, alle Slawen auf dem
Appellplatz antreten mussten, wo uns die SS-Männer quälten und sich an uns
rächten. Später wurden nacheinander die Polen, die Serben und andere entlassen,
bis nur noch wir Tschechen stehen blieben."
Damit verwendete die SS das bewährte Mittel, die Häftlingsgruppen
gegeneinander auszuspielen. Doch diese Strategie schlug hier offensichtlich
fehl, da gerade in Dachau schon sehr bald der alte Status der Tschechen
wiederhergestellt werden konnte.
Für diese Tatsache spricht auch, dass sich viele Überlebende, wie etwa Stanislav
Zámečník, František Kadlec und Radovan Dražan an eine massive Verschlechterung
der Lebensbedingungen nicht mehr erinnern können.
Bei seiner Ankunft im Lager war zunächst jeder Häftling
auf die Hilfe der Mitgefangenen angewiesen. Sie mussten ihm die neuen
Verhaltensregel erklären und ihm die wichtige Hoffnung auf ein Überleben machen.
Die meisten Neuzugänge erlitten bei der Aufnahme-prozedur einen regelrechten
Schock, der nicht selten mehrere Tage andauern konnte. "Die anfängliche
Bestürzung wich Empörung, die wiederum Entsetzen auslöste. Der Schock zog umso
verheerendere Folgen nach sich, je weniger man psychisch auf diese Situation
vorbereitet war."
František Kadlec sagte etwa aus, dass er in den ersten Tagen einen
ungeheuerlichen Drang zu schreien verspürte. In der ersten Zeit waren die
Neulinge besonders bedroht, da sie von der SS bevorzugt schikaniert wurden.
Zámečník stellt fest, dass die "höchste Sterblichkeit [...] in den drei Monaten
nach dem Eintreffen im Lager (herrschte); in dieser Zeit kamen die Schwachen,
die Kranken und diejenigen ums Leben, die nicht in der Lage waren, sich den
brutalen Lebensverhältnissen anzupassen."
Begünstigt wurden die Lebensbedingungen vieler nationaler Häftlingsgruppen mit
der Einführung der Nationalitäten-blöcke im Jahr 1940. Diese Maßnahme war zwar
keineswegs für ein engeres Zusammen-rücken der Häftlinge gedacht, doch erzielte
sie bereits nach kurzer Zeit genau diesen Effekt. Die Tschechen wurden bei der
Neubesetzung des Lagers im Block Nr. 10 untergebracht.
Die Blöcke mit geraden Nummern befanden sich alle auf der linken, westlichen
Seite, und die Bewegung in ihnen war weitgehend frei. Die ungeraden Blöcke waren
dagegen separat eingezäunt, und es war strikt verboten, sie zu betreten. Auf
dieser rechten Seite befanden sich neben dem Revier die "Strafkompanie" und
kurze Zeit später auch der "Zugangsblock". Dieser wurde seit dem Frühjahr 1941
eingeführt, und die Häftlinge mussten hier nach ihrer Ankunft eine mehrwöchige
Quarantänezeit über sich ergehen lassen.
Der zehnte Block war, wie alle anderen auch, in vier
Stuben unterteilt. Radovan Dražan schildert, dass er sehr froh war dort wieder
seine Landsleute zu treffen. "Ich konnte dort mit den Kameraden tschechisch
sprechen, [...] das war schon besser. Dann waren wir schon zu zweit oder zu
dritt oder zu viert. Dann konnten wir schon einander Fragen stellen oder uns
einander anvertrauen."
Jiří Jemelka, der zwar zur gleichen Zeit wie Radovan Dražan nach Dachau kam,
jedoch auf eine andere Stube dieses Blocks gelangte, berichtet, dass sich von
der ersten Minute an ein älterer Landsmann seiner annahm, der mit der Zeit zu
seinem "Schutzpatron" geworden war. Er klärte ihn über die Verhältnisse
im KZ Dachau auf, brachte ihm das "Bettenbauen"
bei und gab ihm so eine erste überlebenswichtige Orientierungshilfe. Nicht jeder
Häftling konnte indessen auf eine ähnliche Unterstützung hoffen und oft blieben
ihm "in dieser Hinsicht [...] Enttäuschungen nicht erspart."
Die Lebensbedingungen im tschechischen Block waren sicherlich keinesfalls
leicht, doch die gemeinsame Muttersprache der meisten Blockbewohner sowie
teilweise alte Bekanntschaften verschafften nach Aussagen vieler Überlebender
eine deutliche Linderung des Grauens, welches das Lager umgab. Der Zeitzeuge
Karel Littloch erinnert sich, dass ihn "das freundschaftliche
Gemeinschaftsgefühl, welches unter den Kameraden vorherrschte", überraschte.
"Das war ein ganz anderes Leben, fast so wie es im Zivilleben vorkommt, aber
in vielerlei Hinsicht noch tiefer und intensiver."
Es fällt auf, dass die Schilderungen zum tschechischen Block einheitlich sehr
positiv ausfallen. Nicht nur in den Interviews, sondern auch in den meisten
Erlebnisberichten im "Almanach Dachau", wird dieser als beispielhaft
hervorgehoben, und die Tschechen nicht selten "als die stärkste Nation unter
allen Nationen im Lager"
eingeschätzt. Im Frühjahr 1943 wurden die meisten tschechischen Häftlinge in den
Block Nr. 20 verlegt. Die Lebensbedingungen blieben nach zahlreichen Aussagen
auch dort bis zur endgültigen Überfüllung des Lagers unverändert, zumal nach
Angaben des ehemaligen Häftlings Emanuel Faltus, der österreichische
Blockälteste, der dieser Baracke vorstand, die Tschechen "leise unterstützte".
Ein Vergleich zu anderen Nationalitäten-blöcken ist bislang aufgrund des
mangelnden Forschungsstandes leider kaum möglich.
Die Ernährungssituation der tschechischen Häftlinge
unterschied sich kaum von der der übrigen Nationalitätengruppen, denn sie war
für jeden einzelnen Häftling vollkommen unzureichend. Alle Häftlinge, die nicht
fähig waren in ihrem Arbeitskommando Nahrung oder stellvertretend Tauschware zu
"organisieren", besaßen kaum Überlebenschancen. Bis auf einige Vertreter der
"Häftlingsaristokratie" litten alle Gefangenen an chronischem Hunger, der sie
nicht selten wie lebendige Leichen aussehen ließ. Alle Befragten wogen kurz nach
ihrer Entlassung aus dem Lager bei durchschnittlicher Größe von 1,75 m zwischen
40 und 45 Kilogramm. Der physische Verfall machte sie zudem für zahlreiche
Krankheiten anfällig, so dass nahezu jeder Häftling einmal an Grippe, Gelbsucht,
Krätze, Ruhr und mancher sogar an Typhus litt.
Nach Herbert Obenaus gehörten der Hunger und "der Kampf
um das tägliche Brot [...] zu den elementaren Bedingungen, die die
Häftlingsgesellschaft in ihren Hoffnungen und Enttäu-schungen, Motivationen und
Bestrebungen strukturierten."
Gepaart mit der erschöpfenden Arbeit verursachte die katastrophale
Ernährungssituation im Winter und Frühjahr 1940/41 den Tod nahezu eines Viertels
aller Lagerinsassen. Da die Häftlinge für den Arbeitseinsatz zunehmend
unbrauchbar waren, reagierte die SS-Führung mit der Einführung der sogenannten
Brotzeit, welche zweimal täglich an die arbeitenden Gefangenen ausgeteilt wurde.
Die kranken sowie die zur Arbeit "Uneingeteilten" hatten darauf jedoch keinen
Anspruch. Doch die wenig nahrhaften Mahlzeiten reichten trotzdem nicht aus.
Zámečník schildert aus eigener Erfahrung, dass die Häftlinge im Lager "an nichts
anderes mehr denken (konnten) als an Essen. In der Nacht wachte der Häftling vor
Hunger auf, und wenn er schlief, träumte er vom Essen."
Erst seit dem Oktober 1942, als die SS-Führung den unbeschränkten Empfang von
Lebensmittelpaketen gestattete, verbesserte sich die Ernährungssituation für
viele Tschechen nachhaltig. Sie wurden von ihren Bekannten, Verwandten und
manchmal auch von fremden Menschen mit genügend Essen versorgt, denn in "den
besetzten Ländern und Gebieten [...] galt Hilfe für die Verfolgten als
patriotische Tat".
Damit erhöhte sich gleichzeitig ihr "soziales Kapital"
und ihre Tauschmacht, so dass sie spätestens jetzt auch Zugang zu besseren
Arbeitskommandos finden konnten.
In der ersten Zeit im Lager gelangten die tschechischen
Häftlinge überwiegend in sehr schlechte Kommandos. Schlechte Arbeitskommandos
bedeuteten im KZ Dachau Arbeiten unter enormen körperlichen und psychischen
Belastungen oft im Freien, wobei die Gefangenen Hitze, Kälte, Regen oder Wind
ununterbrochen ausgesetzt waren. So konnte ein Häftling nicht lange überleben,
denn gerade ein angeschlagener Gesundheitszustand, indem sich viele von ihnen
befanden, benötigte eine wärmere Umgebung und vor allem ein schützendes Dach
über dem Kopf. Doch der Zugang zu einem besseren Kommando war oft mit
notwendigen Kontakten verbunden, die ein Häftling im Lager erst einmal aufbauen
musste. So arbeitete etwa František Kadlec zunächst im brutalen Kommando
"Plantage", wo er die Zwiebeln von Gladiolen aus der halbgefrorenen Erde
herausziehen musste. Viele Häftlinge bekamen davon ernste Erfrierungen an den
Händen, die sie während des Winters kaum auskurieren konnten. Da Kadlec dort
gleich in der ersten Arbeitsstunde Zeuge mehrerer brutaler Morde wurde, kehrte
er nicht mehr dorthin zurück und begab sich erneut zur Gruppe der
"Uneingeteilten". Dies war indessen auch sehr gefährlich, denn die
"Uneingeteilten", unter denen sich viele Neulinge befanden, wurden von der SS
besonders brutal behandelt. Sie erhielten keine Brotzeit und standen "meistens
[...] in Habachtstellung auf dem Appellplatz, marschierten und exerzierten unter
dem Kommando eines der Blockführer. Dazu gehörte der ,Laufschritt’ in
Holzpantinen, das ,Hinlegen’ und das ,Rollen’ sowie andere anstrengende Übungen,
die bis zur völligen Entkräftung andauerten."
Viele von ihnen wurden allerdings auch für einen Transport ausgesucht, welcher
meistens eine zusätzliche Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen mit sich
brachte. František Kadlec gelang es aufgrund seiner früheren politischen
Tätigkeit verhältnismäßig schnell, in ein gutes Arbeitskommando eingeteilt zu
werden. Bereits zwei Monate nach seiner Ankunft in Dachau arbeitete er unter
einem Dach, im Warmen und zudem noch relativ selbständig im Kommando der
SS-Wirtschaftsbetriebe, einem Produktionsunternehmen der SS, wo er seine
architektonischen Fähigkeiten geltend machen konnte. Dort entwarf er unter
anderem Kolonialmöbel, ganze Kleinstädte und am Ende des Krieges sogar
zugähnliche "mobile Konzentrationslager", welche je nach Bedarf zerbombte
Gleisstrecken wiederherstellen sollten. Radovan Dražan und Jiří Jemelka hatten
dagegen weniger Glück und durchliefen sogar mehrere Jahre lang schwere und
unstete Arbeitskommandos, wie etwa "Moorexpress", "Kiesgrube", "Garagenbau",
"Plantage", "Kartoffelkeller" und viele andere.
Jiří Jemelka verlor in einem von ihnen eine Niere. Schließlich fand auch er ein
stetes Kommando in der "Fertigungswerkstätte", wo er Spitzen für Granaten
herstellte. Radovan Dražan wurde später in der "SS-Besoldungsstelle" angestellt,
wo er bis zum Bombenangriff im Mail 1944 zusammen mit einem tschechischen
Radioingenieur Schreib- und Rechenmaschinen reparierte. Insgesamt kann man bei
den tschechischen Häftlingen in den letzten Jahren ihrer Haftzeit
H hinsichtlich der Arbeits-kommandos eine
Wende beobachten. Nach dem Blockbuch aus dem Block Nr. 20 arbeitete die
überwiegende Mehrheit der Tschechen zwar auf der "Plantage", doch waren diese
Häftlinge dort nicht mehr draußen, sondern in den Laboratorien und Treibhäusern
angestellt, was nach Aussagen vieler eine relativ bequeme Arbeit gewesen sein
soll. Die übrigen Tschechen verteilten sich gleichmäßig auf andere "bessere"
Kommandos, wie etwa "Präzifix", "Heereszeugamt", "Gurtweberei",
"Waffenwerkstätte" oder "Kabelzerlegung".
Die Verteilung auf die Arbeitskommandos lag zusammen mit
vielen anderen Aufgaben in den Händen der Häftlingsselbstverwaltung. Diese
bildete nach Sofsky eine "intermediäre Instanz zwischen SS-Personal und
Häftlingsgesellschaft"
und unterwarf die meisten Häftlinge einer doppelten Unterdrückung. Nach
Kupfer-Koberwitz war der Häftling "einmal als Gefangener des
Nationalsozialismus und der ihn verkörpernden SS (eingesperrt), und
einmal als Gefangener der Mitgefangenen, ihnen ebenso ausgeliefert wie der
Gestapo, vielleicht noch schlimmer, denn sie umgaben einen stündlich."
Damit wandte auch hier die SS die Strategie an, verschiedene
Häftlingsgruppen gegeneinander auszuspielen. Da alle Häftlings-funktionen
eine materielle Privilegierung sowie einen enormen Machtzuwachs mit sich
brachten, gelang dieser Plan nicht selten. Denn die SS verlangte für die
Besserstellung eine Komplizenschaft des Funktionshäftlings und damit seine
Beteiligung an Verbrechen gegen-über anderen Gefangenen. Dieses System war enorm
effektiv, denn ohne "ihre schmutzige Arbeit hätte die SS nicht derart
katastrophale Verhältnisse herstellen können",
wie sie im Lager bis zum Jahr 1942 herrschten. Die meisten Funktionshäftlinge in
Dachau waren "politische" Deutsche. Da sie jedoch mit der Internationalisierung
der Lager nur noch eine Minderheit darstellten, musste die SS vermehrt auf
ausländische Gefangene zurückgreifen. Doch auch dabei wurde eine strikte
Hierarchie beachtet, denn nur eine höhergestellte Gruppe durfte einer
niedrigergestellten übergeordnet werden. So konnte etwa nur "ein Franzose der
Kapo über Polen, [...] ein Pole der Kapo über Russen"
werden und keinesfalls umgekehrt. Der Verteilung der Arbeitskommandos nach zu
urteilen, besaßen die Tschechen vor allem in den letzten Jahren in der
Häftlingsgemeinschaft einen relativ großen Einfluss. Doch sie hatten nur
verhältnismäßig kleinere Funktionsposten inne. Nach einer unvollständigen Liste
vom April 1945 waren unter ihnen zwei Blockälteste, ein Blockschreiber und acht
Stubenälteste.
Die Tschechen besaßen aber auch wichtige Funktionen auf dem "Revier" und waren
dort als Pfleger, und einige wenige seit dem Jahr 1942 auch als Ärzte tätig.
Aufgrund ihres Bildungsstandes und ihrer Deutschkenntnisse, die sie an sich
schon in eine privilegiertere Stellung hoben, wurden sie von der SS zudem oft
als Dolmetscher oder Schreibkräfte eingesetzt. Dies beeinflusste ihre
Lebensbedingungen zusätzlich, da sie mit der "Funktionsmacht"
in eine höhere Stellung in der Häftlingshierarchie aufsteigen konnten.
Einen großen Einfluss auf die Lebensbedingungen der
KZ-Häftlinge übte zudem das System der Lagerstrafen aus. Die Bestrafung in
Dachau war grausam und brutal und erfolgte meist wegen kleinster Kleinigkeiten,
wie etwa schlecht geputzter Schuhe, einem abgerissenen Knopf oder einem schlecht
gebauten Bett. Edgar Kupfer-Koberwitz schreibt, dass es in Dachau die "drei
bösen B’, die Abkürzung für Bock – Baum – Bunker"
gab, die das Leben eines jeden Häftlings prägten. Damit sind die drei
wichtigsten Maßnahmen der "Disziplinar- und Strafordnung" des KZ Dachau gemeint,
nämlich das "Baum- oder Pfahlhängen", die Prügelstrafe und der Arrest im
sogenannten Bunker, dem Lagergefängnis. Nach Zámečník galten als "milde Strafen
[...] Strafexerzieren, Kostentzug und Torstehen".
Auch einige Tschechen durchliefen diese "Bürokratie der Grausamkeit",
wobei in deren Erinnerungs-berichten Belege für alle möglichen Strafen zu finden
sind. Jiří Jemelka erfuhr seinen eigenen Angaben zufolge die brutale Strafe des
"Baumhängens", und das sogar an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Dabei wurden
ihm die Hände hinter dem Rücken mit einer Kette gefesselt und sein Körper
daraufhin an ihr in die Höhe gezogen, bis seine Füße den Boden nicht mehr
berühren konnten. Bei dieser mittelalterlichen Folter durchlitt er
unvorstellbare Schmerzen und Qualen, die er im Gespräch allerdings hinter ein
Lächeln zu verbergen suchte. Radovan Dražan erlebte wiederum die Strafe des
verschärften Dunkel-arrests im sogenannten Stehbunker, in dem er acht Tage und
Nächte verbringen musste. Dies geschah, nachdem der SS ein illegaler Brief in
die Hände fiel, den Dražan aus dem Lager an seine Familie schicken wollte.
"Der Stehbunker befand sich auf der linken Seite des Flurs [...]. (Es)
war so eine Holzkiste, etwa 70 x 70 cm breit und knapp 2 Meter hoch. [...] In
der Kiste war kein Fenster, so dass es dort immer dunkel war. Die Holzbretter
waren sehr nah nebeneinander gestellt, was die Sauerstoffströmung verhinderte."
Diese Strafe war besonders grausam, da der Häftling jegliches Zeit- und
Orientierungsgefühl verlor und in der Zelle weder sitzen noch liegen konnte.
Zudem quälten die Betroffenen, neben schrecklichem Hunger, Tausende von Läusen,
die in dem warmen Holz optimale Bedingungen hatten. R. Dražan schildert, dass er
dort "fast verrückt" wurde, und die Traumatisierung aus dieser Zeit ist
ihm bis heute deutlich anzumerken. Die Bestrafung im KZ Dachau konnte jeden
Häftling treffen, ausgenommen einiger Angehörigen der "Aristokratie", die von
der SS weitgehend geschützt wurden. Daran kann man sehen, dass es neben der
kollektiven Ebene, die große Teile einer Häftlingsgruppe betraf, auch eine
individuelle Überlebensebene gab, welcher der einzelne Häftling allein
ausgeliefert war. Kein einflussreicher Tscheche hätte es etwa vermocht, Radovan
Dražan vor seiner Strafe zu bewahren. Die tschechischen Häftlinge bemühten sich
zwar in vielen Fällen ihre Landsleute zu schützen, doch wenn es einen von ihnen
treffen sollte, gab es kaum Rettung. Daher waren die wichtigsten
Überlebensregeln im Lager möglichst "nicht ,aufzufallen’ [...], "immer ,auf
Draht zu sein’ [...] und von den SS-Männern den größtmöglichen Abstand zu
halten".
Die Lebensbedingungen der arbeitenden Häftlinge
veränderten sich mit dem Antritt von Martin Weiß als Kommandant des KZ Dachau im
September 1942 erneut drastisch. Dies lag selbstverständlich nicht an seinem
Einfühlungsvermögen, sondern daran, dass die Häftlinge von nun an für die
Kriegswirtschaft maximal ausgebeutet werden sollten, und dies bei ihrem
verelendeten Zustand nicht möglich war.
Zahlreiche Torturen, welche das Leben eines jeden Häftlings tagtäglich prägten,
wurden nun abgeschafft, darunter die Strafe des "Pfahlhängens", der
Mittagsappell, das Austragen der schweren Essenskübel, das penible Aufräumen der
Spinde und Säubern der Fußböden sowie das schikanöse Bettenbauen. Die an den
Kräften der Häftlinge zehrenden Morgen- und Abendappelle wurden zudem verkürzt,
den Häftlingen wurde ab Oktober der unbegrenzte Empfang von Lebensmittelpaketen
gestattet, auf dem Appellplatz wurde ab 1943 ein Fußballfeld eingerichtet, auf
dem an Sonntagen Spiele stattfanden, im Bad wurden Filme vorgeführt, und die SS
gestattete sogar eine Freilichtbühne für Musik- und Theatervorstellungen. Diese
positiven Veränderungen betrafen natürlich auch die tschechischen Häftlinge,
denn die "elfstündige Arbeitszeit war leichter zu ertragen als der brutale
Terror (und) die sinnlosen Schikanen."
Zu dieser Zeit erlebte etwa die nationalgeprägte Kunst und Kultur im Lager ihre
volle Blüte. Zámečník betont jedoch zurecht, dass in Dachau "damals ein
widersprüchliches System"
herrschte, denn es waren lediglich die arbeitenden Häftlinge, die von den
Verbesserungen profitieren konnten. Zur gleichen Zeit tötete nämlich die SS
arbeitsunfähige Gefangene im "Bunker". Neben dem Lager entstand das neue
leistungsfähigere Krematorium mit einer Gaskammer, und im "Revier" begann die
Hochphase der medizinischen Experimente an lebenden Häftlingen. Neben
zahlreichen anderen Häftlingen wurden auch sechzehn Tschechen Opfer der
Malaria-versuche des Dr. Claus Schilling.
Die meisten von ihnen überlebten und blieben im Lager bis zur Befreiung. Drei
Tschechen starben nach Angaben der Häftlingsdatenbank allerdings, wobei nur bei
einem von ihnen die Bemerkung "an den Folgen des Versuchs" beigefügt ist.
Die Meerwasserversuche wurden oben bereits erwähnt. Da sich heute leider nur bei
diesen beiden Versuchsreihen die Nationalität der Opfer feststellen lässt,
bleiben die übrigen im Verborgenen.
Die verbesserten Lebensbedingungen der arbeitenden
Häftlinge hielten jedoch nicht lange an, denn schon in der zweiten Hälfte des
Jahres 1944 war das Lager aufgrund der unaufhörlich hineinströmenden
Häftlingstransporte katastrophal überfüllt. "In den für 50 Menschen geplanten
und eingerichteten Stuben drängten sich 300 und manchmal auch 500 Häftlinge."
Die Essensrationen wurden immer kleiner, der Hunger nahm stetig zu, und die
hygienischen Verhältnisse waren in desolatem Zustand, so dass sich viele
tödliche Krankheiten und Epidemien mühelos entfalten konnten. Das "Revier" wurde
in dieser Zeit sogar auf 13 Baracken erweitert, doch bei Abertausenden von
kranken Häftlingen reichte es nicht mehr aus. "Für die Gefangenen wurden die
letzten Wochen zum Wettlauf gegen die Zeit, den schließlich Tausende verloren."
Von den etwa 30.000 Toten des KZ Dachau starben rund 15.000 in den letzten fünf
Monaten, überwiegend an der grassierenden Flecktyphus-Epidemie.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die
Lebensbedingungen als auch die Behandlung der Tschechen im KZ Dachau eine
Wandlung durchliefen. Der anfänglichen Brutalität, die diese Häftlingsgruppe auf
der kollektiven Ebene zu erleiden hatte, folgte etwa, seit der zweiten Hälfte
des Jahres 1942, im Zuge der Anpassung an die Dachauer Verhältnisse eine
weitgehende Normalisierung ihrer Situation sowie ein zunehmender Einflussgewinn.
Die Übergriffe gegen die tschechischen Häftlinge durch die SS tauchen für diese
Zeit in der Erinnerungsliteratur nur noch individuell auf. Das lag einerseits an
der längeren Haftdauer, die ihnen, da die Tschechen nach den Österreichern als
dritte Nationalität nach Dachau kamen, im Lager ein höheres Prestige
verschaffte. Andererseits waren die meisten von ihnen als Regimegegner oder als
Widerstandskämpfer ins KZ verschleppt worden und konnten mit diesem
"vorkonzentrationären" Hintergrund leichter Kontakte zu bereits etabliertem
Häftlingspersonal knüpfen. Ablesen lässt sich die relativ günstige Stellung vor
allem an den "guten" Arbeitskommandos spätestens seit dem Jahr 1944,
aber auch an der Vertretung zahlreicher Mitglieder dieser Häftlingsgruppe an
wichtigen und einflussreichen Posten, etwa auf der "Plantage", im "Revier", in
der Lagerschreibstube oder im "Arbeitseinsatz".
Der deutsche Überlebende Joseph Joos würdigt die tschechischen Häftlinge, indem
er in seinem Erlebnisbericht bemerkt, dass sie "bewundernswert zusammen(hielten)".
"Planmäßig entfalteten sie ihren Einfluß, und die Kenntnis der Sprache
ermöglichte ihnen Positionen, die wieder für die Unterbringung von Landsleuten
ausgenutzt wurden."
-
Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 138.
-
Ebenda, S. 137.
-
Wie etwa der Kampf zwischen den "politischen” und den "kriminellen”
Häftlingen in nahezu jedem KZ. Näheres dazu: Pingel, Häftlinge, S. 102 –
117; Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 137 – 193.
-
Pingel, Häftlinge, S. 158.
-
Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 140.
-
Polen und Russen unterlagen als Slawen der rassischen, Italiener und
Franzosen dagegen der politischen Verfolgung.
-
Der Begriff Aristokratie meint die besser gestellten Häftlinge mit hoher
"Funktionsmacht". In der Regel waren dies deutsche politische oder
"kriminelle" Häftlinge. Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 169 – 177.
-
Ebenda, S. 151.
-
Kašák, Die Tschechen im Konzentrationslager Dachau, S. 15. Die Strafkompanie
wurde bereits im Kapitel 2.3.3 im Zusammenhang mit den jüdischen Häftlingen
erwähnt.
-
Zámečník, Dachau, S. 121.
-
Ebenda, S. 121.
-
Damit sind ausschließlich die tschechischen Geiseln gemeint, die bei der
"Aktion Albrecht I." verhaftet worden waren.
-
Dienstanweisung Heinrich Himmlers vom 18. September 1939 "für die Verwahrung
von Angehörigen des Protektorates im Konzentrationslager Dachau." Abgedruckt
bei: Milotová/Kárny: Anatomie okupační politiky, Dok. Nr. 37, S. 101 – 103.
-
Kašák, Die Tschechen im Konzentrationslager Dachau, S. 17.
-
Brief Himmlers an Freiherr von Neurath vom 26. September 1939. Abgedruckt
bei Milotová/Kárny: Anatomie okupační politiky, Dok. Nr. 36, S. 99 – 100.
-
Ebenda, S. 100.
-
Zámečník, Dachau, S. 113, Anm. 23.
-
Kupfer-Koberwitz, Die Mächtigen, Bd. 1, S. 183.
-
Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 142.
-
Zatloukal, František: Cesta Životem 1918 – 1990.
[Der Weg durch das Leben 1918 - 1990], unveröffentlichtes
Manuskript, o. O. 1990, S. 112, DaA 27.403.
-
Josef Straka, in: V zajetí smrti. [In der Gefangenschaft des Todes], Most
[Brux] 1995, S. 94.
-
Vgl. auch: Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 139.
-
Zámečník, Dachau, S. 139.
-
Ebenda, S. 120, Anm. 54; vgl. auch Bettelheim, Bruno: Erziehung zum
Überleben. Zur Psychologie der Extremsituation, München 1982, S. 79 – 80.
-
Neben den Tschechen lebten in diesem Block noch Polen, später auch
Jugoslawen. Nach der Übersiedlung in den Block 20 im Frühjahr 1943 kamen
noch Italiener und ab 1944 auch Griechen, Franzosen und Spanier hinzu.
Littloch, Karel: Mé nejsilnější dojmy z Dachau. [Meine stärksten Eindrücke
aus Dachau], in: Almanach Dachau.
Kytice událostí a vzpomínek.
[Almanach Dachau. Ein Strauß von Ereignissen und
Erinnerungen], S. 100; vgl. auch Blockbuch aus dem Block Nr. 20, DaA 35.060.
-
Die Lebensbedingungen im "Zugangsblock" waren nach Aussagen vieler
Überlebender sehr hart, denn hier mussten sich die Häftlinge an das Leben im
Lager anpassen. Sie durchliefen die harte Dachauer Schule, lernten die
Befehle und auch die Lagersprache. Der Zeitzeuge Václav Veselý erinnert
sich, dass dort sehr viel geklaut und gestritten wurde.
"Der Aufenthalt im Zugangsblock war ohnehin eines meiner schlimmsten
Erinnerungen. Ich verlor dort schnell an Gewicht und erkrankte an Grippe,
doch vor allem war ich durch die ganze Umgebung des Lagerspsychisch deprimiert [...]." Veselý,
Václav: Nekolik osobních zážitků z Dachau. [Einige persönlichen Erinnerungen
aus Dachau], in: Almanach Dachau.
Kytice událostí a vzpomínek.
[Almanach Dachau. Ein Strauß von Ereignissen und
Erinnerungen], S. 181.
-
Interview mit R. Dražan am 11. September 2002.
-
Das "Bettenbauen" war vor allem für die Neulinge eine der schlimmsten
Schikanen im KZ Dachau. Die Betten mussten jeden Morgen wie frisch gebügelt
wirken, wobei "die Ansprüche an das gefällige Aussehen der gemachten Betten
bis zur Absurdität gesteigert wurden." Zámečník, Dachau, S. 140.
-
Ebenda, S. 138.
-
-
Laštůvka, Josef: Nekolik vzpomínek. [Einige Erinnerungen], in: Almanach
Dachau. Kytice událostí a
vzpomínek.
[Almanach Dachau. Ein Strauß von Ereignissen und
Erinnerungen], S. 80.
-
Faltus, Emanuel: Jak vznikala a vyvíjela se kulturní činnost v Dachau. [Wie
in Dachau die kulturelle Tätigkeit entstand und wie sie sich entwickelte],
in: Almanach Dachau.
Kytice událostí a vzpomínek.
[Almanach Dachau. Ein Strauß von Ereignissen und Erinnerungen], S. 61.
-
Obenaus, Herbert: Der Kampf um das tägliche Brot, in: Herbert, Ulrich/Orth,
Karin/Dieckmann, Christoph (Hrsg.): Die Nationalsozialistischen
Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, Bd. 2, Göttingen 1998, S.
841.
-
Zámečník, Dachau, S. 124 – 125. Von etwa 10.000 Häftlingen starben 1940/41
in nur wenigen Monaten insgesamt 2.347.
-
Näheres zur Ernährungssituation im KZ Dachau siehe ebenda, S. 143 – 145.
-
Ebenda, S. 257.
-
"Funktionsmacht, privilegierte Arbeiten und Besitz brachten soziales Kapital
ein", welches wiederum "das Hauptinstru- ment gegen die Dissoziationen des
Klassensystems war." Näheres dazu bei Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S.
147 – 151.
-
Zámečník, Dachau, S. 142.
-
Näheres zu diesen Arbeitskommandos siehe ebenda, S. 119 – 125.
-
DaA 35.060.
-
Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 153.
-
Kupfer-Koberwitz, Die Mächtigen, Bd. 1, S. 104.
-
Darunter Posten der Lager-, Block- und Stubenältesten sowie der Kapos oder
Posten in der Lagerschreibstube sowie im Arbeitseinsatz. Zu den Funktionären
zählen jedoch auch Häftlinge, die "in den Küchen, Wäschereien, Magazinen
oder Werkstätten" arbeiteten. Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 156.
-
Zámečník, Dachau, S. 155.
-
Sonthofener Rede Heinrich Himmlers v. 21.6.1944, zitiert nach: Pingel,
Häftlinge, S. 165.
-
DaA 32.920. Die zwei Blockältesten standen den Blöcken 18 und 26 vor. Leider
lässt es sich anhand des Dokuments aus dem Jahr 1945 nicht nachvollziehen,
wie lange sie diese Funktionen bereits versahen. Nach Zámečník wurden die
ausländischen Häftlinge erst in der Endphase des Krieges in die Funktionen
eines Kapo und Stubenältesten eingesetzt. Zámečník, Dachau, S. 325.
-
Sofsky, Die Ordnung des Terrors, S. 139 - 140 und 149.
-
Kupfer-Koberwitz, Die Mächtigen, Bd. 1, S. 139. Näheres zu den Strafen siehe
bei Zámečník, Dachau, S. 125 – 135.
-
Ebenda, S. 125.
-
Ebenda, S. 125.
-
Interview mit Radovan Dražan am 11.9.2002. Siehe auch dessen schriftliche
Aussage, DaA 32.999.
-
Zámečník, Dachau, S. 151.
-
Näheres dazu siehe ebenda, S. 250 – 262.
-
Ebenda, S. 256.
-
Ebenda, S. 261.
-
Alle Angaben stammen aus der Häftlingsdatenbank.
-
Bei den Geistlichen ist noch der Fall des Jaroslav Zámečník bekannt, der
Opfer von Phlegmonenversuchen wurde und diese nicht überlebte. Näheres zu
den medizinischen Versuchen in Dachau siehe Zámečník, Dachau, S. 262 – 295.
-
Ebenda, S. 365.
-
Distel/Benz, Das Konzentrationslager Dachau, S. 24.
-
Dies geht aus dem Blockbuch Nr. 20 hervor. Für die Zeit davor gibt es leider
keine "offiziellen" Belege.
-
Der "Arbeitseinsatz" war praktisch das Arbeitsamt des Konzentrationslagers.
"Hier wurde darüber entschieden, ob der
Häftling in ein verhältnismäßig gutes oder mörderisches
Arbeitskommando eingeteilt wurde." Zámečník, Dachau, S. 119.
-
Joos, a. a. O., S. 78 – 79.
5. ANHANG
5.1.1 Quellenverzeichnis
5.1.2 Literaturverzeichnis
5.2.0 Abkürzungen
Zur Diskussion im Forum:
[Nationalsozialistische
Konzentrationslager]
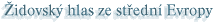
hagalil.com 08-2004 |