[Tschechische
Häftlinge
im Konzentrationslager Dachau]
Von
Zuzana MosnákováZur
Diskussion im Forum:
[Nationalsozialistische
Konzentrationslager]
2. Verhältnisse:
Einlieferung nach Dachau und Lebensbedingungen im Lager
Die deutsche Besatzung der sogenannten Rest-Tschechei
erfolgte am 15. März 1939. Die Voraussetzung dafür bildete indirekt das Münchner
Abkommen, welches am 30. September 1938 von Hitler, Mussolini, Chamberlain und
Daladier unterzeichnet wurde. Aufgrund dieses Abkommens, an dem der damalige
tschechoslowakische Präsident Edvard Beneš nicht beteiligt war, musste die
Tschechoslowakei das gesamte Sudetendeutsche Gebiet mit allen Grenzbefestigungen
an das Deutsche Reich abtreten, wodurch sie ihre Verteidigungsfähigkeit
gegenüber ihrem potenziellen Angreifer endgültig verlor.
Unter diesen Umständen verlief die Besatzung im März
völlig reibungslos und erfolgte quasi über Nacht. Sie kam sowohl für die
tschechische als auch für die deutsche Bevölkerung des neu besetzten Landes
gänzlich überraschend. Die Tschechen reagierten auf sie mit einer unheimlichen
Niedergeschlagenheit, "Tränen [...] und ohnmächtiger Zorn beherrschten die
Gemüter."
Noch heute wird die Besatzung im tschechischen Geschichtsbewusstsein als eine
nationale Tragödie empfunden. Nur einen Tag später, am 16. März, verkündete
Hitler das "Reichsprotektorat Böhmen und Mähren", welches sich vorläufig autonom
verwalten konnte, jedoch "im Einklang mit den politischen, militärischen und
wirtschaftlichen Belangen des Reiches"
agieren musste. Damit wurde das Protektorat praktisch "gleichgeschaltet".
Am 18. März ernannte Hitler den als gemäßigt geltenden,
früheren deutschen Außenminister Konstantin Freiherr von Neurath zum
Reichsprotektor. Er fungierte "als Vertreter des Führers und Reichskanzlers
sowie als Beauftragter der Reichsregierung"
und wurde mit umfangreichen legislativen und exekutiven Kompetenzen
ausgestattet. Diese Machtfülle auf der Seite der Besatzer ließ schnell vermuten,
dass mit der Zeit die Autonomie des Protektorats zur reinen Formsache werden,
und die neu eingesetzte Regierung unter dem Präsidenten Emil Hácha lediglich
eine reine Marionettenfunktion behalten sollte. Der damalige tschechische
Politiker und Agrarminister Ladislav Feierabend deutete die Veränderungen sehr
treffend, indem er später schrieb, dass die neue Situation "kaum einen
Zweifel darüber offen (ließ), daß wir zu Menschen zweiter Klasse
degradiert würden und daß die Deutschen mit uns nach Belieben verfahren
könnten."
An die Seite des Reichsprotektors wurde als Staatssekretär der als radikal
bekannte, frühere stellvertretende Führer der Sudetendeutschen Partei, Karl
Hermann Frank gestellt. Zwischen beiden entwickelte sich während ihres
zweieinhalbjährigen Zusammenwirkens ein regelrechter Dualismus, bei dem es Frank
mit der Zeit gelang, immer mehr entscheidende Kompetenzen an sich zu reißen. Im
September 1941 wurde Freiherr von Neurath durch den stellvertretenden
Reichsprotektor und gleichzeitig Chef der Sicherheits-polizei und des SD,
Reinhard Heydrich, abgelöst. Nach dem Attentat, welches auf Heydrich am 27. Mai
1942 verübt wurde, und an dessen Folgen er wenige Tage später starb, wurde der
Leiter der Ordnungspolizei Kurt Daluege dessen Nachfolger. Nur ein Jahr darauf
setzte sich Frank mit seiner radikalen Auffassung endgültig durch, indem er
selbst von Hitler zum Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren ernannt und
der scheidende Innenminister Wilhelm Frick zum mittlerweile völlig in seiner
Machtkompetenz beschnittenen Reichs-protektor berufen wurde.
Im Laufe seines sechsjährigen Bestehens kam es im
Protektorat Böhmen und Mähren zu mehreren grausamen Terrorwellen, bei denen
tausende Menschen von der Gestapo hingerichtet sowie Zehntausende verhaftet und
in die Konzentrationslager verschleppt wurden. Trotzdem muss man konstatieren,
dass die deutsche Politik gegenüber dem Protektorat im Vergleich zu anderen
slawischen Ländern, wie etwa Polen oder der Sowjetunion, relativ gemäßigt war
und eine bestimmte Grenze nicht überschritt.
Der Generalgouverneur Hans Frank beschrieb die
Unterschiede in einem Interview für den "Völkischen Beobachter":
"In Prag waren z. B. große rote Plakate angeschlagen, auf denen zu lesen war,
daß heute 7 Tschechen erschossen worden sind. Da fragte ich mich: Wenn ich für
je sieben erschossene Polen ein Plakat aushängen lassen wolle, dann würden die
Wälder Polens nicht ausreichen, das Papier herzustellen für solche Plakate."
Für eine derart ungleiche Behandlung gab es verschiedene Gründe, die alle
gemeinsam einen sehr pragma-tischen Charakter aufweisen. Vor dem Kriegsausbruch
war das gemäßigte Verhalten der deutschen Besatzer von außenpolitischen
Rücksichten geprägt. Die Okkupation Böhmens und Mährens rief in der
Weltöffentlichkeit bereits massive Proteste hervor, die durch zusätzlichen
Terror nicht weiter herausgefordert werden sollten. Als der Krieg im September
1939 ausbrach, versprachen sich die Besatzer von einer ruhigeren Lage im
Protektorat wiederum einen höheren Beitrag für die deutsche Kriegsproduktion.
Das Protektorat stellte mit seinen Rüstungswerken sowie den 7,5 Millionen
unverzichtbaren Arbeitern ein großes kriegs-wirtschaftliches Potential dar und
wurde daher rücksichtslos ausgebeutet. Die übrigen Ursachen hängen mit der
"Germanisierungspolitik" der Nationalsozialisten zusammen. Die Tschechen galten
nämlich weitgehend als "assimilierungswürdig", so dass eine rassische Verfolgung
der gesamten Bevölkerung zumindest während des Krieges nicht angestrebt wurde.
Lediglich die "rassisch unverdaulichen Tschechen" sollten ausgesiedelt,
bzw. zusammen mit der "reichsfeindlichen Intelligenzschicht" einer
"Sonderbehandlung" unterzogen werden.
Aus diesen Gründen bemühten sich die Besatzer im Protektorat zunächst um
"Ruhe im Raum"
Politik, wobei sie unnötige Terrorakte gegen die tschechische Bevölkerung
weitgehend zu vermeiden suchten. Ein Jahr später wurde diese politische Linie
von dem stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich weitgehend
übernommen,
wobei dieser mit seiner radikalen Politik die Grundzüge für die "Endlösung der
tschechischen Frage" im Protektorat festsetzte.
Auf der anderen Seite sollte jedoch jeglicher Widerstand
im Protektorat bereits im Keim erstickt werden, so dass schon kurz nach dem
Einmarsch der deutschen Truppen eine rigorose Verfolgung von tschechischen
Widerständlern und Regimegegnern entfesselt wurde. Der tschechische Widerstand
wird nach der Meinung des einheimischen Historikers Václav Kural "im Ausland,
auch in der deutschen Literatur, oft unterschätzt."
Die Auflehnung zeichnete sich nämlich nicht gerade durch viele offenkundige und
aktive Widerstandsakte aus, sondern vielmehr durch einen ausgedehnten passiven
Widerstand breiter Bevölkerungsschichten, auf den sich dann die umfassende
Illegalität anlehnen konnte. Abgesehen davon dauerte er im Vergleich zu allen
anderen besetzten Ländern, wenn man hierbei Österreich ausklammert, am längsten,
nämlich von März 1939 bis zum Ende des Prager Aufstands am 10. Mai 1945. Die
Tschechen konnten sich mit der deutschen Besatzung vom ersten Tag an nicht
abfinden. Wie Brandes feststellt, übernahm die Bevölkerung zunächst
"Widerstandformen aus der Zeit des nationalen Erwachens im 19. Jahrhundert",
um damit ihre Ablehnung auszudrücken. Die kulturellen Wurzeln des tschechischen
Volkes als Spiegelbild des eigenen nationalen Bewusstseins wurden vor allem im
ersten Jahr der Okkupation demonstrativ gepflegt und verteidigt. Theater- und
Musikveranstaltungen erhielten nun den "Charakter nationaler Kundgebungen. [...]
Gedenktage, Geburts- und Todestage großer Tschechen wurden von den tschechischen
Zeitungen zu Rückblicken benutzt, die geeignet waren, das tschechische
Nationalbewußtsein wachzuhalten."
Bezeichnend für diese passive Widerstandsform waren aber auch der Kleinkrieg
zwischen Tschechen und "Volksdeutschen", die verbreitete Solidarität mit den
Juden sowie zahlreiche antideutsche Flugblätter und Flüsterpropaganda.
Als geeignetstes Mittel der Auflehnung betrachteten die Tschechen im ersten Jahr
der Besatzung allerdings die Demonstrationen, welche die Aufmerksamkeit des
Auslandes auf sich ziehen und gleichzeitig die "Ruhe im Raum" Politik
nachhaltig stören sollten. Da jedoch im November 1939 eine große nationale
Studentenkundgebung von der Gestapo und dem SD blutig niedergeschlagen worden
war, wurde diese offene Form des Protestes bald eingestellt. Doch im Protektorat
entwickelte sich sehr schnell auch ein breiter organisierter Widerstand, welcher
sowohl national als auch kommunistisch geführt wurde. Seine Schwerpunkte lagen
im Nachrichtendienst, in der Sabotage, in der antideutschen Propaganda sowie in
der Fluchtvorbereitung und Fluchthilfe ins Ausland, wo viele Tschechen in den
Einheiten der tschechoslowakischen Armee, die im Exil aufgestellt worden waren,
gegen deutsche Truppen kämpfen sollten.
Der Nachrichtendienst war wiederum einerseits für den Nachrichten-austausch mit
der Exilregierung in London bestimmt, welche von Edvard Beneš geführt wurde, der
nach der Konferenz von München zurückgetreten war. Andererseits hielten die
illegalen Widerstandsorganisationen dadurch Kontakt mit der Führung der
kommunistischen Partei, die unter Klement Gottwald im Moskauer Exil weiter
existierte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die überwiegende
Mehrheit der Tschechen, die in die Konzentrationslager deportiert wurden, in
erster Linie aus politischen und nicht aus rassischen oder anderen Gründen
verfolgt und verhaftet worden war. Sehr hart trafen die Terror-maßnahmen vor
allem die tschechische Intelligenz, da die deutschen Besatzer befürchteten, dass
durch ihre Verbindung mit den Arbeitern die Widerstandsbewegung im Protektorat
eine feste Plattform bekäme.
Am Tag der Besetzung des Landes kamen mit den
deutschen Truppen auch die Gestapo und der SD in das neu errichtete Protektorat
und nahmen sogleich ihre Arbeit mit ernsthaftem Eifer auf. Als entscheidende
Helfer standen ihnen dabei die sudetendeutschen Nationalsozialisten zur Seite,
die in der Sudetendeutschen Partei um Konrad Hennlein versammelt waren.
Unter dem Tarnnamen "Aktion Gitter" kam es zur ersten
Terrorwelle, die mehrere tausend Persönlichkeiten des tschechischen öffentlichen
Lebens, darunter besonders kommu-nistische und sozialdemokratische Politiker,
Juden sowie deutsche Emigranten betraf.
Wegen der bereits beschriebenen außenpolitischen Rücksichten blieb diese
Verhaftungswelle zunächst einmalig und zog auch im Gegensatz zu ähnlichen
Maßnahmen in Österreich keine Massendeportationen in Konzentrationslager nach
sich. Ende April 1939 wurde Karl Hermann Frank von Heinrich Himmler zum Höheren
SS- und Polizeiführer berufen. Dies war der erste Triumph der Radikalen in der
deutschen Besatzungspolitik, da Frank nun auf dem Gebiet der polizeilichen
Verfolgung von Neurath völlig unabhängig gemacht wurde.
Am 8. Juni 1939 wurde in Kladno, einer Stadt westlich von
Prag, der deutsche Polizist Wilhelm Kniest erschossen. Der Vorfall bot den
deutschen Besatzern die Möglichkeit zu demonstrieren, dass sie keine Übergriffe
gegen ihre Männer dulden würden, und dass sie bereit waren, die ganze
Bevölkerung kollektiv in Verantwortung zu ziehen. Da die Attentäter nicht
ausfindig gemacht werden konnten, nahm die Gestapo in den darauf folgenden Tagen
109 Vertreter der Kladnoer Intelligenz- und Führungsschicht als Geiseln fest und
deportierte sie über das Brünner Gestapogefängnis Spielberg in das
Konzentrationslager Mauthausen, wo diese Gruppe drei Tage lang festgehalten
wurde.
Unter ihnen befand sich auch der Journalist Karel Kašák, der spätere Verfasser
eines illegalen Tagebuchs.
Am 16. Juni wurden die Kladnoer Geiseln nach Dachau eingeliefert. Sie waren die
ersten tschechischen Häftlinge, die in einer größeren Anzahl nach Dachau
gekommen sind.
Die zweite große Verhaftungswelle fand am 1. September
1939, dem Tag des Kriegsaus-bruchs statt, als die Gestapo unter dem Tarnnamen
"Aktion Albrecht I." etwa 2.000 tschechische prominente Persönlichkeiten als
Geiseln festnahm. Es handelte sich dabei um die tschechischen "nationalen
Führungsschichten",
die nun als potentielle Widerstandsgefahr präventiv mundtot gemacht werden
sollten. Darunter waren zahlreiche Vertreter der Intelligenz, Funktionäre des
mitgliederstarken und im aktiven Widerstand tätigen Turnvereins "Sokol",
Legionäre des Ersten Weltkriegs, linksgerichtete und regimefeindliche Politiker
sowie politisch aktive Geistliche.
Da die Nationalsozialisten nun keine Rücksicht mehr auf Reaktionen aus dem
Ausland nehmen mussten, wurde ein Teil der Verhafteten gleich in den folgenden
Tagen in Konzentrationslager deportiert, in denen sehr viele bis zur Befreiung
ausharren mussten. Das Ziel dieser Terroraktion war die Einschüchterung und
Abschreckung der Protektoratsbevölkerung gleich zu Kriegsbeginn, damit während
der Kampfhandlungen an der "inneren Front" Ruhe herrschte.
Der gewaltige Widerstandswille im Protektorat wurde
dadurch allerdings kaum beeinträchtigt. Bereits am 28. Oktober 1939 kam es
anlässlich einer Gedenkfeier zum elften Gründungstag der ersten ČSR zu
zahlreichen Massendemonstrationen, bei denen die Tschechen "durch das Tragen
festlicher Kleidung und nationaler Abzeichen ihre Ablehnung des
Besatzungsregimes kundtaten."
Die Spannung, die sich zwischen Besatzern und Besetzten schon seit Wochen
aufgebaut hatte, entlud sich, als es in Brünn und Prag zu großen
Studentenunruhen im Zuge der Beerdigung eines erschossenen Studenten kam. Der
Widerstand wurde am 17. November blutig niedergeschlagen. Die Gestapo ging dabei
besonders gewaltsam vor, ließ neun Studentenfunktionäre sofort hinrichten und
insgesamt etwa 1.200 Studenten festnehmen. Alle wurden in das KZ Sachsenhausen
eingeliefert, wo sie von der SS zumindest in der ersten Zeit eine besonders
brutale Behandlung erfuhren.
Mit ihnen hatten die Besatzer erneut wertvolle Geiseln in der Hand, die sie bei
innenpolitischen Krisen und Konflikten mit der Protektoratsregierung benutzten,
um wichtige Zugeständnisse zu erzwingen.
Als Gegenleistung wurden immer wieder einige Studenten aus dem
Konzentrationslager entlassen. Die Hochschulen als Brutstätten des Widerstandes
blieben von diesem Tag an bis auf Weiteres geschlossen. Die Verfolgung der
Studenten rief in der tschechischen Bevölkerung einen regelrechten Schock
hervor, so dass es bis zum Ende der Besatzungszeit zu keinen größeren offenen
Protestkundgebungen mehr kam.
Obwohl im Jahr 1940 keine bedeutende Terrorwelle
stattfand, wurden die Verhaftungen fortgesetzt. Es war vor allem der
organisierte Widerstand beider Richtungen, der in diesem Jahr harte Schläge
einstecken musste. Auch in den Kreisen etlicher höherer oder niedrigerer
Parteifunktionäre, sorgten die Besatzer mit zahlreichen Festnahmen zunächst für
Ruhe. Diese hielt allerdings nicht lange an. Denn mit dem Beginn des Krieges
gegen die Sowjetunion, festigte sich der Widerstand im Protektorat in allen
Bereichen. Der Reichsprotektor Freiherr von Neurath schrieb in seinem
Monatsbericht an den Chef der Reichskanzlei Lammers, dass "unter der
Oberfläche [...] überall das Ansteigen des passiven Widerstandes und der
Feindseligkeit gegen alles Deutsche zu beobachten (sei); einzelne Deutsche
werden schikaniert, boykotiert und bedroht, deutschfeindliche Tschechen
terrorisiert."
Er hob weiter die Beobachtung hervor, dass "die deutschfeindliche Haltung
mehr und mehr auch auf die tschechische Arbeiterschaft übergreift."
Auch die Kriegsproduktion sank deutlich, während Streiks und Sabotageakte
zunahmen. In dieser Situation sandte Hitler am 27. September 1941 den Experten
für radikale Lösungen, Reinhard Heydrich, nach Prag und ernannte ihn zum
stellvertretenden Reichsprotektor. Heydrich rief sogleich den Ausnahmezustand
aus und entfesselte eine neue Terrorwelle, die sich in ihrer Qualität von den
vorangegangenen fühlbar unterschied. Es kam zu 4.000 bis 5.000 Festnahmen und
Hunderten von Hinrichtungen. Heydrich wies sogar den Chef der Gestapo, Heinrich
Müller, an die verurteilten Tschechen "ausschließlich an das
Konzentrationslager Mauthausen",
eines der wenigen KZs der Stufe III,
zu überführen. Der Terror richtete sich diesmal nicht nur gegen die Intelligenz,
sondern gegen alle Schichten der tschechischen Gesellschaft. Darunter auch gegen
zahlreiche Arbeiter, die durch ihre Abwesenheit in den Fabriken, ihre geringe
Arbeitsleistung oder durch Streiks die Kriegsproduktion beeinträchtigt hatten.
Die ländliche Bevölkerung wurde nun ebenfalls verfolgt, da sie durch Gewalt und
Einschüch-terung zu Zwangsabgaben ihrer landwirtschaftlichen Produkte gebracht
werden sollte. Nach Král war nahezu jedes Dorf betroffen.
Der Widerstand sollte auf diese Weise endgültig seiner Massenbasis
beraubt werden.
Nach dem Ende des Ausnahmezustandes, der seine Wirkung bei der tschechischen
Bevölkerung nicht verfehlte, ging der Terror auch im neuen Jahr 1942 im
Verborgenen weiter.
Am 27. Mai 1942 wurde in einer Haarnadelkurve auf dem
Prager Ring von einer Gruppe von tschechischen Fallschirmagenten, die aus London
entsandt worden waren, ein Attentat auf Heydrich verübt, an dessen Folgen er
nach wenigen Tagen starb. Dieser Vorfall traf die deutsche Reichsregierung
ziemlich unvorbereitet und ihre Reaktion war entsprechend heftig. Frank, der nur
zwei Stunden nach dem Attentat mit Hitler telefonierte, notierte in seinem
Protokoll unter anderem folgende Befehle: "Für die Ergreifung der Täter ist
eine Belohnung von 1 Million Reichsmark auszusetzen. [...] Wer den Tätern
irgendwie Hilfe leistet oder von ihrem Aufenthalt Kenntnis hat und keine Anzeige
erstattet, wird mit seiner gesamten Familie erschossen. [...] Als Sühnemaßnahme
sind 10.000 verdächtige Tschechen oder solche, die politisch etwas auf dem
Kerbholz haben, zu ergreifen bezw. soweit sie bereits in Haft sind, in den
Konzentrationslagern zu erschießen."
Auch wenn Frank am nächsten Tag persönlich im Führerhauptquartier die
Rücknahme des letzten Befehls erreichte, folgte die bis dahin größte und
blutigste Terrorwelle in der Geschichte des Protektorats. Sie erhielt in der
tschechischen Historiografie mit der Bezeichnung "Heydrichiade" sogar einen
eigenen Namen, der ihren besonders grausamen Charakter unterstreichen soll.
Wieder wurde der zivile Ausnahme-zustand ausgerufen, durch welchen erneut
Tschechen aus allen Gesellschaftsschichten unmittelbar bedroht waren. Aufgrund
des Grundsatzes der kollektiven Verantwortung kam es zu tausenden Festnahmen und
Verurteilungen. Die Dörfer Lidice und Ležáky wurden buchstäblich dem Erdboden
gleichgemacht, ihre Bewohner erschossen oder in Konzen-trationslager
verschleppt. Die Besatzer begannen auch mit der Inhaftierung von Angehörigen
zahlreicher tschechischer Emigranten, um die Exilregierung in London besonders
stark unter Druck zu setzen. Insgesamt wurden bis zum 1. September 1942 1.357
Personen zum Tode verurteilt und hingerichtet, darunter 477 "wegen Gutheißung
des Attentats".
Der Terror verbreitete in der ganzen tschechischen Bevölkerung eine Atmosphäre
von Angst und Schrecken. Die endlosen Hausdurchsuchungen und Verhaftungen
betrafen beinahe jede Familie. Frank selbst machte in einer Rede deutlich, wie
stark die Bevölkerung durch die Verfolgungen unter Druck gesetzt wurde: "Es
ist eine unumstößliche Tatsache, daß das tschechische Volk vom 4. Juni 1942, dem
Todestag Heydrichs, bis zum 18. Juni 1942, dem Tag der Erfassung der Attentäter,
die schwerste Krise seit Protektoratserrichtung erlebte."
Nachdem im Herbst 1942 der Ausnahmezustand aufgehoben
wurde, kam es bis zum Ende des Krieges zu keinen großen Massenverhaftungswellen
mehr. Der stille Terror gegen die aktiven oder passiven Regimegegner wurde
allerdings weiterhin fortgesetzt.
Insgesamt fielen zwischen 337.000 und 343.000 Tschechen
und Slowaken dem national-sozialistischen Terror zum Opfer,
wobei über 20.000
von ihnen in Konzentrations- oder anderen Lagern, auf Todesmärschen oder in den
Gestapogefängnissen starben. Viele Opfer der hier beschriebenen
Verhaftungswellen gingen auch durch das KZ Dachau. Von ihnen und ihrem Leben und
Sterben hinter dem elektrischen Stacheldraht handeln die nächsten Kapitel.
>>> weiter:
Einlieferungsschübe tschechischer Häftlinge ins KZ Dachau
Zur Diskussion im Forum:
[Nationalsozialistische
Konzentrationslager]
-
Deutschland-Berichte der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands von 1939,
zitiert nach: Gebel, Ralf: Die tschechische Gesellschaft unter deutscher
Besatzungsherrschaft im Protektorat Böhmen und Mähren, in: Maier, Robert
(Hrsg.): Tschechen, Deutsche und der Zweite Weltkrieg. Von der Schwere
geschichtlicher Erfahrung und der Schwierigkeit ihrer Aufarbeitung. (=
Studien zur internationalen Schulbuchforschung; 94), Hannover 1997, S. 23 –
37; vgl. auch: Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat,
Teil 1: Besatzungspolitik, Kollaboration und Widerstand im Protektorat
Böhmen und Mähren bis Heydrichs Tod (1939 – 1942), München 1969, S. 20.
-
Zit. nach: Kárný, Miroslav: Protektorat Böhmen und Mähren, in: Benz,
Wolfgang/Graml, Hermann/Weiß, Hermann (Hrsg.): Enzyklopädie des
Nationalsozialismus, München 31998, S. 656 – 657.
-
Ebenda, S. 656.
-
Feierabend, Ladislav: Prag-London vice versa, Bd. 1, Bonn, Bruxelles, New
York 1971, S. 107.
-
Völkischer Beobachter vom 6.2.1940, zitiert nach: Zámečník, Dachau, S. 117,
Anm. 39.
-
"Denkschrift über die Behandlung des Tschechenproblems und die zukünftige
Gestaltung des böhmisch-mährischen Raumes" vom 28.8.1940, abgedruckt bei:
Die Deutschen in der Tschechoslowakei 1933 – 1947. Dokumentensammlung,
zusammengestellt, mit Vorwort und Anmerkungen versehen v. Václav Král, Prag
1964, Dok. Nr. 315, S. 419.
-
Siehe dazu Brandes, Die Tschechen, Teil 1, S. 124 – 136.
-
Ersichtlich aus der geheimen Rede Heydrichs am 2.10.1941 in Prag:
"Ich brauche also Ruhe im Raum, damit der Arbeiter, der
tschechische Arbeiter für die deutsche Kriegsleistung hier vollgültig seine
Arbeitskraft einsetzt.[...]."
Rede abgedruckt bei: Die Vergangenheit warnt. Dokumente über die
Germanisierungs- und Austilgungspolitik der Naziokkupanten in der
Tschechoslowakei. Zusammengestellt, mit einem Vorwort und Anmerkungen
versehen von Dr. Václav Král, Prag 21962, S. 128.
-
Kural, Václav: Kollaboration und der tschechische Widerstand im Protektorat,
in: Maier, Robert (Hrsg.): Tschechen, Deutsche und der Zweite Weltkrieg. Von
der Schwere geschichtlicher Erfahrung und der Schwierigkeit ihrer
Aufarbeitung. (= Studien zur internationalen Schulbuchforschung; 94),
Hannover 1997, S. 60.
-
Brandes, Die Tschechen, Teil 1, S. 78.
-
Ebenda, S. 78 – 79.
-
Ebenda, S. 78 – 80.
-
Ebenda, S. 53 – 96, S. 171 – 206, S. 242 – 250 sowie Brandes, Detlef: Die
Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil 2: Besatzungspolitik,
Kollaboration und Widerstand im Protektorat Böhmen und Mähren von Heydrichs
Tod bis zum Prager Aufstand (1942 – 1945), München, Wien 1975, S. 61 – 112.
-
Král, Václav: Zločiny proti Evropě. [Verbrechen gegen Europa], Praha 1964,
S. 380. Die Intelligenz sei außerdem
"stimmungsmäßig kaum zu gewinnen", und da sie immer wieder
"Führungsansprüche gegenüber den anderen tschechischen Volksteilen"
anmelde, müsse sie "zusammen mit den
rassisch-mongoloiden" Bevölkerungsteilen "scharf angefaßt und ausgeschaltet
werden." IMT, Bd. 3, S. 662.
-
Die Rolle der sudetendeutschen Nationalsozialisten ist in der bisherigen
Forschung entweder gar nicht oder in den meisten Fällen völlig ungenügend
untersucht worden. Dabei spielten sie gerade bei den Massenverhaftungen eine
besonders wichtige Rolle. Vgl.: Kárný, Miroslav: Der Holocaust und die Juden
in Böhmen und Mähren, in: Maier, Robert (Hrsg.): Tschechen, Deutsche und der
Zweite Weltkrieg. Von der Schwere geschichtlicher Erfahrung und der
Schwierigkeit ihrer Aufarbeitung. (= Studien zur internationalen
Schulbuchforschung; 94), Hannover 1997, S. 47.
-
Bericht Befehlshaber der Sipo und des SD vom 13.5.1939, in: Milotová/Kárny:
Anatomie okupační politiky, S. 83 - 84; vgl. auch Brandes, Detlef:
Nationalsozialistische Tschechenpolitik im Protektorat Böhmen und Mähren,
in: Brandes, Detlef/Kural, Václav (Hrsg.): Der Weg in die Katastrophe.
Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen 1938 – 1947 (= Veröffentlichungen
des Instituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa;
3), Essen 1994, S. 42.
-
Vgl. Brief Himmlers an den Reichsprotektor Konstantin Freiherr von Neurath
vom 8.6.1939: "Der Führer hat weiterhin folgendes
angeordnet: sämtliche Verhafteten sollen sofort in ein Konzentrationslager
überführt werden (vom Reichsführer SS ist dafür Mauthausen bestimmt). Es ist
auf die Benennung der Täter eine hohe Prämie auszusetzen. Der Stadt ist eine
sehr hohen Busse im Verhältnis zu der Größe der Stadt aufzuerlegen, z. B.
von einer Million."
DaA 33.903/2.
-
"Drei schreckliche Tage von Schlägen, Folter, Regen
und abscheulicher Arbeit [...].
Ekelhaft stinkendes Essen. Gleich nach der
nächtlichen Ankunft in Mauthausen mussten wir auf den Boden in den Dreck
fallen und auf diesem, aus menschlichen Körpern gebildeten Gehweg, liefen
die SS Männer in hohen Stiefeln wie von Sinnen."
Kašák, Karel: Češi v koncentračním táboře Dachau. [Tschechen
im Konzentrationslager Dachau], in: Almanach Dachau. Kytice událostí a
vzpomínek. [Ein Strauss von Ereignissen und Erinnerungen], Prag 1946, S. 15.
In dieser kurzen Darstellung dokumentiert Kašák die Geschichte der Tschechen
im KZ Dachau von Juni 1939 bis Juni 1943. Sie entstand direkt nach der
Befreiung als ein Bericht für das tschechoslowakische Ministerium der
Sozialfürsorge in Prag. Die meisten Angaben decken sich ziemlich genau mit
anderen Quellen, wie etwa mit der Häftlingsdatenbank oder zahlreichen
Erinnerungsberichten.
-
Zámečník, Dachau, S. 116.
-
Brandes, Nationalsozialistische Tschechenpolitik, S. 40.
-
Ebenda, S. 41.
-
"Aus den Baracken, in denen die tschechischen
Studenten untergebracht waren, hörte man ständig erschütternde Schreie und
das Wehklagen der gequälten Menschen. Überall begegnete man blutig
geprügelten Männern."
Zitat des ehemaligen Häftlings aus Sachsenhausen Dr. Bohdan
Rossa aus Prag. Zitiert nach: Naujoks, Harry: Mein Leben im KZ Sachsenhausen
1936 – 1942. Erinnerungen eines ehemaligen Lagerältesten, Köln 1987, S. 153.
-
Brandes, Nationalsozialistische Tschechenpolitik, S. 42.
-
Monatsbericht für den August und die erste Septemberhälfte 1940. Abgedruckt
in: Milotová,
Jaroslava/Kárny, Miroslav/Kárna, Margita (Hrsg.): Deutsche Politik im
"Protektorat Böhmen und Mähren" unter Reinhard Heydrich 1941 – 1942. Eine
Dokumentation (= Nationalsozialistische Besatzungspolitik in Europa 1939 –
1945; 2), Berlin 1997, S. 77.
-
Ebenda, S. 78.
-
Schreiben vom 30.9.1941, abgedruckt bei: Milotová/Kárny/Kárna: Deutsche
Politik im Protektorat, Dok. 19, S. 102.
-
Seit dem Jahr 1940 wurden die Konzentrationslager in verschiedene Kategorien
eingestuft. Stufe III galt für
"schwerbelastete, insbesondere auch gleichzeitig kriminell vorbestrafte,
ausgesprochen asoziale und daher kaum noch erziehbare Schutzhäftlinge".
Kategorisierung als Faksimile abgedruckt bei: Tuchel, Die Inspektion, S. 67.
Neben Mauthausen galten auch das Nebenlager Mauthausen-Gusen und das KZ
Groß-Rosen als Lager der Stufe III. Nur wenige dieser Tschechen kamen aus
Mauthausen zurück, da viele von ihnen zur tödlichen Arbeit im Steinbruch
verurteilt wurden.
-
Král, Zločiny, S. 373.
-
Ebenda, S. 373 – 374.
-
Brandes, Die Tschechen, Teil 1, S. 211.
-
Milotová/Kárny/Kárna: Deutsche Politik im Protektorat, Dok. 105, S. 281.
-
Zit. nach: Brandes, Nationalsozialistische Tschechenpolitik, S. 47.
-
Franks Rede vom 27. – 31.3.1944 in Bad Karlsbrunn abgedruckt bei: Die
Vergangenheit warnt, S. 523.
-
Darunter ca. 265.000 Juden und 7.000 Roma, die die rassische Verfolgung im
Zuge der "Endlösung der Judenfrage" nicht überlebt haben. Weiter etwa 3.000
Personen, die während des Zwangsarbeitseinsatzes starben sowie ca. 6.800
Soldaten der Auslandsarmee, die an der Ostfront oder in Afrika fielen.
Zusätzlich starben über 4.000 Menschen bei Luftangriffen und rund 8.000 bei
"bewaffneten Zusammenstößen" im Protektorat. Schließlich wurden etwa 8.500
Tschechen und Slowaken von den Nationalsozialisten hingerichtet. Zu näherer
Aufschlüsselung der Zahlenangaben siehe bei: Škropil, Pavel: Probleme bei
der Berechnung der Zahl der tschechoslowakischen Todesopfer des
nationalsozialistischen Deutschlands, in: Brandes, Detlef/Kural, Václav
(Hrsg.): Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehungen
1938 – 1947 (= Veröffentlichungen des Instituts für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa; 3), Essen 1994., S. 163 – 164.
-
In dieser Zahl sind die Opfer der rassischen Verfolgung, wie Juden und Roma
nicht enthalten. Ebenda, S. 163.
5. ANHANG
5.1.1 Quellenverzeichnis
5.1.2
Literaturverzeichnis
5.2.0 Abkürzungen
Zur Diskussion im Forum:
[Nationalsozialistische
Konzentrationslager]
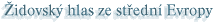
hagalil.com 08-2004 |