|
Erfahrungen als erste Frau im rabbinischen Amt nach der Schoa in Deutschland
von Rabbiner Bea
Wyler, Oldenburg
Guten Abend,
meine Damen und Herren,
eigentlich sollte ich heute abend zwei Krankenhausbesuche machen, statt hier
zu sein. Beide Kranken wissen, wo ich bin, und haben großzügigerweise
zugestanden, daß sie in diesem Fall auch mit einem telefonischen
Krankenbesuch zufrieden seien. Diese Mini-Episode charakterisiert in
eigentümlicher Weise mein Rabbinat. Lassen Sie mich etwas ausholen. Ich bin
seit fast vier Jahren im Rabbinat. In der Tat wiederholt sich in wenigen
Tagen, nämlich am 18. Mai, der Tag meiner Ordination zum Rabbiner am Jewish
Theological Seminary of America in New York. Nach dem jüdischen Kalender bin
ich schon seit Lag baOmer vor vier Jahren mit der Autorität ausgestattet,
„in Israel als Rabbiner zu predigen und zu lehren“. Meine Ordinationsurkunde
ermächtigt mich, Tora in der Öffentlichkeit zu verbreiten, also Wissenschaft
des Geistes sowie Ehrfurcht vor Gott innerhalb meiner Gemeinde zu
verbreiten, was ich seit fast vier Jahren in Deutschland tue.
Seit August 1995 bin ich
als Gemeinderabbiner für die jüdischen Gemeinden Oldenburg und Braunschweig,
seit August 1997 auch für die neugegründete Gemeinde Delmenhorst zuständig.
In den ersten drei Jahren unterrichtete ich auch noch rabbinische Literatur
an der Universität Oldenburg.Die Tora schreibt uns vor, daß von einem
neugepflanzten Baum in den ersten drei Jahren nichts geerntet werden darf.
Die Ernte des vierten Jahres gehört den Priestern, und erst im fünften Jahr
darf der Baum regulär genutzt werden. Unsere Gemeinde-Bäume sind weit davon
entfernt, ausgewachsen zu sein. An der Schwelle meines fünften Jahres im
Rabbinat stelle ich jedoch mit großer Befriedigung fest, daß sie viele
Früchte tragen, mehr und mehr, manche zwar noch etwas klein und sauer, aber
durchaus auf dem Weg zur Reife. Niemand hätte erwartet, am wenigsten wir
selber, daß wir bereits nach vier Jahren regulär ernten würden. Unsere
Widersacher von nah und fern stellen dies inzwischen mit einigem Neid fest,
worüber wir manchmal schmunzeln.Als ich mein Amt antrat, wurde ich während
Wochen in den Medien herumgeschleppt: als erste Rabbinerin Deutschlands nach
der Schoa, als erste Rabbinerin überhaupt, als erste Schweizer Rabbinerin,
etc. Ich möchte hier festhalten, daß ich an solchen Trophäen weder
interessiert war noch bin. Gegner aus unseren eigenen Reihen stellten mich
als Monster dar, das sich schamlos der jüdischen Tradition bemächtigt, und
diese somit dem Ausverkauf preisgibt. Mir wurde vorgeworfen, nie auf dem
direkten Weg, sondern immer aus dem fiesen Hinterhalt oder über die Medien
zu agieren, ich und meine Gemeindepräsidentinnen würden nicht nur das
Judentum verwässern, sondern ihm auch bleibenden Schaden zufügen.
Wir begannen in
Oldenburg und Braunschweig mit unserer Aufbauarbeit, auch wenn der Wind
bisweilen scharf blies. Die Resultate dürfen sich sehen lassen. Ja,
inzwischen ist es sogar so, daß uns manche Kreise regelrecht hofieren,
obschon mir andererseits erst kürzlich nachgesagt wurde, ich sei ja wohl der
Ansicht, daß ich noch lange die einzige Rabbinerin in Deutschland sein
würde. Da höre ich dann plötzlich aus der Gerüchteküche, daß manche, die
vergeblich versucht haben mich zu instrumentalisieren, sich darüber
mockieren, daß „die Wyler so strikt“ sei. Es gibt in Deutschland gar schon
einen Stellenmarkt für mich und weitere Kolleginnen – damit hätte ich am
wenigsten gerechnet.Ich möchte Ihnen nun Einblick in meine Aufgaben als
Gemeinderabbiner geben, indem ich Ihnen etwas über meine Arbeit in den
Gemeinden berichte. Nehmen Sie unsere Schwierigkeiten zur Kenntnis und
freuen Sie sich mit uns über unsere Erfolgsgeschichten.
Wie bereits erwähnt,
amtiere ich als Rabbiner der drei jüdischen Gemeinden in Oldenburg,
Braunschweig und Delmenhorst, alle in Niedersachsen, im Nordwesten der BRD.
Braunschweig, 1957 gegründet, ist die älteste, gefolgt von Oldenburg, welche
1992 neugegründet wurde, und die jüngste ist Delmenhorst, jetzt im zweiten
Jahr ihrer Existenz. Die drei Gemeinden haben insgesamt etwas über 500
Mitglieder, alle drei Gemeinden sind Mitglieder des Zentralrates der Juden
in Deutschland, verkörpern also die vielgeschmähte Einheitsgemeinde. Doch
darüber später noch etwas mehr. Von Oldenburg nach Braunschweig fährt man
mit der Bahn fast drei Stunden, Delmenhorst ist nicht weit, und wenn Sie
Exotisches aus meinem Rabbinat erwarten, so ist dies wahrscheinlich das
Exotischste, was ich Ihnen bieten kann, daß ich nämlich in Oldenburg auf
meinem Dienstrad von Ort zu Ort, von Haus zu Haus fahre: der Rabbiner auf
dem Fahrrad.Das Folgende gilt hauptsächlich für Oldenburg, doch ist die
Situation in den beiden anderen Gemeinden nicht wesentlich anders. Wir haben
keine Sekretärin, wir haben keine ausgebildeten Lehrer, wir haben kein
jüdisches Bestattungsinstitut – es gibt viel Do-it-yourself. Wir sind
Weltmeister im Improvisieren, und meine Anstellung ist mit 75% eine
Teilzeitstelle. Mit solcherart limitierten Möglichkeiten müssen wir
Prioritäten setzen, immer und täglich neu. So haben wir vor vier Jahren
begonnen: Talmud Tora für Erwachsene und Kinder jede Woche, Schabbat
Gottesdienste mit Kabbalat Schabbat und vollem Schabbatmorgen-Programm
einmal monatlich. Inzwischen haben acht Mitglieder gelernt aus der Tora
vorzulesen, einschließlich vier Bne Mitzwa, die inzwischen auch mehr oder
weniger regelmäßige Lejner (Toraleser) sind. Eine beachtliche Anzahl
Mitglieder haben Teile der Gottesdienste so gelernt, daß sie als Vorbeter
diese Gottesdienste kompetent leiten können. Der Rabbiner muß für die
Durchführung gepflegter Gottesdienste nicht mehr unbedingt anwesend sein,
denn für jedes Gebetsteil haben wir drei Mitglieder, die es vorbeten können.
Vor diesem Hintergrund konnten wir in Oldenburg die Schabbatgottesdienste
verdoppeln, d.h. wir treffen uns seit eineinhalb Jahren vierzehntäglich.
Braunschweig bleibt vorderhand bei einmal monatlich. Und in Delmenhorst
findet wöchentlich Kabbalat Schabbat statt, ein Schabbatmorgen-Gottesdienst
jedoch nicht regelmäßig, doch wird sich dies nach der Einweihung der neuen
Synagoge Ende dieses Monats bald ändern.
Ein Wort zu den
Lernmethoden: Natürlich ist ein persönlicher Lehrer nicht zu ersetzen, dies
gilt besonders für Toralernen, und ich bedaure es jedesmal, wenn die nicht
vorhandene Zeit mich dazu zwingt, einen Lernwilligen auf später zu
vertrösten. Moderne didaktische Mittel wie Tonbandkassetten und Computer
haben hier wesentlich zum Erfolg in meinen Gemeinden beigesteuert. Gültig
und von uns deswegen auch häufig eingesetzt ist die Erfahrung, daß jeder,
der selbst etwas gelernt hat, der ideale Lehrer ist, es dem nächsten
weiterzugeben. Manchmal greifen wir auch zu Methoden, die für viele
Traditionalisten ein Greuel wären. Ein Junge, der sehr schön singen kann,
schlug mir kurz nach seiner Bar Mitzwa vor, das ganze Schacharitgebet
(Morgengebet) in lateinische Buchstaben zu transliterieren, so daß er bald
vorbeten könnte. Ich erlaubte dies unter der Bedingung, daß er es selber
ausführte; damit wollte ich sicher gehen, daß er zumindest beim Akt des
Transliterierens Hebräisch lesen würde. Nach dem vierten Mal Vorbeten kam er
zu mir und sagte ganz stolz, er hätte sich jetzt von seinen „Krücken“
emanzipiert und könne aus dem Siddur vorbeten. Für die Toravorlesung habe
ich einen Farbcode entwickelt, und manche meiner Lejner bitten mich
plötzlich, ihnen am Telefon eine „hellblaue Familie“ vorzusingen.
Gottesdienste an den
Feiertagen sind etwas schwieriger zu bewältigen, da sie ja in allen
Gemeinden gleichzeitig stattfinden. Für die Hohen Feiertage mußte ich zu
sehr kreativen Lösungen greifen, da wir keine Machsorim
(Feiertagsgebetsbücher) besitzen. Ich stellte eine Broschüre als Ergänzung
zu unserem regulären Siddur zusammen, die bewältigbare Mengen an Liturgie
enthält. Aus naheliegenden Gründen gibt es diese Broschüre in zwei Ausgaben,
nämlich mit deutscher und russischer Übersetzung. Eines unserer Mitglieder,
inzwischen in Ausbildung zum Rabbiner, leitete im vergangenen Jahr die
Gottesdienste in Braunschweig. Zwei weitere Mitglieder aus Oldenburg
leiteten stark abgekürzte Gottesdienste in Delmenhorst. Und in Oldenburg
lernten mehrere Mitglieder kleinere Teile der umfangreichen Liturgie. Es war
viel Bewegung auf der Bima (Vorbeterpult), doch haben wir es ganz allein
bewältigt, wobei mich besonders die heilige Atmosphäre beeindruckte.Alter
und Geschlecht stellen keine Hindernisse dar in unseren Gemeinden, wenn es
ums Vorbeten geht. Die Großmutter, die zu ihrem 60. Geburtstag lejnen lernt,
ist genauso willkommen, wie der Bar Mitzwa, der zu Jom Kippur eine kurze
Dewar Tora (Textauslegung) halten möchte. In der Tat liegt der Schwerpunkt
in meinem Rabbinat auf Talmud Tora. Es liegt mir sehr am Herzen, daß wir
nicht nur unsere Tradition zur Kenntnis nehmen, sondern uns mit ihr
auseinandersetzen, mit ihr ringen und dabei lernen, ein modernes Leben nach
jüdischen Vorstellungen zu leben. Wir haben regelmäßig zwanzig und mehr
Teilnehmer an unseren wöchentlichen Toralernabenden – ja, in Oldenburg ist
der Mittwoch fast so heilig wie der Schabbat.
Anfragen und Vorschläge
für zusätzliche Programme kommen jetzt aus den Reihen unserer Mitglieder.
Wir stellen auch Informationsblätter zu den verschiedensten Themen zusammen,
wie beispielsweise „Mesusa“ oder „Schabbat zu Hause“. Unsere Kinder wissen
inzwischen, daß sie am Schabbat ein Recht auf einen Segen haben, und es ist
auch schon vorgekommen, daß mich ein Kind bat, bei der Überzeugung der
Eltern zu helfen, daß diese doch endlich diesen Segen lernen sollten. Wir
haben es geschafft, wenn unsere Mitglieder ihr Judentum als etwas
Selbständiges, und nicht als etwas Aufgesetztes erleben, wenn sie ihr
eigenes Judentum auskundschaften und ausprobieren, wenn sie daran Gefallen
finden, daß die Tradition einen festen Platz in ihren Herzen und ihren
Häusern bekommt. Ich bin besonders davon beeindruckt und berührt, wie meine
Gemeindemitglieder nicht mehr von der Tora sondern von meiner Tora oder
unserer Tora sprechen.Wer immer eine neue Prise Tora gelernt hat, wird
ermutigt, sie mit jemandem zu teilen, der sie noch nicht kennt. Es kommt in
unseren Gemeinden vor, daß eine Zweitklässlerin ihrem Vater Hebräisch lesen
beibringt, oder daß ein älteres Mitglied sich plötzlich an eine längst
vergessene Melodie erinnert, die wir dann gemeinsam lernen, wobei andere
plötzlich an Schawuot-Lernen den Kindern den Vortritt lassen, wenn sie als
Lehrer den Erwachsenen etwas von ihrer Tora beibringen wollen. Daß das
Schawuot-Lernen hauptsächlich von den Mitgliedern und nicht vom Rabbiner
bestritten wird, ist normal. Und in diesem Jahr werden wir sogar erstmals
versuchen, die ganze Nacht durchzulernen, Schacharit beginnt morgens um halb
fünf.
Den Pessachseder haben
wir „privatisiert“, weil die Erfahrungen mit dem Gemeindeseder
unbefriedigend waren. Stattdessen bieten wir jeweils vor Pessach einen
Workshop aus vier Abenden an, wo wir die Teilnehmer anleiten, wie sie
Pessach zu Hause feiern können; eingeschlossen sind Notenblätter, eine
Kassette mit den Liedern, sowie ein Blatt mit Rezepten. Nur noch die
Bestellung von Mazzen und koscherem Wein erfolgt über die Gemeinde. In
diesem Jahr haben mindestens ein Dutzend, zum Teil große, Sedarim in
Oldenburg stattgefunden. Wir erreichen damit, daß das Judentum nicht nur in
der Synagoge und im Gemeindezentrum stattfindet, sondern dezentralisiert in
den privaten Haushalten.Wir regen immer wieder an, daß die Mitglieder Fragen
stellen, wenn sie etwas genauer wissen möchten. So ist kürzlich aus der
mehrfachen Wiederholung der Frage nach Jahrzeit unser neuestes Merkblatt
„Kaddisch, Jahrzeit und andere Trauerrituale“ entstanden, von dem es auch
eine russische Version gibt. Es ist selbstverständlich, daß alle Gemeinden
eine Chewra Kaddischa für Männer und Frauen haben, die sich bei Todesfällen
um alles einschließlich der Tahara (Leichenwaschung) und der Levaja
(Begräbnis) kümmert.
Die Oldenburger Gemeinde
gründete sich vor knapp sieben Jahren mit 34 Mitgliedern, heute haben wir
gegen 200. Die meisten sind Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, die
von ihren jüdischen Traditionen weitgehend entfremdet waren. Wir sind also
eine Gemeinde von fast ausschließlich wahren Anfängern. Wir kümmern uns im
Rahmen unserer Möglichkeiten um die Neuankömmlinge in den Heimen, indem wir
ihnen u.a. den Gottesdienstbesuch am Schabbat ermöglichen. Manche von ihnen
ziehen nach Oldenburg, Braunschweig und Delmenhorst, wo sie
Gemeindemitglieder werden können, sobald wir ihren halachischen
(religionsgesetzlichen) Status abgeklärt haben. Von manchen wünschen wir
uns, daß wir sie etwas häufiger in der Gemeinde sehen würden, manche kommen
regelmäßig, sobald ihre Deutschkenntnisse so sind, daß sie etwas verstehen.
Und manchmal führt die Begegnung auch zu unvergeßlichen Situationen, wie der
folgenden: Anhand des Tischgebetes versuchte ich das Konzept „Erez Israel
als Erbschaft“ zu erklären. Als ich fragte, von wem wir das Land erhalten
hätten, schlug einer der Neuen prompt vor „von der UNO“. Ich brachte sanft
Gott ins Gespräch, doch da argumentierte er schnell: „Sie haben das Land
vielleicht von Gott bekommen, wir sind Atheisten, wir haben es von der UNO.“
Unser wunderschönes
Gemeindezentrum ist bereits zu klein. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit
der Stadt Oldenburg haben wir mit der Planung der Vergrößerung begonnen. Wir
planen auch den Einbau einer Mikwe (rituelles Bad), da die kleinen Seen in
der Umgebung von Oldenburg nur während einiger kurzer Sommermonate benutzt
werden können. Der Bedarf nach einer eigenen Mikwe ist da, denn wir haben
eine ganze Menge junger Paare und Familien, die wir anregen, ihr Eheleben in
einen jüdischen Rahmen zu bringen; außerdem ist die Anzahl an
interreligiösen Familien in unseren Gemeinden noch sehr hoch.Ich erhalte
viele Einladungen in andere Kleingemeinden in ganz Deutschland, die keine
eigenen Lehrer, Rabbiner oder Kantoren haben. Es übersteigt meine
Möglichkeiten, diese Bedürfnisse alle zu befriedigen. Deshalb veranstalten
wir einmal im Jahr ein Wochenendseminar, wo Mitglieder aus anderen Gemeinden
zu uns kommen und von uns lernen. Die Tora enthält keine Geheimnisse, die
wir anderen interessierten Juden vorenthalten wollen. Wer von uns lernen
möchte, wie man Tora lernt oder wie man Schabbatgottesdienste aufbaut, kann
sich dies bei uns holen. Dabei wenden wir uns an Laien, die das Gelernte
möglichst bald in ihren Gemeinden anwenden möchten.
Als Nebenprodukt dieser
Seminare ergibt sich natürlich ein Netzwerk von Beziehungen und
Bekanntschaften, die das Gefühl der Insularität schnell vergessen
machen.Auch aus großen Gemeinden kommen inzwischen Teilnehmer zu unseren
Seminaren, weil sie mit und von uns lernen wollen. Darüber freuen wir uns
sehr. Rabbiner Leo Trepp aus Californien, der frühere Landesrabbiner von
Oldenburg von vor dem Krieg, sagt in Abwandlung eines Jesaja-Verses
lächelnd: Von Oldenburg aus verbreitet sich die Tora.Und mit der Erwähnung
seines Namens, komme ich langsam zum Schluß. Ich möchte Ihnen von einem der
aufregendsten Tage in meinem Rabbinat berichten. Am 2. Juli 1997 berief ich
ein Bet Din leGiur (Rabbinergericht für Übertritte) nach Oldenburg ein, weil
wir zehn Kandidaten, fünf Erwachsene und fünf Kinder, für den Eintritt ins
Judentum prüfen wollten. Wir flogen zwei meiner Kollegen aus Israel ein,
damit ein gültiges Bet Din gebildet werden konnte. Und für Rabbiner Leo
Trepp, der als Aw Bet Din (Vorsitzender) fungierte, schloß sich der Kreis
der Geschichte. Zwischen seinem letzten und unserem Bet Din waren 59 Jahre
vergangen, 59 Jahre jüdischer Geschichte in Deutschland, voller Horror
gefolgt von einem langdauerndem Vakuum, doch auch mit einigen Wundern. Nach
Inhaftierung im Konzentrationslager Sachsenhausen, hatte er Nazi-Deutschland
1938 als Flüchtling verlassen, jetzt war er wieder hier, um Juden zu machen.
Als ich zu dieser Tagung
eingeladen wurde, baten mich die Organisatorinnen über meine Erfahrung als
Frau im Rabbinat zu berichten. Ich glaube nicht, daß meine hier
geschilderten Erfahrungen so grundlegend anders sind als diejenigen meiner
männlichen Kollegen. Es stimmt, daß ich nicht Mitglied der Deutschen
Rabbinerkonferenz bin, das liegt aber auch daran, daß ich mich um meine
Mitgliedschaft in diesem erlauchten Gemium nicht weiter gekümmert habe.Dem
stehen gute, kollegiale Arbeitsbeziehungen mit mehreren Rabbinern der
verschiedenen Strömungen gegenüber, und selbst der Sprecher der
Rabbinerkonferenz gibt mit seinen notorischen Leserbriefen in der
„Allgemeinen Jüdischen Wochenzeitung“ zu erkennen, daß er mich eigentlich
ganz ernsthaft zur Kenntnis genommen hat. Ich meine, daß meine zum Teil
frustrierenden und von Feindseligkeit geprägten Erfahrungen im Rabbinat mit
meinem Geschlecht wenig zu tun haben, sondern weitgehend die Erfahrungen
sind, die man als Rabbiner in einer Gemeinschaft macht, die sich nach einer
unermeßlichen Katastrophe im Wiederaufbau befindet. Ich bin der Ansicht, daß
wir Juden heute durchaus zu vergleichen sind mit der frührabbinischen
Gemeinde in Erez Israel nach der Zerstörung des Tempels, die nach der
Niederschlagung des Bar-Kochba-Aufstandes zwei volle Generationen brauchte,
bis sie sich durch die Endredaktion der Mischna zumindest in groben Zügen
als neu definiert wiederfand.
Wir sind daran, uns neu
zu definieren. Es liegt auf der Hand, daß es progressivere und
konservativere Formen der Neuorientierung gibt. Die Gefahr liegt nicht in
der Vielfalt, sondern in der Sprachlosigkeit zwischen den Strömungen, die
sich eingeschlichen hat. Und gerade in diesem Bereich hat die
Einheitsgemeinde eine enorm wichtige Aufgabe: Als politische Organisation
muß es der Dachorganisation erstes und oberstes Anliegen sein, die Einheit
von Klal Jisrael (Gesamtheit des Volkes) zu garantieren. Eine enge
Definition für Mitgliedschaftstauglichkeit führt dazu, daß sich zu viele
nicht wiederfinden und sich deshalb außerhalb der Struktur selbständig
machen. Nur eine großzügige Definition, die das Gemeinsame betont, das
möglicherweise an einem kleinen Ort ist, wird Klal Jisrael erhalten können.
Gleichschaltung ist kontraproduktiv, Pluralismus bietet die einzige Chance
der Selbsterhaltung.Die gefährliche Sprachlosigkeit zwischen den
verschiedenen Strömungen betrifft nicht nur Deutschland, sondern die
Judenheit in der ganzen Welt, allem voran in Israel. Hierzulande kommt
erschwerend dazu, daß die neue Selbstfindung der jüdischen Gemeinde mit den
Umwälzungen in Deutschland selber durch den Fall der Mauer sowie der
allmählichen Vereinigung Europas zusammenfällt. Dieser ganze Prozeß ist
jedoch so spannend, daß ich gerne zugebe, daß ich unter anderem hier bin,
weil es hier spannend ist. Ich möchte meinen Beitrag an Tikun Olam
(Vervollkommnung der Welt als Partner Gottes) hier erbringen, weil ich für
die jüdische Tradition in Europa und insbesondere in Deutschland nicht nur
eine Zukunft sehe, sondern ich möchte diese auch gerne mitgestalten. Mit
meiner Anwesenheit als Jüdin in Deutschland – und als Rabbiner bin ich
natürlich „Berufsjüdin“ – sehe ich meinen Beitrag nicht nur innerhalb der
jüdischen Gemeinschaft, sondern ebenso wichtig auch in einem neuen,
multikulturellen und hoffentlich friedfertigen Europa.Nun möchten Sie zum
Schluß sicher wissen, wie die Episode vom Anfang meiner Ausführungen mein
Rabbinat charakterisiert.
Es ist hoffentlich
deutlich geworden,daß ich nur einen kleinen Teil meiner Aufgaben wirklich
erfüllen kann. Auch habe ich über manche Aufgabe hier gar nicht gesprochen,
weil sie eben nicht erste Priorität hat; als Beispiel möchte ich hier den
interreligiösen Dialog anführen. Die wichtigste Eigenschaft in meinem
Rabbinat ist nicht die umfassende Kenntnis unserer Tradition, sondern ein
Gespür dafür zu entwickeln, die Prioritäten richtig zu setzen. Manches, das
dringend ist, ist beim genaueren Hinsehen doch nicht so dringend, und
manches, das viel Zeit erfordern würde, wird machbar, wenn ich nicht
persönlich anwesend sein muß – so kommen die Krankenbesuche per Telefon
zustande. Ich ringe immer wieder neu mit der Logistik in meinem Rabbinat,
und finde mich manchmal nur sehr schlecht damit ab, daß ich nicht an zwei
oder gar drei Orten gleichzeitig sein kann.Die Episode ist aber noch aus
einem ganz anderen Grund charakteristisch für mein Rabbinat. Die beiden
Kranken sind nicht gewöhnliche Kranke, sondern Frischoperierte, die sich
ihrer Brit Mila (Beschneidung) unterzogen haben. Sie wurde von unserem
eigenen Mohel durchgeführt. Als Chirurg weiß er, was medizinisch zu tun ist,
ich habe ihn, zusammen mit einem erfahrenen Mohel, mit den religiösen
Inhalten ausgerüstet. Und wir sind als jüdische Gemeinde wieder ein
Stückchen unabhängiger geworden, denn wir wollen unser Judentum als etwas
Selbstverständliches leben. An der Schwelle meines fünften Jahres im
Rabbinat haben wir in der Tat angefangen zu ernten. Und meinen beiden
Kranken wünsche ich von Herzen schnelle und vollständige Genesung.
Oldenburg/Berlin, 13.
Mai 1999
Bea Wyler wuchs in der
Schweiz auf. Nach einer Karriere als Agronomin und Journalistin entschloß
sie sich zu einem Rabbinatsstudium. 1995 wurde sie am Jewish Theological
Seminary in New York ordiniert.
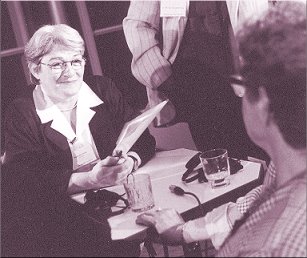
[photo-exhibition]
- [program] - [reactions]
[history of women in the
rabbinate] - [women on the bima]
[start in german] - [start
in english]
every comment or
feedback is appreciated
iris@hagalil.com
|