| 12.03.1938:
Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Österreich, Anschluß an das
Deutsche Reich
Filiale der Leopoldstadt
Das Ende der jüdischen Gemeinden im
Burgenland
In der Nacht vom 11. auf den 12. März 1938 begannen
im Burgenland die nationalsozialistischen Vertreibungs- und
Verfolgungsmaßnahmen, die den traditionsreichen jüdischen
Kultusgemeinden des Burgenlandes, allen voran den ehemaligen
"Siebengemeinden" (hebr. Schewa Kehilloth ), ein jähes und
erschütterndes Ende setzten.
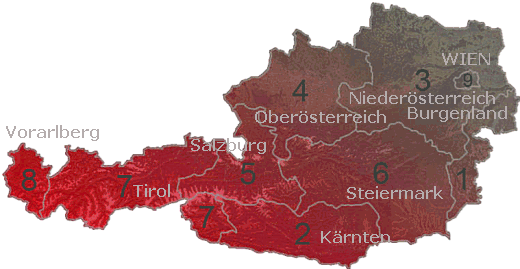
http://de.wikipedia.org/wiki/Österreich
1 Burgenland Eisenstadt 278.655
2 Kärnten Klagenfurt 560.089
3 Niederösterreich St. Pölten 1.575.291
4 Oberösterreich Linz 1.399.226
5 Salzburg Salzburg 526.875
6 Steiermark Graz 1.199.489
7 Tirol Innsbruck 693.651
8 Vorarlberg Bregenz 362.258
9 Wien Wien 1.637.772
Die Geschichte des burgenländischen Judentums geht bis
ins 13. Jahrhundert zurück. Im 17. Jahrhundert entstanden unter dem
Schutz mächtiger ungarischer Feudalherren, wie etwa den Esterházys, die
sogenannten "Siebengemeinden". Dazu gehörten die jüdischen Gemeinden von
Frauenkirchen, Kittsee, Eisenstadt, Mattersdorf, Kobersdorf, Lackenbach
und Deutschkreutz. Im Süden des Landes übte die westungarische
Magnatenfamilie Bátthyany ihre Schutz- und Grundherrschaft aus. Im Laufe
des 16., 17. und 18. Jahrhunderts entstanden in diesem Bereich fünf
große jüdische Gemeinden: in Groß-Kanisza, Körmend, Rechnitz, Schlaining
und Güssing. Nur die drei letztgenannten befinden sich auf heute
burgenländischem Gebiet.
Die Ansiedlung von Juden erfolgte durch die
Ausstellung von "Schutzbriefen", mittels derer sich die "Schutzherren"
die dringend erforderlichen Geldmittel, die mitunter für einen
standesgemäßen Lebenswandel, aber auch für die Landesverteidigung gegen
die Türken benötigt wurden, beschaffen konnten. Die Ansiedlung von Juden
erfolgte daher weniger aus humanitären, sondern ausschließlich aus
wirtschaftlichen Gründen. Die Perioden des friedlichen Zusammenlebens -
oder besser gesagt - des friedlichen Nebeneinanders mit der christlichen
Umgebung wechselten mit Zeiten der Verfolgung und Ablehnung je nach den
Erfordernissen der Obrigkeit.
Unter diesen Bedingungen entwickelten die jüdischen
Gemeinden ein reges, ungestörtes und autonomes Kommunal-, Wirtschafts-
und Geistesleben mit einer spezifisch jüdischen Verwaltung und
Gemeindeorganisation (Notare, Ärzte, Hebammen, Schächter, Nachtwächter.
. .). Auch die lokale niedere Gerichtsbarkeit lag in den Händen der
jüdischen Funktionäre, für größere Vergehen waren weiterhin die
staatlichen Stellen zuständig. Besondere Bedeutung kam auch dem eigenen
Schulwesen zu. Daneben verfügte jede Gemeinde über einen eigenen
Friedhof und eine Synagoge sowie über andere religiöse Einrichtungen.
Die Juden siedelten meist in einem dazu bestimmten Ortsteil, der
Judengasse, die oft nur aus einer oder mehreren Häuserzeilen bestand.
Nach 1848 wurden aus den sogenannten "Schutzjuden"
ungarische Staatsbürger, die im Laufe des 19. Jahrhunderts die volle
bürgerlich-politische Gleichberechtigung erhielten. Obwohl das
Königreich Ungarn mit der österreichischen Reichshälfte durch eine Real-
und Personalunion verbunden war, herrschte im Bezug auf die Ausübung des
jüdischen Glaubens doch eine andere rechtliche Situation vor. In
Österreich galt das "Österreichische Israelitengesetz" aus dem Jahr
1890, nachdem für die jüdischen Kultusgemeinden keine finanziellen
Unterstützungen vorgesehen waren. In Ungarn allerdings wurde der
jüdische Glaube den christlichen Konfessionen gleichgestellt (1895),
wodurch die Juden ebenfalls in den Genuß von staatlichen Subventionen
für jüdische Religions- und Erziehungseinrichtungen kamen. Als das
Burgenland zur Zeit der Ersten Republik zu Österreich kam (1921),
erhielten sie auch weiterhin staatliche Unterstützung für ihre
Institutionen.
"Reise durch das Heinzenland"
Die Entwicklung der jüdischen Gemeinden nach dem
Ersten Weltkrieg war weniger durch den Wechsel von einem Staatsverband
zum anderen, als vielmehr durch die allgemeinen politischen und
wirtschaftlich Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg gekennzeichnet.
Als autonome orthodoxe israelitische Kultusgemeinden in den Jahren 1921
bis 1938 galten die Gemeinden von Frauenkirchen, Kittsee,
Unterberg-Eisenstadt (die bis 1938 auch politisch autonom war),
Mattersdorf (ab 1924: Mattersburg), Kobersdorf, Lackenbach,
Deutschkreutz, Rechnitz, Schlaining (ab 1930 wegen Abwanderung der Juden
aufgelöst; Nachfolgegemeinde: Oberwart) und Güssing. Sie sind aus den
Siedlungsgebieten des Nord- und Mittelburgenlandes und den
Siedlungsgebieten im Südburgenland hervorgegangen.
Unter dem Titel "Reise durch das Heinzenland" erschien
am 9. August 1919 in "Der Neue Tag" ein Artikel, in dem Joseph Roth den
Rabbiner von Deutschkreutz die Geschichte und den Alltag der Juden von
Deutschkreutz und der "Siebengemeinden" schildern läßt: "Mitten in
Deutschkreutz eine Filiale der Leopoldstadt. 70 jüdische Familien wohnen
seit 1.000 Jahren im Deutsch-Kreutzer Getto. Denn sie wohnen alle
zusammen, in einer großen Häusergruppe hinter den weiten Gehöften der
reichen Bauern und führen ein eigenes Leben . . .
Die Juden von Deutsch-Kreutz und den Schweh-Khilles
beschäftigen sich nur mit ehrlichem Handel und werden von der
christlichen Bevölkerung sehr geschätzt. Sie haben sich rein und
unvermischt erhalten, und aus ihren Gesichtern klagte das
jahrtausendealte Leid Ahasvers. Sie kennen keinen Tanz, kein Fest und
kein Spiel. Nur Beten und Weinen und Fasten . . ."
Der Verfolgung und Vertreibung der burgenländischen
Juden im Jahr 1938 ist ein sehr reges und dem Burgenland sehr
verbundenes Leben vorausgegangen. In den jüdischen Vierteln bestanden
bis 1938 alle Institutionen, die für ein jüdisches Gemeindeleben
notwendig waren: Gemeindesynagogen, rituelle Bäder, koschere
Restaurants, Schächter, jüdische Schulen, jüdische Armenhäuser, Spitäler
sowie verschiedene andere Einrichtungen der Wohltätigkeit. Das religiöse
und kulturelle Leben der jüdischen Bevölkerung des Burgenlandes äußerte
sich in der Zwischenkriegszeit auch in einer Reihe von religiösen und
gesellschaftlichen Vereinen: Bet-, Frauen-, Wohltätigkeits-, Jugend-,
Spar- und Fortbildungsvereine.
Der "Verein der israelitischen freiwilligen Feuerwehr"
in Mattersdorf stellte innerhalb der jüdischen Gemeinden des
Burgenlandes eine Besonderheit dar und war gewissermaßen auch Konkurrenz
der christlichen Feuerwehr desselben Ortes, wodurch regelrechte
Wettkämpfe entstanden.
Zahlreiche Persönlichkeiten
Während in der Mitte des 19. Jahrhunderts auf dem
Gebiet des heutigen Burgenlandes über 8.000 Judens lebten, betrug der
jüdische Bevölkerungsanteil in manchen Gemeinden (etwa in Lackenbach)
über 50 Prozent. Im Jahr 1934 wohnten im Burgenland noch etwa 4.000
Juden. Zahlreiche jüdische Persönlichkeiten sind über die Grenzen ihrer
Gemeinde hinaus bekannt geworden: wie etwa der Sozialist Dr. Julius
Deutsch (1884 bis 1968) aus Lackenbach, der Komponist Karl Goldmark
(1830 bis 1915) aus Deutschkreutz, der Geiger Joseph Joachim (1831 bis
1907) aus Kittsee, der Weinhändler und Kunstsammler Sándor Wolf (1871
bis 1946) aus Unterberg-Eisenstadt, auf dessen Sammlertätigkeit und
Anregung u. a. die Gründung des Burgenländischen Landesmuseums und die
Errichtung des Jüdischen Zentralarchives in Zusammenarbeit mit dem
Archivar und Bibliothekar der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien,
Leopold Moses (1888 bis 1943), zurückgeht.
"Bei uns im Burgenland herrschte immer Eintracht unter
der Bevölkerung, welcher Konfession dieselbe auch angehörte. Die
religiösen Juden des jüngsten Bundeslandes lebten mit der nichtjüdischen
Bevölkerung in musterhaften Einvernehmen, weil dieselbe eben auch treu
zu ihrer Religion, sei dieselbe nun evangelisch oder katholisch, stand"
. So wie in diesem Artikel, der 1933 in der jüdischen Zeitschrift
"Misrachi" erschienen ist, wurde auch nach 1945 in zahlreichen
Publikationen die pauschale Aussage über das friedliche Nebeneinander
von jüdischer und nichtjüdischer Bevölkerung im Burgenland vor dem Jahr
1938 bekräftigt.
Der bodenständige rassische, wirtschaftliche und
religiöse Antisemitismus im Burgenland vor 1938 ist daher nur anhand
weniger konkreter Beispiele nachweisbar und steht nach wie vor im
Schatten von idealisierten Vorstellungen und nostalgischer Verklärung
des angeblich einvernehmlichen Verhältnisses zwischen den
verschiedensten Bevölkerungsgruppen des Burgenlandes. Mit dem Auftreten
und der eher langsamen Verbreitung des Nationalsozialismus im Burgenland
nahm die antijüdische Stimmung aber deutlich zu.
Auflösung der Kultusgemeinden
Unmittelbar nach dem "Anschluß" Österreichs an
Hitler-Deutschland setzten im Burgenland - dem Bundesland mit dem
drittstärksten jüdischen Bevölkerungsanteil - die antijüdischen
Maßnahmen vehement ein: Einschüchterung und Terror, Boykott, Enteignung,
Ausweisung und schließlich die direkte Vertreibung. In kürzester Zeit
gelang es der Gestapo mit Hilfe örtlicher Parteigänger und Mitläufer,
das Burgenland "judenrein" zu machen.
Bereits im Oktober 1938 meldete die Israelitische
Kultusgemeinde in Wien an den Judenreferenten Adolf Eichmann, daß im
Burgenland sämtliche Kultusgemeinden (sieben größere und vier kleinere)
aufgelöst worden waren. Am 4. Dezember 1938 berichtete die
nationalsozialistische "Grenzmarkzeitung": "Zufolge der Maßnahmen der
deutschen Behörden hat gleich nach der Angliederung an das Reich eine
Absonderung der Juden eingesetzt, die nun als abgeschlossen bezeichnet
werden kann. Die Reste der Juden sind in einzelnen Bezirken auf sechs
bis acht Personen zusammengeschmolzen, so daß auf dem Gebiete des
ehemaligen Burgenland kaum mehr als 40 Juden anzutreffen sein dürften."
Mit dem 1938/39 entstandenen Romanfragement "Cella
oder die Überwinder" setzte Franz Werfel dem Untergang des
burgenländischen Judentums ein bleibendes literarisches Denkmal. In der
"wahren Geschichte vom wiederhergestellten Kreuz" erzählt er das
Schicksal der Parndorfer Juden, die bei Mörbisch über die Grenze nach
Ungarn abgeschoben und von den ungarischen Grenzbehörden wieder nach
Österreich zurückgeschickt wurden.
Vom 10. Mai 1938 bis 31. Dezember 1938 konnten von den
nach Wien geflüchteten burgenländischen Juden 1286 Personen auswandern.
Als 1939 die Auswanderung zu stagnieren begann, wurden die in Wien
verbliebenen Juden listenmäßig erfaßt und in größere meist illegale
Auswanderungstransporte auf dem Donauweg eingereiht und so ihre
Emigration betrieben. Bis 1940 war die illegale Einwanderung nach
Palästina, Shanghai und in die USA möglich. Die in Wien ohne jede
Ausreisemöglichkeit verbliebenen burgenländischen Juden wurden von der
Gestapo nach dem Osten deportiert.
Burgenländische Juden findet man in den
Polentransporten im Oktober 1939 und den Deportierungstransporten nach
dem Generalgouvernement im Frühjahr 1941. Als die große
Deportierungsaktion im Herbst 1941 nach Lódz, Riga, Minsk und Lublin
einsetzte, waren ohne jede Fluchtmöglichkeit in Wien zurückgebliebene
burgenländische Juden die ersten, die verschickt wurden.
Von jenen, die die nationalsozialistische Zeit
überlebt haben, wollte bis auf wenige Ausnahmen niemand mehr ins
Burgenland zurückkehren. Die einstige vielfältige Kultur des
burgenländischen Judentums zeigt sich heute sich nur mehr in
erschütternden Resten jüdischer Friedhöfe (Deutschkreutz, Eisenstadt,
Frauenkirchen, Gattendorf, Kittsee, Kobersdorf, Lackenbach, Mattersburg,
Rechnitz und Schlaining), von Synagogen und Bethäusern (Eisenstadt,
Kobersdorf, Rechnitz und Schlaining) und in und bei Symposien,
Ausstellungen und Ausstellungskatalogen.
So beherbergt etwa das frühere Wertheimer Haus in
Eisenstadt das Österreichische Jüdische Museum (1979 eröffnet) oder die
1938 in Schlaining verwüstete Synagoge das Österreichische Institut für
Friedensforschung. Auch einige Gedenktafeln sprechen von der langen
Geschichte der jüdischen Gemeinden des Burgenlandes, die im Jahr 1938
ein jähes Ende fanden.
Literatur:
- Widerstand und Verfolgung im Burgenland 1934 bis
1945. Eine Dokumentation. Hg. vom Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstandes. 2. Auflage Wien 1983.
- Gold, Hugo (Hg.): Gedenkbuch der untergegangenen
Judengemeinden des Burgenlandes. Tel Aviv 1970.
- Kesten, Hermann (Hg.): Joseph Roth. Werke in vier
Bänden. 3. Bd. Amsterdam 1973.
- Die Ergebnisse der österreichischen Volkszählung
vom 22. März 1934, Heft 1. Bearb. vom Bundesamt für Statistik. Wien
1935.
- Neumann, David Ignatz: Ein Leben - Ein Werk.
Eisenstadt 1988.
WIENER ZEITUNG, Sabine Lichtenberger |